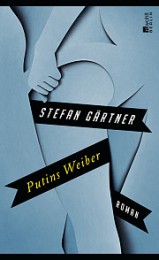 Ein Entscheidungsverweigerer im Beinahe-Vergangenen
Ein Entscheidungsverweigerer im Beinahe-Vergangenen
– Manche Schriftsteller glauben, dass es beim Romanschreiben darauf ankomme, den in ihnen selbst angelegten Stil weitmöglichst zu entwickeln. Das glatte Gegenteil praktiziert Stefan Gärtner (Jahrgang 1973). In zehn Jahren als Redakteur beim Satiremagazin Titanic hat er in Parodien zahlreiche Schreibstile und -formen imitiert, wodurch notwendigerweise der Witz einer Parodie erst zünden kann. Dementsprechend wählte er in seinem literarischen Erstling, der schelmischen Kanzlerin-Parabel „Angéla – Lehrjahre einer Liebeshungrigen“ (Knaus, 2013), eine an die barocke Handlungszeit angelegte Diktion mit Ausschmückungen und opulentem Vokabular. In „Putins Weiber“ nun bekommt es der Leser stilistisch mit einem ganz anderen Autoren zu tun ― vielleicht ein Grund, warum der Rowohlt-Verlag das Buch im Klappentext als Gärtners „literarisches Debüt“ verkauft. Von Michael Höfler
Der Roman erzählt von der amourösen Selbstfindung eines Mittdreißigers von heute in flüssigem, aber schnörkelfreiem Duktus. Protagonist Putin mag zwar seinen Spitznamen nicht, der klingt aber immerhin nicht ganz so blöde wie sein richtiger Name Waldemar. Als dem bewährten Entscheidungsverweigerer Freundin Vera einen Seitensprung gesteht, wäre dies für ihn kein Drama, sorgt Vera als Dauerfreundin doch dafür, dass es zwischenmenschlich wenig weiterzuentwickeln oder gar zu verändern gibt. Doch dummerweise ist Vera reflektiert, möchte herausfinden, was der Fehltritt zu bedeuten hat, und zieht erst einmal weg. Partner Putin bleibt über den Fortbestand ihrer Beziehung im Unklaren. An einem bierseligen Abend setzt ihm Freund Georg, längst Familienvater, auseinander, welche Gelegenheiten Putin früher bei Frauen ausgelassen hat. Für Putin Anlass herauszufinden, was ihm entgangen ist und die Frauen alle wieder zu treffen. Wie im richtigen Leben führt die Suche zum eigenen Ich, was „Putins Weiber“ zum Entwicklungsroman macht.
Genau beobachtet
Gärtner erzählt, und hier zeigt sich wieder der vielseitige Schriftstelller, kapitelweise in unterschriedlichen Perspektiven: aus Putins Ich-Sicht, aus auktorialer, aus Putings und aus Veras Personalperspektive; und zwei Kapitel sind gar Briefe. Dabei variiert der Erzählton kaum über die Sichtweisen, und der einsetzende Liebesreigen fällt ziemlich keusch aus. Viele andere Autoren haben noch mehr Bücher über die Generation 30+, über Karriere, Milchschaum, Biokost und den mit allem kompatibel zu seiendem Partner gefüllt. Wo aber andere am Ziel sind, wenn sie sich in Widersprüchen und Mann-/Frau-Gegensätzlichkeiten weiden, geht Gärtner viel weiter. Indem er nämlich das Wechselspiel im Zwischenmenschlichen zwischen Gedachtem, Antizipiertem und Gesagtem genau beobachtet und sprachlich fein umsetzt. Zwar ist Dramaturgie keine Stärke des Romans (in der auf filmische Kategorien reduzierten Danksagung fehlt das Stichwort Drehbuch), und wirkt das Personal recht homogen v.a. in punkto hoher Intelligenz. Dennoch zeigt „Putins Weiber“ mehr denn je Gärtners größte Stärke: Er weiß um einige Gehirnwindungen weiter zu reflektieren, als dies die allermeisten Leser gewohnt sein dürften. In einer Zeit, die später als vieles bezeichnet werden wird, nur nicht als Periode des Nachdenkens, höchst bemerkenswert.
Michael Höfler
Stefan Gärtner: Putins Weiber. Roman. Rowohlt Verlag, 2015. 288 Seiten. 19,95 Euro.











