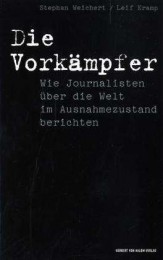 Krisen-Reporter: Ohne Grenzen und Schmerzen?
Krisen-Reporter: Ohne Grenzen und Schmerzen?
Kaum eine Berufsgruppe übt heute einen so gefährlichen Job aus wie Reporter in ausländischen Krisen- und Kriegsgebieten: Sie sollen möglichst schnell und objektiv berichten und trotz der hektisch-brisanten und gefährlichen Ereignisse umfassend informiert sein. Wie hat sich aber die Berichterstattung in den letzten Jahren durch die Neuen Medien verändert? Wie wirkt sich der Konkurrenzdruck von TV-Sendern, Print- und Online-Journalismus auf die Reporter aus? Werden die Berichte heute stärker emotionalisiert oder gar sensationslüstern frisiert? Und bleiben Informationen auf der Strecke, wenn drastische Bilder zu sehr in den Vordergrund rücken? Diesen Fragen gehen Stephan Weichert und Leif Kramp in ihrem Band „Die Vorkämpfer“ in Interviews und Analysen nach. Von Peter Münder.
Die Zeiten, da Kriegsreporter wie Peter Arnett (erst AP, dann CNN), James Fenton (Freelancer), David Halberstam (New York Times), Perry Kretz (Stern), Tim Page (Life-Photograph), Don McCullin (Sunday Times-Photograph) oder Michael Herr (Esquire & Rolling Stone) in Vietnam jederzeit mit einem US-Army-Hubschrauber mitfliegen oder sich überall an der Front selbstständig und unkontrolliert umsehen konnten, sind längst vorbei. Damals erhofften sich die US-Militärs trotz der kritischen Berichterstattung noch positive Imagekorrekturen durch die Medienunterstützung, während sie mit ihren schönfärberischen Presseverlautbarungen die Öffentlichkeit für dumm verkauften. „Der Vietnamkrieg markierte für die Medien das Ende einer Epoche“, befand Peter Arnett, „damals war es noch möglich, dass Reporter direkt von der Front mit ihren Berichten die Öffentlichkeit informierten und alle offiziellen Darstellungen über den angeblich schon ‚beinah gewonnenen Krieg‘ als krasse Lüge entlarven konnten – das alles ist heute nicht mehr möglich, weil Regierung und Militär eine von ihnen ganz gezielt kontrollierte Berichterstattung anstreben.“
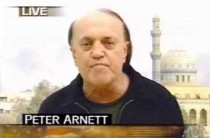 Embedded zwischen Sprengfallen …
Embedded zwischen Sprengfallen …
Inzwischen müssen Kriegsreporter in Afghanistan oder im Irak vor Selbstmordattentätern und Sprengfallen auf der Hut sein, was eigentlich nur noch „embedded“ in einer militärischen Einheit funktioniert. Aber die Praxis der offiziell verlautbarten Desinformation und der schönfärberisch präsentierten militärischen Aktivitäten deutscher, britischer amerikanischer und anderer NATO-Truppen ist so virulent wie während des Vietnamkriegs. Und die technologischen Entwicklungen haben längst auch zu neuen Praktiken im Krisen-Journalismus geführt: Immer schneller, bunter, emotionaler, oft aber auch oberflächlicher ist in weiten Bereichen die Berichterstattung geworden.
Einige Zahlen dokumentieren den gefährlichen Einsatz von Krisenreportern in Zeiten terroristischer Bedrohung: Im letzten Jahr wurden 57 Journalisten während ihres Einsatzes in Krisengebieten getötet, 51 wurden entführt. Und zurzeit sitzen in Addis Abeba gerade zwei schwedische Reporter im Knast, die über die Situation in Rebellengebieten berichten wollten und wegen angeblicher terroristischer Aktivitäten von der äthiopischen Regierung angeklagt sind. Höchste Zeit für eine gründliche Bestandsaufnahme also, wie sie Weichert/Kramp, Dozenten an der Hamburger Makromedia Hochschule für Kommunikation und Medien, in ihrem Buch anvisieren.
Aus Interviews mit insgesamt siebzehn Krisen-und Kriegsreportern, wissenschaftlichen Studien und Erfahrungsberichten haben sie einen informativen Mix zusammengestellt, der neueste Trends ebenso berücksichtigt wie soziologische Studien zur Sinnstiftung und subjektiver Wirklichkeitserhaltung durch Reportagen in Krisenzeiten wie etwa die von Berger/Luckmann („Die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit“ – mehr hier).
Neue Kriege, Neue Medien?
Aber was ist eigentlich eine „Selbstüberbietungsspirale“, die hier im Kontext einer Diskussion über neuere Entwicklungen im Journalismus erwähnt wird und entscheidende Aspekte hinsichtlich journalistischer Praktiken gut illustrieren kann?
Akribisch werden diverse Verhaltensmuster wie das „Palestine Syndrom“ (Herumhocken im sicheren Hotel, berichten ohne direkten Kontakt zum kritischen Geschehen), der Trend zum Unterhaltungsjournalismus, Amerikanisierung in TV-Berichten, die erhöhte Schlagzahl der Nachrichten, larmoyante Darstellung der eigenen Reporter-Misere, schwierige Recherchebedingungen, gestiegene technologische Erfordernisse usw. aufgelistet, mit denen die Reporter heute konfrontiert werden und die sie alle meistern müssen – es werden immer mehr, die in kürzeren Zeitabständen effizienter bewältigt werden sollen: „Neue Kriege, Neue Medien“ könnte das Fazit lauten.
Diese Aspekte werden gründlich beleuchtet und diskutiert und mit Zitaten und z.T. ätzend-kritischen Erfahrungsberichten prominenter Reporter – auch über ihre „embedded“-Einsätze mit deutschem Militär in Afghanistan – untermauert. Kurzporträts der interviewten siebzehn Krisenreporter/innen – darunter etwa der tollkühne „Lonesome Cowboy“ Christoph Maria Fröhder, die preisgekrönte, einfühlsame und keine Extremsituation (Tsunami und Fukushima!) scheuende Ariane Reimers (ARD-Korrespondentin in Peking) sowie Susanne Koelbl (Spiegel) runden diesen Band ab. Er wäre perfekt geworden, wenn noch ein Namens-und Sachwort-Register angefügt wäre.
Spannende, informative Pflichtlektüre für alle, die sich über die aktuelle Entwicklung bei Kriegs-und Krisen-Reportagen orientieren wollen.
Peter Münder
Stephan Weichert/Leif Kramp: Die Vorkämpfer. Wie Journalisten über die Welt im Ausnahmezustand berichten. Köln: Herbert von Halem Verlag 2011. 253 Seiten. 22 Euro.
Vgl. auch: Peter Arnett: Vietnam and War Reporting. In: Media Studies Journal, Spring 1997, S. 32-38.
Ders.: Unter Einsatz des Lebens. München 1994.
James Fenton: All the wrong Places. Adrift in the Politics of Asia. London 1988.
Don McCullin: Unreasonable Behaviour. An Autobiography. London 1990.











