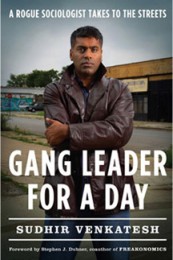 Feldforschung bei Crack-Dealern und im indischen Slum
Feldforschung bei Crack-Dealern und im indischen Slum
– Wenn US-Soziologen ihre Studien im Milieu von Drogendealern und Kriminellen betreiben und ihre Erkenntnisse veröffentlichen, wird es spannend. Denn Titel wie „Gang Leader for a Day“ oder „On the Run“ wären hierzulande undenkbar. Manche Feldforscher verlieren beim allzu intensiven Eintauchen in die triste Unterwelt aber auch den Überblick, weil sie sich während ihrer „Total Immersion“-Praxis zu sehr mit ihrer Klientel identifizieren. Teil I, von Peter Münder.
Rückblick und Präambel: Da George Orwell so etwas wie der Pionier der modernen Sozialreportage inklusive „Total Immersion“-Erfahrung war, ist ein kurzer Rückblick auf „The Road to Wigan Pier“ wohl angebracht: Als Orwell sich im Februar 1936 – damals noch als Eric Blair – auf den Weg zu den Kohlegruben von Wigan machte, um sich direkt vor Ort über die miserablen Lebensbedingungen der Kohlearbeiter zu informieren, quartierte er sich in der Darlington Street bei der Familie Brooker ein. Im Vierbettzimmer, das er sich mit drei Kumpeln teilte, wieselten Kakerlaken und anderes Ungeziefer herum, „es stank wie im Frettchenkäfig, und morgens beim Frühstück stand der volle stinkende Nachttopf unter dem Tisch“, schrieb Orwell dann in seiner 1937 veröffentlichten Reportage „The Road to Wigan Pier“.
Der eigentliche Skandal, den er damals enthüllte, war die von den Minenbetreibern routinemäßig einbezogene „Death Stoppage“: Den Arbeitern wurden wegen der hohen Unfall- und Sterberate ganz offiziell Beiträge für die Witwenversorgung und für Hinterbliebene vom Lohn abgezogen, außerdem mussten sie Gebühren für Grubenlampen und benutztes Werkzeug bezahlen. Orwells Hinweis auf jährlich ca. tausend tödlich verunglückte Minenarbeiter (von ca. 35 000) kam damals einer Kriegserklärung gleich und sorgte für großes Aufsehen. Der junge Reporter versuchte damals auch, durch die Kohleflöze zu kriechen wie die anderen Arbeiter, er war dafür aber viel zu lang, musste sich im unerträglichen gebückten Kriechgang fortbewegen und litt schließlich an so starken Rückenschmerzen, dass ihn die Kollegen aus dem Stollen ziehen mussten.
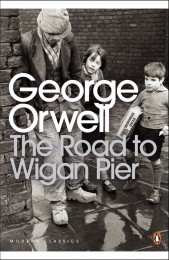 Aber das war nicht der Grund für die vorzeitige Beendigung seines zweiten soziologischen Selbsterfahrungs- und Reportageprojekts nach der Obdachlosenstudie „Down and Out in Paris and London“ von 1933: „Der Nachttopf unter dem Frühstückstisch gab mir dann den Rest“, schrieb er. Diese kritischen Beobachtungen wirken auch heute noch nach: Als ich mich vor einigen Jahren in Wigan auf Orwells Spuren begab, fluchte und tobte der Bibliothekar der Stadtbücherei Simon Martin so inbrünstig über den „Nestbeschmutzer“ Orwell und zeigte mir uralte Leserbriefe empörter Einheimischer, als wäre der kritische Bericht des berühmten Autors gerade erst veröffentlicht worden: „Sie glauben doch hoffentlich nicht all diese Lügengeschichten, die er über Wigan fabriziert hat?“, wollte er sofort wissen, als ich mein Interesse an Orwells damaligen Erfahrungen und Archiv-Recherchen bekundete. Dabei ging Orwell ja als Kämpfer gegen Unrecht und Unterdrückung später noch einen Schritt weiter, als er im spanischen Bürgerkrieg in der Internationalen Brigade gegen die Franco-Faschisten kämpfte.
Aber das war nicht der Grund für die vorzeitige Beendigung seines zweiten soziologischen Selbsterfahrungs- und Reportageprojekts nach der Obdachlosenstudie „Down and Out in Paris and London“ von 1933: „Der Nachttopf unter dem Frühstückstisch gab mir dann den Rest“, schrieb er. Diese kritischen Beobachtungen wirken auch heute noch nach: Als ich mich vor einigen Jahren in Wigan auf Orwells Spuren begab, fluchte und tobte der Bibliothekar der Stadtbücherei Simon Martin so inbrünstig über den „Nestbeschmutzer“ Orwell und zeigte mir uralte Leserbriefe empörter Einheimischer, als wäre der kritische Bericht des berühmten Autors gerade erst veröffentlicht worden: „Sie glauben doch hoffentlich nicht all diese Lügengeschichten, die er über Wigan fabriziert hat?“, wollte er sofort wissen, als ich mein Interesse an Orwells damaligen Erfahrungen und Archiv-Recherchen bekundete. Dabei ging Orwell ja als Kämpfer gegen Unrecht und Unterdrückung später noch einen Schritt weiter, als er im spanischen Bürgerkrieg in der Internationalen Brigade gegen die Franco-Faschisten kämpfte.
Soziologische Studien über Randgruppen oder kriminelle Außenseiter sind heute ja meistens – abgesehen von getarnten Untergrund-Rechercheuren wie Günter Wallraff – von Schreibtischtätern ohne intensiven Bezug zur Realität verfasst: Selbst wenn ein Soziologe wie Horst Bosetzky unter dem Pseudonym „ky“ Krimis verfasst („Das Double der Bankiers“), merkt man seinen Schmökern an, dass der Autor als Verwaltungs- und Bürokratieforscher eher auf so brisante Themen wie „Das Wegloben als Sonderform der vertikalen Mobilität“ (Thema einer Studie von ihm) oder auf das Zählen von Büroklammern in hohen Amtsstuben kapriziert ist.
Hostage for a Night, Gang Leader for a Day
Inzwischen sind die Erfahrungen abenteuerlustiger Feldforscher mit ethnologischen Ambitionen im Stile eines im brasilianischen Dschungel mit Indianern lebenden Claude Levi-Strauss (Vgl . „Tristes Tropiques“, 1955) härter, negativer und gefährlicher geworden. Das kriminelle Milieu ist immer noch das Eldorado von Außenseitern, und wer die Thesen von Emile Durkheim über Anomie und abweichendes Verhalten überprüfen will, muss sich natürlich auch irgendwie diesem Milieu annähern. Während Rotlichtexperten wie Frank Göhre (St. Pauli-Trilogie) früher noch intensiv das Reeperbahn-Umfeld sezieren, Nutten, Zuhälter und sogar Killer interviewen konnten, ist dies heute wegen der Brutalität von albanischen und anderen organisierten Clans an der Elbe kaum noch möglich: „Denn beim kleinsten Mißverständnis, oder wegen eines irritierten Grinsens kriegst Du heute gleich was auf die Nuß“, erklärt der Hamburger Experte der „geilen Meile“ und Meister soziologischer Analysen, die subtil in knallharte Plots eingewebt sind .
 Das weltweit erste Institut für Soziologe wurde 1892 in Chicago gegründet. Diese Chicago School zog schnell die brillantesten Köpfe an, berühmte Soziologen wie Erving Goffman studierten hier. Die Chicagoer Universität kann inzwischen mit 70 Nobelpreisträgern die höchste Quote aller Unis an solch hochkarätigen Preisträgern vorweisen. Die soziologische Feldforschung in den USA hatte sich schon früh auf Grenzbereiche mit devianten Außenseitern kapriziert:
Das weltweit erste Institut für Soziologe wurde 1892 in Chicago gegründet. Diese Chicago School zog schnell die brillantesten Köpfe an, berühmte Soziologen wie Erving Goffman studierten hier. Die Chicagoer Universität kann inzwischen mit 70 Nobelpreisträgern die höchste Quote aller Unis an solch hochkarätigen Preisträgern vorweisen. Die soziologische Feldforschung in den USA hatte sich schon früh auf Grenzbereiche mit devianten Außenseitern kapriziert:
Erving Goffman (1922–82) als Urvater der modernen anthropologischen Soziologie, untersuchte das Kommunikationsverhalten von Inselbewohnern auf den schottischen Shetlandinseln, die Identitätsstörungen von stigmatisierten Außenseitern („Stigma“,1963), Rollenverhalten und Identitätskonzepte („The Presentation of Self in Everyday Life“, 1959) und in einer ausführlichen Studie von 1961 die Assimilation von Außenseitern in geschlossenen psychiatrischen Anstalten („Asylums“, 1961). Dabei ging es zwar auch grenzwertig zu, in lebensgefährlichen Situationen bewegte sich Altmeister Goffman jedoch nie. Alice Goffman wollte ihren Vater offenbar mit einem Vorstoß in gefährlichere Grenzbereiche übertrumpfen und entschloss sich, aus ihren Erfahrungen im kriminellen Dealer-Umfeld von Philadelphia ihre soziologische Diplomarbeit zu fabrizieren, die nun unter dem Titel „On the Run“ veröffentlicht wurde.
Der neueste, allerdings auch etwas umstrittene Superstar unter den „Rogue Sociologists“ ist aber zweifellos Sudhir Venkatesh, 47: Mit seiner rasanten Studie „Gang Leader for a Day“ eroberte er 2008 die US-Bestellerlisten, er war regelmäßig prominenter Gast in TV-Talkshows und produzierte einen Film über seine Erfahrungen an der Crackdealer-Basis, wo man mit einem Stundenlohn von drei Dollar und dreißig Cents noch gut bedient ist. Sein neuestes Buch „Floating City“ behandelt die kommerziellen Aspekte der New Yorker Escort- und Prostitutionsszene und deren wirtschaftliche Aspekte. Zweifellos gelang es Venkatesh, die gesamte Soziologenszene aufzumischen, neue Aspekte der kriminellen Untergrund-Ökonomie zu beleuchten und die menschliche Seite des Drogenumfeldes ins Visier zu nehmen: Die Gang, so Venkatesh, sorgt ja auch als eine Art Großfamilie mit Kinderbetreuung, Suppenküchen und Squatter-Betreuung für ihre hilflosen Außenseiter, weil die städtischen Behörden auf ganzer Linie versagen. Natürlich sind die Gangs im (inzwischen platt gemachten) gigantischen Robert Taylor-Ghetto mit 40 000 Bewohnern keine philanthropischen Samariteraußenstellen, aber mit Barbecue-Festen, Sportveranstaltungen und Kinderbetreuungsprogrammen, um die sich meistens ältere Frauen kümmern, appelliert man an die soziale Verantwortung der gesamten Gruppe.
Die US-Reporterin Katherine Boo stellt einen beeindruckenden Gegenpol zum extrovertierten Venkatesh dar: Sie nimmt sich in ihrer Slumreportage aus Bombay („Behind the Beautiful Forevers“) völlig zurück, stellt nur die Slumbewohner und ihre Probleme in den Mittelpunkt und erzielt mit ihrem intensiven Eintauchen in eine Hölle, die Gorki nicht abgründiger und hoffnungsloser dargestellt hätte, eine so starke Wirkung, dass man einen Aufstand protestierender und randalierender Inder erwartet hätte, um dem behördlich tolerierten und geförderten Sumpf aus Korruption und Gewalt endlich ein Ende zu bereiten. Das am Flughafen gelegene Müllkippenslumviertel hat man inzwischen platt gemacht. Und die Müllsammler wurden mal wieder ihrem trostlosen Schicksal überlassen.
Rebellischer Grenzgänger
Zuerst stand Sudhir Venkatesh als junger Student im Rahmen eines soziologischen Seminarprojekts mit seinem Fragebogen an heruntergekommenen Chicagoer Wohnblocks, in denen arme Schwarze lebten und ihn extrem misstrauisch beäugten. An zugemüllten und versifften, dunklen, vollgeschmierten Treppenhäusern sah er Pulks von biertrinkenden, herumhängenden Mitgliedern der „Black King“-Gang, zwischen denen die Crackdealer und ihre Kunden herumwieselten.
Damals war der angehende Soziologe, der inzwischen Professor an der Columbia University ist, noch „Grateful Dead“-Fan, der sich im lockeren Hippie-Look mit langen Haaren und verlottertem Outfit präsentierte. Der aus einer eingewanderten indischen Familie stammende Venkatesh hatte in San Diego Mathematik studiert, was ihm dann zu abstrakt erschien; er wechselte dann beim Umzug nach Chicago zur Soziologe. Die bürokratisch anmutenden Fragestellungen der meisten Soziologen, die mehr Interesse an Statistiken und Zahlenspielereien als an Kontakten zu den betroffenen Mitmenschen hatten, irritierten und ärgerten ihn besonders.
Er wollte die Probleme der Ghettobewohner jedenfalls direkt vor Ort eruieren und nicht am Schreibtisch. Also fragte er einige der vorbeilaufenden Black King-Typen: „Wie fühlt man sich, wenn man schwarz und arm ist?“ Unter den Multiple-Choice-Antworten hatten sie die Wahl zwischen „Sehr schlecht, ziemlich schlecht, geht so, ganz gut, sehr gut“. Ein Typ mit großem Hut lachte ihn aus und fluchte: „Fuck you! You got to be fucking kidding me!“ Denn nicht nur die naiv-dümmliche Frage nach ihrer Lebensqualität im abbruchreifen Slum nervte und provozierte die Befragten – sie fühlten sich auch keineswegs als „Blacks“ oder „African Americans“, sondern als arbeitslose und ausgegrenzte „Nigger“, während die Afro Americans nach ihrer Ansicht mit Schlips und Kragen zur Arbeit gehen würden. Auch untereinander redeten sich alle mit „Nigger“ an, was den Soziologiestudenten Venkatesh ziemlich ratlos machte. Die Black-King-Mitglieder hielten den dümmlich-naiven Tenor der Fragen für eine Veralberung, auf die sie mit belustigtem Kopfschütteln reagierten oder dem Jungakademiker gleich den Tipp auf den Weg gaben, er solle sich gefälligst einen anderen Scherz ausdenken. Ernst nehmen konnten sie ihn jedenfalls nicht.
Dann wurde ihm plötzlich eine Knarre an die Stirn gehalten: Er sollte bekennen, von mexikanischen Drogendealern geschickt worden zu sein, um die Marktlage in Chicago für eine anvisierte Expansion der mexikanischen Clans zu sondieren. Schließlich war er ja so dunkelhäutig wie ein Südamerikaner und offenbar konnte er auch „Mexikanisch“ sprechen. Die mit Crack dealenden Dumpfbacken konnten einfach nicht glauben, dass ein unbedarfter Student so tollkühn sein konnte, sich ganz allein unter Schlägern, Drogensüchtigen, Säufern, Geldwäschern, Waffenhändlern und Killern in ihrem Revier herumzutreiben. Daher war der Fall für sie klar und seine Exekution schnell beschlossen. Die Typen, die ihn verhört hatten, wollten ihn auch gleich umlegen. Dann entwickelte sich darüber ein langer Disput, der Fragebogenforscher wurde über Nacht im Ghetto festgesetzt, bis am nächsten Morgen der Bandenchef JT erschien und ein Machtwort sprach: Der fand den wissbegierigen Soziologen sympathisch und befand, er könnte sein „Hanging Out“ mit den „Niggers“ ruhig fortsetzen – aber ohne seine idiotischen Fragebögen. JT hatte früher selbst studiert, interessierte sich für die unorthodoxe Feldforschung und hoffte, Venkatesh würde über ihn eine glorifizierende Biografie verfassen. Er rettete ihm mit seiner Intervention das Leben. Ohne dessen Unterstützung hätte Venkatesh wohl auch keine Chance für das Gelingen seiner Studie gehabt.
Zweifellos habe Sudhir Venkatesh zwei gravierende Defizite, bescheinigte ihm sein Freund Stephen Dubner, Autor der Bestsellerstudie „Freakonomics“: „Er hat überhaupt keine Angst, dafür aber ein viel zu exzessives Erkenntnisinteresse.“
Zum Chaos im Ghetto gehörten Drive-By-Shootings rivalisierender Gangs, Schlägereien mit Waffengewalt, die Vergewaltigung junger Frauen. Venkatesh registrierte all diese Ereignisse, führte darüber Protokoll und wurde im Verlauf seiner zehnjährigen Studie und der intensiven Gespräche mit dem Gang Leader JT zu einer Art „Ehrenhäuptling“ der Black Kings. Er lebte zwar weiter in seinem Apartment außerhalb des Ghettos, verbrachte aber häufig Nächte mit Säufern, Drogensüchtigen und Dealern in Matratzenlagern, in denen einige auch länger hausten und ihre ausrangierten, mit speziellen Sicherheitsschlössern ausgerüsteten Kühlschränke hatten. Er begleitete JT zu Sondierungstreffen mit Führern anderer Gangs, wurde von fürsorglichen Frauen im Slum verköstigt, die ihm eine Nische zum Ausruhen, Lesen und Schreiben seiner Notizen anboten. Der Blick, den der Grenzgängersoziologe ins Innerste der Gang werfen kann, ist mindestens so bemerkenswert wie die turbulente, phasenweise sehr gefährliche Interaktion mit den Black Kings.
Denn JT überlässt ihm sogar die Geschäftsbücher, gewährt ihm einen Überblick über Aufbau und Struktur dieser Gang, die im Grunde genauso hierarchisch mit Direktoren, Vice Presidents und den für Drecksarbeit zuständigen Footsoldiers organisiert wie etwa MacDonalds oder General Motors. Und am Rande räumt er auch auf mit dem Mythos von der riesigen Gewinnmarge der Drogendealerei: Für das Verscherbeln all der feinsäuberlich abgepackten Crackpäckchen bekommt der an den Ecken dealende Footsoldier gerade mal einen Stundenlohn von 3,30 Dollar. Bemerkenswert sein Statement „The gang is not just a destructive force!“ Er selbst wurde ja nach der turbulenten „Knarre-am-Kopf-Aufwärmphase“ und aufgrund der engagierten Intervention von JT gut behandelt. Und er durfte auch tatsächlich „Gang Leader for a Day“ spielen und unter Anleitung von JT alle Untergruppen der Black Kings bei ihren Aktivitäten anleiten oder ihnen Ratschläge erteilen, die allerdings auch abgelehnt wurden, wenn sie zu abwegig oder unrealistisch waren.
Kann sein, dass inzwischen aus dem „Rogue Sociologist“ ein unkorrekter Buchhalter oder Finanzjongleur geworden ist, wie die „New York Times“ berichtet: Professor Venkatesh soll während seiner Aktivitäten für ein Forschungsprojekt an der Columbia University rund 250 000 Dollar unterschlagen oder an nicht zu eruierende Empfänger geleitet haben – der Fall ist ziemlich unklar, einen Teil der fehlenden Gelder hat der „Rogue Book-Keeper“ inzwischen zurückgezahlt. Wie auch immer: Kaum jemand kann komplexe gruppendynamische Prozesse, Außenseiterverhalten und markwirtschaftliche Aspekte des Drogenhandels so plastisch, farbig und faszinierend beschreiben wie er. Und vor allem: Venkatesh beschreibt seine eigenen Unbeholfenheiten ungeschönt, drastisch und aus einer herrlichen, selbstironischer Distanz. Nie stellt er sich als allwissenden Schlaukopf dar, auch wenn er sich gern im Mittelpunkt des Geschehens sieht.
Peter Münder
Lesen Sie in der nächsten Woche Teil 2.
Sudir Venkatesh: Gang Leader for a Day. A Rogue Sociologist Crosses the Line. Penguin Books. 302 Seiten. London 2009. Verlagsinformationen zum Buch. Zur Homepage des Autors.
Ders: Floating City. A Rogue Sociologist Lost and Found in New York´s Underground Economy. Penguin Books 2013
Alice Goffman: On the Run. University of Chicago Press 2014, 277 S.
Katherine Boo: Behind the Beautiful Forevers. Life, Death and Hope in a Mumbai Slum. Portobello Books, 257 S. London 2012











