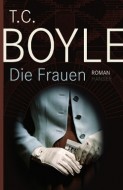 Der Mann, den die Frauen liebten
Der Mann, den die Frauen liebten
Dieser Roman kommt nicht so recht in Gang, Boyles komplexe Erzähltechniken führen ins Nichts, umkreisen die Hauptfigur in immer gleichen Schleifen, ohne wirklichen Erkenntnisgewinn – und sind auf Dauer schlicht langweilig, ärgert sich Petra Vesper.
Hinter jedem erfolgreichen Mann steht bekanntlich eine starke Frau – nun: Hinter Frank Lloyd Wright, einem der größten Architekten des 20. Jahrhunderts, standen gleich vier – allerdings recht unterschiedlich starke – Frauen: seine drei Ehefrauen Catherine, Miriam und Olgivanna sowie seine Geliebte Mamah. Das behauptet jedenfalls der amerikanische Autor T.C. Boyle mit seinem jüngsten Roman Die Frauen, der eine biografische Annäherung an Frank Lloyd Wright ist.
Nach John Harvey Kellogg (Willkommen in Wellville) und Alfred Charles Kinsey (Dr. Sex) widmet sich Boyle damit nun schon zum dritten Mal einer der eher exzentrischen Lichtgestalten Amerikas. Und wie beim manischen Gesundheitsapostel Kellogg und dem verklemmten Sexforscher Kinsey zeigt Boyle auch an der Figur Wrights, dass viel Licht immer auch verbunden ist mit viel Schatten, dass die genialischen Entwürfe des Architekten und seine immense Produktivität nicht zuletzt erkauft wurden durch die Ausbeutung seiner Mitarbeiter und die Ausnutzung seiner jeweiligen Partnerin.
Boyles Timing stimmt: In diesem Jahr feiert Frank Lloyd Wrights wohl berühmtestes Bauwerk, das New Yorker Guggenheim-Museum, sein 50-jähriges Jubiläum, womit auch sein Schöpfer wieder stärker in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerät. Doch Boyles Interesse an Frank Lloyd Wright kommt nicht von ungefähr: Vor 15 Jahren kaufte er mit seiner Frau ein Haus des Architekten in Kalifornien. Hatte er das Haus ursprünglich eher aus Zufall erstanden, weil er mit seiner Familie ein altes Haus suchte, begann er nun, sich für den Erbauer zu interessieren und auch das Haus möglichst originalgetreu zu restaurieren.
Diese Rekonstruktion betreibt er nun auch mit dem Mittel der Sprache – allerdings dürfte das Bild des Architekten-Genies, das dabei entsteht, kaum zur Heldenverehrung taugen. Boyles Wright ist ein Besessener, ein Maniac, ein notorisch dauerklammer Filou, der bei den Dorfbewohnern in seiner Umgebung nur „Frank Säumig“ genannt wird, ein Egomane und „… ein Schürzenjäger und Soziopath, der das Vertrauen von praktisch jedem, den er kannte, missbrauchte, besonders das der Frauen …“
In immergleichen Schleifen
Die Erzähltechnik, die Boyle für sein Wright-Porträt verwendet, ist reichlich vertrackt: Boyle bedient sich der (fiktiven) Figur des Wright-Adepten Sato Tadashi, eines japanischen Architektur-Studenten, der 1932 als Bewunderer Wrights und seiner Arbeit auf dessen Anwesen Taliesin im ländlichen Wisconsin kam und neun Jahre lang als Schüler dort lebte. Viele Jahre später, 1979, beschließt Tadashi, rückblickend die Biografie Wrights zu schreiben, und zwar aus der Perspektive seiner drei Ehefrauen und seiner langjährigen Geliebten. Dabei zäumt er das Pferd von hinten auf und beginnt mit der ersten Begegnung Wrights mit seiner letzten Ehefrau Olgivanna. Und als wäre das der Brechungen noch nicht genug, fügt Boyle mit dem Übersetzer Seamus O’Flaherty, der Sato Tadashis Manuskript aus dem Japanischen übersetzt und mit Anmerkungen und Fußnoten versieht, zur fiktiven Erzählerfigur noch eine fiktive Herausgeberfigur hinzu. Dienen solche Erzähler-Herausgeber-Konstruktionen in der Literaturgeschichte klassischerweise dazu, eine, auch noch so unwahrscheinliche Handlung zu beglaubigen, bewirken sie bei Boyle das genaue Gegenteil: Das Erzählte wird immer unschärfer. Da ist der zeitliche Abstand, das unzuverlässige Gedächtnis, die verschiedenen Quellen, die Möglichkeit der Verfremdung durch die Übersetzung und die Kommentare des Herausgebers. All das trägt dazu bei, dass die Figur Wrights im Verlauf der über 500 Seiten nie an Konturenschärfe gewinnt und gleichzeitig keine Entwicklung durchmacht. Und auch Wrights Frauen, die – wie der Titel des Romans suggeriert – ja vielleicht die Hauptakteure sein könnten, bleiben ziemlich farblos. Obwohl sie alle eigentlich schillernde Figuren sind, geraten sie bei Boyle zu Frauen-Typen – die Emanzipierte, das Opfer, die Furie – und die Schilderung der jeweiligen Beziehungen bleibt in Rollen-Klischees stecken.
Gerade in dieser komplexen Struktur liegt also das große Problem dieses Romans: Er kommt von der ersten Seite an nur schwer in die Gänge, verliert sein eigentliches Sujet, Frank Lloyd Wright, immer wieder aus den Augen, um sich in Abschweifungen und Seitensträngen zu verlieren. Nun sind Abschweifungen (wie wir schon seit Sternes Tristram Shandy wissen) an und für sich nichts Schlimmes, ja können im besten Fall sogar die Essenz eines literarischen Werkes ausmachen, doch in diesem Fall führen die Umwege ins Nichts, umkreisen die Hauptfigur in immer gleichen Schleifen, ohne wirklichen Erkenntnisgewinn und sind auf Dauer schlicht langweilig. Bleibt zu hoffen, dass Boyle als Hobby-Restaurator seines Wright-Hauses erfolgreicher zu Werke geht.
Petra Vesper
T.C. Boyle: Die Frauen (The Women, 2009).
Deutsch von Kathrin Razum und Dirk van Gunsteren.
Hanser Verlag 2009. 560 Seiten. 24,90 Euro.











