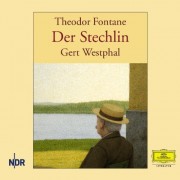Nur ein See?
Der Große Stechlin – Fontanes Reise in die Unterwelt.
Ein Essay von Markus Pohlmeyer
Beim wiederholten Hören von Theodor Fontane „Der Stechlin“, gelesen von Gert Westphal[1] …
Der Stechlin der Wanderungen
Er ist eine Provinzgröße und steht in empathischer Verbindung mit der ganzen Welt. Er ist ein Seismograph für politische Umwälzungen. Er ist ein See: der Große Stechlin. Fontane hat ihm ein literarisches Denkmal gesetzt, in seinen Wanderungen und im gleichnamigen Roman „Der Stechlin“. Hier soll nur auf den Stechlin der Wanderungen eingegangen werden. Die Wanderungen durch die Mark Brandenburg „[…] wurden als Schreibprojekt auf Fontanes Schottlandreise von 1858 geboren. Die aber stand ganz im Zeichen der Poesie von Landschaft und Geschichte, d. h. im Zeichen von Walter Scott.“[2]
Die Menzer Forst bündelt en miniature das thematische Verfahren der Wanderungen: „Als typische Gegenstände mündlichen Lokal- und Regionalwissens erscheinen Kriegserinnerungen, etlichemal Adels- und Hofüberlieferungen und insbesondere Spuk- und Gespenstergeschichten […]. Der ‚Volksmund‘ in Fontanes Wanderungen ist offenbar ein notorischer Romantiker, mit kräftigem Einschlag in Richtung Gothic novel.“[3] Die Menzer Forst, ein Relikt aus der Zeit des Großen Königs, sei auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft worden. Die Experimente mit Kohlenmeilern und Glashütten hätten sich nicht rentiert. Die dann praktizierte wirtschaftliche Lösung wurde fast zum Auslöser einer ökologischen Katastrophe: Der Wald verschwindet innerhalb von 30 Jahren in den Schornsteinen Berlins. Dem wurde aber Halt geboten. Der Wald regenerierte sich. Die Reise geht nun gewissermaßen nicht mehr durch etwas Ursprüngliches, sondern durch eine wiederauferstandene, künstliche Welt:
„[…] die Menzer Forst aber stieg auf der tabula rasa ihres alten Grund und Bodens neu empor: Eichen, Birken, Kienen im bunten Gemisch, und die Bestände, wie sie sich jetzt repräsentierten, sind das Kind jener Schonzeit und Stillstandsepoche, die dem 30 Jahre lang geführten ‚guerre à outrance‘ auf dem Fuße folgte.“[4]
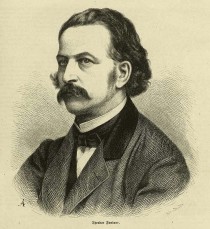
Fontane 1860 (Wikimedia Commons)
Hier ist ein Motiv eingeführt, das die folgenden Geschichten durchdringen und indirekt kommentieren wird: aus dem Krieg gegen die Natur wird ein Panorama des Krieges Mensch gegen Mensch variantenreich entwickelt. Der Wald ist zunächst ein Ort des Gedächtnisses: „[D]a sind immer ‚Geschichten‘ zu Haus. Tabellen wären hier anzufertigen mit drei Rubriken nur: erschlagen, erschossen, ertrunken.“[5] Dieses wirkungsvolle Trias und Alliteration (inklusive Asyndeton) bündelt die Gewaltgeschichte des Waldes: Wildschütz und Förster und die uralten Menschenopfer sind Topoi für menschliche Gewalt.[6] Dann folgt noch die Erzählung eines unaufgeklärten Mordes, was das Unheimliche steigert: „Ein groß Begräbnis gab es, groß wie die Teilnahme, aber das Geheimnis seines Todes hat der Tote mit ins Grab genommen.“[7] Die Welt der Toten schweigt und doch wird sie später in einer anderen Geschichte wieder Einfluss auf die Welt der Lebenden nehmen.
(Touristischer) Erzähler und (mitreisender) Leser erreichen schließlich den See: „Da lag er vor uns, der buchtenreiche See, geheimnisvoll, einem Stummen gleich, den es zu sprechen drängt. Aber die ungelöste Zunge weigert ihm den Dienst und was er sagen will, bleibt ungesagt.“[8] Auffallend ist die Personifikation des Sees, auffallend, wie häufig in den wenigen Zeilen das Wortfeld (Nicht)Sprechen variiert wird (Hervorhebungen von mir). Eine Charakteristik des Stechlins folgt unmittelbar; aber wer erzählt diese? Der See habe auf das Lissabonner Erdbeben reagiert, modern gesprochen: ein Phänomen einer vernetzten und globalisierten Welt. Das Erdbeben hinterließ auch in der Diskurslandschaft Europas seine Spuren, und zwar in der Form einer verschärften Theodizeeproblematik. Der Vernunftoptimismus der Aufklärung wurde auf die Probe gestellt. Leben wir wirklich in der besten aller möglichen Welten, frei nach Leibniz?
![Fontane, Theodor: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Bd. 1: [Die Grafschaft Ruppin. Der Barnim. Der Teltow]. Berlin, 1862.](https://iza-server.uibk.ac.at/pywb/dilimag/20210113092156im_/http://cult-mag.de/wp-content/uploads/2014/11/fontane_brandenburg01-163x260.jpg)
Fontane, Theodor: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Bd. 1: [Die Grafschaft Ruppin. Der Barnim. Der Teltow]. Berlin, 1862 (Staatsbibliothek zu Berlin)
Zwei bedrückende Episoden schließen sich im Weiteren an: „[… B]ei der Globsower Glashütte […] spielten Kinder Krieg und fochten ihre Fehde mit Kastanien aus […]. Die einen retirierten eben auf den See zu […], aber der Feind gab seinen Angriff nicht auf […].“[10] Wie „[…] Förster und Wildschütz ihre nicht endende Fehde führen […]“[11], entkommen auch die Kinder dem Schicksal eines ewigen Krieges aller gegen alle nicht. Die zweite Episode ist der Versuch, die Frontinschrift einer Grabstelle „Metas Ruh“ zu erklären. Es folgt eine dialektal wiedergegebene Gothic novel-Friedhofsgeschichte, in der die unruhige Welt der Toten die Lebenden beeinflusst (Nachts sei ein Sarg transportiert worden!). – „Der Autor der Wanderungen liebt es, so präsent seine eigene Stimme jederzeit bleibt, sich als bloßen Vermittler zu stilisieren. Die eigentlichen Erzähler seien die Leute der Region, ja letztlich die Orte und Gegenden selbst […].“[12] – Und dennoch versieht der (quasi-authentische) dialektale Erzähler diesen seinen Bericht mit einem Index der Unschärfe: „Ick weet et nich.“[13]
Nach der Kutschfahrt durch die Menzer Forts rastet die Reisegesellschaft vor einem gemütlichen Kamin: „Die Scheite, echte Kinder der Menzer Forst, brannten hoch auf […]“[14] – wie in den Schornsteinen Berlins. „Die Rede ging von alter und neuer Zeit. Märchenhaft verschwamm uns Jüngsterlebtes mit Längstvergangenem […].“[15] Märchenhaft könnte hier eine romantisierende Anspielung auf das Unbestimmte, Unbestimmbare sein. Und nun geschieht etwas Seltsames: „Und während wir eben noch über den Rheinsberger See hinglitten […], weitete sich plötzlich das stille Wasserbecken und bildetet Strudel und Trichter, und der Hahn, der unten auf dem Grunde des Großen Stechlin sitzt, stieg herauf und krähte seinen roten Kamm schüttelnd über den See hin.“[16] Der Bruch zwischen den Örtlichkeiten – Kamin/See – wie auch zwischen den Zeiten (Gegenwart/Erinnerung) wird im Text nicht explizit markiert! Der Erzähler adaptiert und integriert vielmehr das aus einer anderen Erzählung stammende Motiv des Hahnes/Stechlins in die seinige. Die Wirklichkeit der Sage wird (ringkompositorisch) rekapituliert und akzeptiert als alternative Erklärung; man könnte auch einfach sagen, ein Unwetter ziehe auf.

Einband der ersten Buchausgabe (Wikipedia: Foto H.- P. Haack)
Unbestimmtheit
Der Autor der Wanderungen schafft einen Erzähler, der zwar die einzelnen Episoden arrangiert, aber hinter diesen fast verschwindet. Dabei entsteht ein gewisser Grad von Authentizität und Lebendigkeit, aber keine Verlässlichkeit. Das Ganze rutscht ab in seine seltsame Gemengelage aus Geschichten, Traum und Wirklichkeit. Wie der geographische Stechlin die Welt verbindet – und auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, so verbindet er den Aufbau dieser Erzählung und transformiert, transzendiert sich und sie in Richtung Bedeutungslandschaft (gewissermaßen eine Analogiebildung zum Begriff der Seelenlandschaft in Vergils BVCOLICA).
Bestimmte Motive werden im Erzählduktus immer wieder aufgegriffen und variiert dargestellt; so entsteht aus den einzelnen Segmenten des Textes (Episoden, Geschichten, Impressionen …) und den einzelnen, heterogenen Erzählstimmen (impliziter Autor, Erzähler, Dialektsprecher, kurz: Polyphonie) eine Meta-Textur , welche die verschiedenen Motive aus dem lokalen Zuschnitt heraus öffnet und ihnen exemplarischen Charakter zuweist. „Aber Fontane ist ein Meister der feinen Andeutung. Es gelingt ihm, in jeder Konversation das Verdrängte aufzustören, so daß es als Drohung allgegenwärtig ist.“[17] Irgendwie ist auch hier das Sexuelle präsent in jener seltsamen (ironisch gefärbten) (Liebes)Geschichte über Metas Ruh (die irgendwie doch keine Ruhe findet), präsent die ökologischen Zerstörungen im Zuge der Industrialisierung, präsent Krieg.
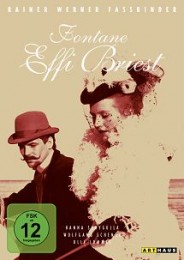 Die Toten und Ermordeten haben ihre Geheimnisse: die Schuldfrage bleibt ungeklärt, unbestimmt. Und der See schweigt. Und alles Reden ist der Versuch, dem Unsagbaren Sage, Deutung, Verstehbarkeit zu geben. Und nur für einen Moment stellt sich so etwas wie eine Geste der Versöhnung ein: „Mitternacht war heran, die Scheite verglimmten und nur ein Flackerschein spielte noch um die Bilder. Es war als lächelten sie.“[18] Mitternacht, seit dem Mittelalter ein Symbol der Nicht-Zeit, der Wendepunkt zwischen zwei Tagen. (meta kann man auch lateinisch lesen und bedeutet u.a. die Wendesäule im Stadion.) Das Licht verschwindet. Das Zeitalter der Aufklärung geht zu Ende. Die Bilder der Ahnen scheinen zu lächeln, wieder eine Projektion, wieder Unbestimmtheit. Die Reisegesellschaft ist im Totenreich angekommen, aber es ist kein Gespräch mehr mit den Vätern und Müttern möglich, so wie es noch Odysseus oder Aeneas führen konnten. Selbst die Gespenster sind nur noch gespensterhaft.
Die Toten und Ermordeten haben ihre Geheimnisse: die Schuldfrage bleibt ungeklärt, unbestimmt. Und der See schweigt. Und alles Reden ist der Versuch, dem Unsagbaren Sage, Deutung, Verstehbarkeit zu geben. Und nur für einen Moment stellt sich so etwas wie eine Geste der Versöhnung ein: „Mitternacht war heran, die Scheite verglimmten und nur ein Flackerschein spielte noch um die Bilder. Es war als lächelten sie.“[18] Mitternacht, seit dem Mittelalter ein Symbol der Nicht-Zeit, der Wendepunkt zwischen zwei Tagen. (meta kann man auch lateinisch lesen und bedeutet u.a. die Wendesäule im Stadion.) Das Licht verschwindet. Das Zeitalter der Aufklärung geht zu Ende. Die Bilder der Ahnen scheinen zu lächeln, wieder eine Projektion, wieder Unbestimmtheit. Die Reisegesellschaft ist im Totenreich angekommen, aber es ist kein Gespräch mehr mit den Vätern und Müttern möglich, so wie es noch Odysseus oder Aeneas führen konnten. Selbst die Gespenster sind nur noch gespensterhaft.
Zwar mit Bezug auf einen anderen Ort der Wanderungen formuliert, kann hier auch folgende Beobachtung gelten: „An solchen wenigen Stellen kommt in den Wanderungen eine Resignation und eine Melancholie zum Vorschein, die weitaus mehr beinhaltet als die Klage um die verlorene Einheit der preußischen Welt. Die Geschichte selbst scheint hier zu einer Bürde zu werden, der sich der Wanderer zuweilen auch zu entledigen sucht; die Reise durch den Raum bringt angesichts der stets zerstörerischen und stets zerstörten Geschichte zugleich die Sehnsucht hervor, die Zeit einmal stillstehen zu lassen, sich der Natur anheimzugeben oder sich gänzlich im unbeweglichen ‚musée imaginaire‘ einzurichten.“[19] Um Mitternacht, vor dem Kamin, in der Erinnerung, bei den Ahnen.
Fontanes Analysekategorie: Determiniertheit
„Die berühmte – bzw. berüchtigte – Halbheit von Fontanes fiktiver Welt ist mit jenem erzählerischen und menschlichen Wissen um die Determiniertheit seiner Gestalten identisch, das seine Romane durchzieht. Fontane hat den Mut einzusehen, daß keine seiner Figuren über ein Bewußtsein verfügt, das von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen unberührt bleibt. [… S]eine Halbheit hat mit Furchtsamkeit nichts zu tun. Sie ist vielmehr die Signatur einer – wenn ich recht sehe – unüberbotenen Abrechnung mit der menschlichen Determiniertheit, einer Determiniertheit, die bis in die privatesten Bereiche menschlicher Subjektivität verfolgt wird.“[20]
Rainer Werner Fassbinders herausragende Effi Briest-Verfilmung setzt diese Abrechnung Fontanes beeindruckend um: In einer zentralen Szene beispielsweise diskutiert Baron Geert von Instetten, man könnte meinen: durchaus privat, mit Wüllersdorf, (der hübsch dekorativ eine Beethoven-Sonate am Klavier spielt), um das Für und Wider eines Duells mit Major Crampas abzuwägen; während das Gespräch weitergeführt wird, sieht man jedoch einen fahrenden Zug eingeblendet: die Entscheidung ist schon längst gefallen!, denn es gibt im Grunde keine gesellschaftliche Wahlfreiheit für Instetten; selbst das Private ist gesellschaftlich prädestiniert; und im weiteren Verlauf des Gesprächs bewegt sich die Kamera von den Sprechenden fort, auf einen Spiegel zu, der von zwei anderen Spiegeln umrahmt wird; die Zuschauer sehen jetzt nur noch gebrochen gespiegelte Instettens und Wüllersdorfs, wie sie weiterreden …
Auch in dem vermeintlich unschuldigen oder besser sich noch jenseits von Gut und Böse befindenden Bereich von Natur und Kindheit spielen Kinder am Stechlin Krieg. Das menschliche Wesen wird schon auf seiner kindlichen Ebene des Spielens von gesellschaftlichen Erwartungen durchzogen, ohne dessen bewusst zu sein. Und diese Halbheit des Spiels setzt sich tragisch fort auf der Ebene der Nationalstaaten. Man denke nur an Bismarcks Politik gegen Dänemark oder Frankreich. Und auch die Natur kann nicht mehr (romantisch) unschuldig oder (romantisch) echt sein: Die Menzer Forst ist gewissermaßen nur noch ein Abbild, das Urbild war ja den Berliner Schornsteinen zum Opfer gefallen. Auch hier sind die Gesellschaft und ihre Bedürfnisse omnipräsent.
Epilog
Als ich nach Jahren Fontanes Stechlin wieder hörte, bin ich zunächst auf des Erzählers ästhetisch meisterhaften Plauderton … hereingefallen. Gert Westpahls wunderbar wohltönende Stimme tat da ihr übriges. Im Nachhinein stellte sich bei mir doch so etwas wie Unbehagen ein, da lauerte etwas hinter dem Gehörten: „Landschaft und Natur haben […] bloßen Zeichen- und Verweisungscharakter, um einen stets neu variierten Weg von der Gegenwart zur Geschichte zu bahnen.“[21]
Markus Pohlmeyer
Markus Pohlmeyer lehrt an der Universität Flensburg (Schwerpunkte: Religionsphilosophie; Theologie und Science Fiction).
[1] Th. Fontane: Der Stechlin, Auszüge aus Band 1 der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, ausgewählt u. gelesen v. G. Westphal, LITRATON Hamburg 1993.
[2] N. Mecklenburg: Theodor Fontane. Romankunst der Vielstimmigkeit, Frankfurt am Main 1998, 131.
[3] Mecklenburg, Fontane (s. Anm. 2), 133.
[4] Th. Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Erster Band, in: Ders.: Werke, Schriften und Briefe, hg. v. W. Keitel u. H. Nürnberger, 3. Aufl., Darmstadt 2002, 339.
[5] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 340.
[6] Siehe dazu Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 340.
[7] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 340.
[8] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 341.
[9] Th. Nipperdey: Deutsche Geschichte. 1866-1918, Bd. I, Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1998, 766.
[10] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 342.
[11] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 340.
[12] Mecklenburg, Fontane (s. Anm. 2), 132.
[13] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 343.
[14] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 344.
[15] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 344.
[16] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 344.
[17] H. Kurzke: Die kürzeste Gesichte der deutschen Literatur und andere Essays, München 2010, 52.
[18] Fontane, Wanderungen (s. Anm. 4), 344.
[19] Fontane-Handbuch, hg. v. Ch. Grave u. H. Nürnberger, Stuttgart 2000, 846.
[20] M. Swales: Epochenbuch Realismus. Romane und Erzählungen, Berlin 1997, 156 f.
[21] Fontane-Handbuch (s. Anm. 19), 828.