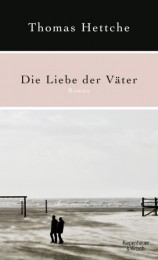 Auf der Suche nach dem großen Thema
Auf der Suche nach dem großen Thema
– Die deutschen ledigen Väter waren begeistert: Endlich schrieb mal jemand über ihre Gefühle! Und darüber, wie schwer sie’s haben, so als entrechtete Väter eben. Aber geht’s im Roman wirklich darum? Von Henrike Heiland.
Bei diesem Buch stand gleich mit seinem Erscheinen mehr das Thema Sorgerecht im Vordergrund als der Text selbst, von der Gesetzesänderung zugunsten lediger Väter, die fast zur gleichen Zeit stattfand, mal ganz abgesehen. Endlich, freute sich so mancher, endlich mal die Perspektive eines hilflosen Vaters, der nichts tun kann gegen die ihm das Kind entziehende Mutter. Endlich mal nicht die arme, verlassene, alleinerziehende Mutter, die sich durchschlagen muss und dabei zerrissen wird zwischen eigenen Bedürfnissen, die sie nicht haben darf, und der Fürsorgepflicht, der sie nur schlecht nachkommen kann, weil ihr Geld und Zeit und Kraft fehlen.
Es ist dieses generalisierte Bild der alleinerziehenden Mutter, das dem Ich-Erzähler Peter in „Die Liebe der Väter“ so auf die Nerven geht. Seine Ex, mit der er das Kind hat, zeichnet er als unzuverlässiges, egoistisches Weibsbild nahe an der Hexe, das das Kind nicht nur mit Drogen in Kontakt bringt, sondern auch noch sexuell übergriffigen Liebhabern aussetzt und jetzt – man könnte meinen, dies erst sei der Gipfel der Unverschämtheiten – soll die dreizehnjährige Tochter auch noch auf eine freie Schule gehen statt aufs staatliche Gymnasium. Natürlich, so erklärt Peter in einem ausführlichen Monolog den Lesern wie auch seinen Freunden, mit denen er die Zeit zwischen den Jahren auf Sylt verbringt, natürlich habe er alles getan, was er konnte. Mit Anwälten und Psychologen gesprochen, zum Beispiel, aber da sei nun mal nichts zu machen. Die Mutter entziehe ihm absichtlich die Tochter, und das arme Mädchen, Annika mit Namen, denke nun, der Vater sei nicht zur Stelle, wenn sie ihn braucht.
Die Tochter als einzig Erwachsene Figur
Der geschilderte Fall, also Peters Leben, bekommt durch den Titel des Buchs, das gleich alle Väter dieser Welt miteinbezieht, eine Allgemeingültigkeit, die er nicht haben kann: Es gibt schlechte Mütter und schlechte Väter, miteinander verheiratet oder nicht, das Sorgerecht teilend oder nicht. Peters Fall bleibt Einzelfall, weil trotz aller Philosophie und Weltanschauung, die noch gleich mitverpackt werden, die Mutter im Grunde zu krass gezeichnet ist und der Vater zu einem Jammerlappen verkommt, der vielleicht wirklich mit vermeintlich qualifizierten Dritten über seine Situation gesprochen haben mag, aber das war wirklich schon alles? Hat er je ernsthaft etwas unternommen? Gegen alle Widerstände gekämpft? Sich einen Job gesucht, der ihn vor Ort sein lässt, statt ständig als Buchhandelsvertreter unterwegs auf der Autobahn und in Hotels irgendwo in Deutschland zu sein? Da fragt man sich doch, ob er seine Tochter so viel häufiger zu Gesicht bekommen hätte, wäre er mit ihrer Mutter noch zusammen.
Weniger ist es die Liebe der Väter, die erzählt wird, als die Unfähigkeit zweier ehemaliger Partner, dem gemeinsamen Kind zuliebe ihr Verhältnis zu klären. Der gezeigte Vater-Tochter-Konflikt basiert denn somit auch mehr auf pubertätsbedingten Problemen, und die Tochter ist letztlich die stärkste, sympathischste, am wenigsten verkorkste Figur von allen, vielleicht sogar die einzig wirklich Erwachsene in dem Dreieck. Sie entzieht sich dem Vater, als der sie mit einer Ohrfeige für Dinge bestraft, die ihm eigentlich seine Ex antut, und sie versöhnt sich am Ende mit ihm (und dadurch versöhnt sich auch seltsamerweise die Geschichte mit dem Leser) mit einer lässigen Beiläufigkeit, von der sich ihre Eltern eine Scheibe abschneiden könnten.
Intellektualisierung sämtlicher Alltäglichkeiten
Die viel zitierte Andersartigkeit der Liebe der Väter zu ihren Kindern im Vergleich zur Mutterliebe scheint weithin aus der Unfähigkeit zu bestehen, sich Gefühle einzugestehen und sie zu zeigen, und das ist nicht das Problem der entrechteten Väter allein. In Peters Fall kommt noch eine andauernde Intellektualisierung sämtlicher Alltäglichkeiten hinzu, die Leichtigkeit und Wärme zwischen ihm und seiner Tochter gar nicht zulassen kann. Die anwesenden Freunde mischen sich mit ihren Lebensansichten des gehobenen Bürgertums ein bisschen ein, ohne wirklichen Einfluss auf das Geschehen zu haben. Am Ende bleibt große Unklarheit, was nun das behauptete große Thema angeht, und die eigentliche Geschichte ist wieder aus dem Fokus geraten.
Was ist die Geschichte? Ein Vater, der mit der Tochter fremdelt, weil er mit der Mutter nicht kann und dazu noch ein schlechtes Gewissen hat – wollte er doch dieses Kind einst gar nicht haben –, verbringt die Feiertage mit dem Kind und alten Freunden auf Sylt. Es kommt zu einer Ohrfeige, Vater schlägt Tochter in aller Öffentlichkeit. Die Ohrfeige verändert alles. Vor allem aber, und das ist das Interessante, reinigt sie die Luft und bringt Vater und Tochter einander näher. Nein, kein Plädoyer für die Ohrfeige, das sicher nicht, aber so runtergebrochen auf das Eigentliche, wird die Geschichte wieder viel interessanter. Die Grenzen zwischen gutem Elternteil und bösem Elternteil sind ungefähr so beständig wie der Wellengang der Nordsee bei Sturm. Zwar ist der Roman immer wieder aufgeladen mit Sylt und Wetter und Regionalgeschichte, etwas norddeutschem Sagen- und Brauchtum, einem Klecks Wirtschaftskrise, vielleicht um die Heutigkeit zu unterstreichen, all das ist nur Staffage, will meinen literarisch hingebauter Spiegel der Seelenlage des Protagonisten, was aber in Ordnung ist.
Die Figuren in ihrer Selbstgerechtigkeit zu sehen, ihrer weltfremden Pseudoverankerung in der gehobenen Mittelschicht, das macht den Reiz der Geschichte aus. Die Verlogenheit der vermeintlich Besserwissenden weil Bessermeinenden, die Hilflosigkeit, die sie umgibt, das alles ist schön eingefangen und wird durch Hettches artifizielle Sprache in kühle Distanz gerückt.
Henrike Heiland
Thomas Hettche: Die Liebe der Väter. Roman. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2010. 223 Seiten. 16,95 Euro. Foto: © Herlinde Koelbl
Zur Homepage von Thomas Hettche, Thomas Hettche liest aus „Die Liebe der Väter“.












