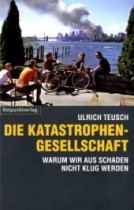 Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe
Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe
Neun Tage – länger dauert keine Katastrophe. Jedenfalls in den Medien. Neun Tage, so versichern uns Medienforscher, könne man die Nachrichten von einem Skandal oder einer Katastrophe in der Öffentlichkeit am Kochen halten. Nach diesem Zeitlimit würde die allgemeine Aufmerksamkeit für einen dramatischen Katastrophenfall spürbar nachlassen. Neun Tage Betroffenheit und Aufklärung in allen Ehren, aber dann: „The show must go on“. Von Carl Wilhelm Macke
Nach der Maßeinheit von ‚Neun Tagen’ organisieren inzwischen Parteistrategen ihre Kampagnen. Hat man es in dieser Zeit nicht geschafft, einen politischen Konflikt, einen gesellschaftlichen Missstand oder eine Katastrophe zu skandalisieren, wird es eng. Und auch die großen Hilfswerke müssen ihre Spendenaktionen innerhalb dieser Frist für die durch eine Naturkatastrophe geschaffenen Notfälle ‚auf Touren bringen’.
Sogar nach dem 11. September 2001 und der Tsunami-Katastrophe Ende 2004 rückten langsam wieder ‚weichere, unterhaltsamere Themen in den Brennpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Zynismus, schwarzer Humor, moralische Verkommenheit? Machen wir uns doch nichts vor, so kann man eine zentrale These von Ulrich Teusch zusammenfassen, wir leben nun mal in Zeiten permanenter Nachrichten von Katastrophen und irgendwie müssen wir uns damit auch arrangieren. Könnte es nicht sogar sein, fragt sich Teusch selber, ob wir die vielen Nachrichten über Katastrophen rund um den Erdball sogar gebrauchen, um ein Ventil für unsere Empörungswut oder unser frei herumvagabundierendes Mitleid zu haben.
Aber wer will sich diese Instrumentalisierung fremden Leids schon zugestehen. Susan Sontag hat über unsere Ambivalenz in der Konfrontation mit dem Leiden Anderer einen wichtigen Essay geschrieben, an den Teusch in einem Kapitel über die „Lust an der Katastrophe“ erinnert. Schadenfreude, Angstlust, Katastrophentourismus. Wer sich wie Teusch systematisch die öffentlichen Wahrnehmung von Katastrophen und ‚größten anzunehmenden Unfällen’ seziert, gerät immer an eine Grenze, jenseits derer ihm empfindliche Leser nicht mehr folgen können oder wollen.
„Die Katastrophengesellschaft ist ein guter Nährboden für Schwarzmaler oder Schoenredner.“ Teusch gehört weder zu den Einen noch zu den Anderen und deshalb können auch beide von ihm lernen. Katastrophen, so verheerend sie auch immer gewesen sind, haben auch dazu beigetragen, den Blick auf ‚Lücken im System’ oder auf technische Unvollkommenheiten zu schärfen. Allerdings kann die Sensibilität für die Nicht-Beherrschbarkeit einer Technik durch eine Katastrophen auch gestärkt werden, wie etwa das Beispiel der großen und kleineren Unfälle in Atomreaktoren zeigen. Jede Katastrophe, so viele Opfer sie auch kostet, findet immer auch ihre Profiteure. Nach Tschernobyl erlebte die Industrie für Lebensmittelkonserven einen Jahrhundert-Boom. Und jede Tankerkatastrophe an der Atlantikküste, steigert die Gästezahl am Mittelmeer.
Wie viele Katastrophen fallen aber nach neuntägigen Aufmerksamkeit aus der öffentlichen Wahrnehmung heraus und niemand interessiert sich dann mehr für die Opfer und die gesundheitlichen Konsequenzen der ihnen folgenden Generationen. „Kriege, Genozide, Massaker – es gibt viele opferreiche Ereignisse, die keinen Eingang in die Katastrophengeschichte gefunden haben“. Aber sind Kriege und Genozide Katastrophen?
Ist die aus ideologischen oder rassistischen Gründen erfolgte planmäßige Vernichtung einer anderen Bevölkerungsgruppe oder Ethnie eine mit einem Schiffsuntergang vergleichbare ‚Katastrophe’? Handelt es sich bei Überschwemmungen in jedem Fall um ‚Naturkatastrophen’ oder muß man nicht fast immer eine nüchterne Analyse über die sozialen oder ökonomischen Hintergründe von Landschaftszerstörungen machen, die diese Katastrophen erst verursacht haben?
Der Katastrophenessay von Ulrich Teusch ist stark in seinen Fragen, aber bei den präsentierten Antworten findet man auch schon mal Banalitäten. „Das Verhältnis zwischen Technik, Gesellschaft und Natur ist spannungsreich und widersprüchlich – und es ist über alle Maßen katastrophenträchtig.“ Oder wo er „moderne Gesellschaften als hochgradig arbeitsteilig“ beschreibt, in der „diverse Spezialkenntnisse ineinandergreifen muessen.“ Das alles wußte man auch schon vor der Lektüre dieses Buches.
Vielleicht ist eine stringente Beweisführung auch nicht Sinn dieses in den Grenzgebieten zwischen Politik, Soziologie, Technikgeschichte, Psychologie und Kulturwissenschaft an Antworten herantastenden Essays. Die nächste Katastrophe kommt bestimmt. Unsere Möglichkeiten, sie zu verhindern, sind beschränkt. Aber wir können lernen, damit besser umzugehen. Damit nach neuen Tagen vielleicht doch nicht wieder alles vorbei ist.
Carl Wilhelm Macke
Ulrich Teusch: Die Katastrophengesellschaft. Warum wir aus Schaden nicht klug werden. Rotpunktverlag Zürich, 2008, 229 S.











