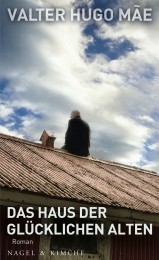 Geschichten aus dem Altersheim
Geschichten aus dem Altersheim
– Was es bedeutet, nach knapp 50 Jahren glücklicher Ehe im Alter von 84 Jahren seine Frau zu verlieren und kurz danach ins Altersheim verfrachtet zu werden, kann man sich kaum vorstellen. Es gibt keine Perspektive mehr, alles Vertraute ist verloren, die Menschen, Gegenstände, Orte. Da ist kein Grund zur Hoffnung, Hoffnung auf eine Verbesserung der körperlichen Gebrechen, auf eine neue Liebe oder zumindest so etwas wie Freundschaft mit all diesen fremden Menschen. Wenn man darüber hinaus an nichts glaubt, wie der Ich-Erzähler von „Das Haus der glücklichen Alten“, an keinen Gott und keine Metaphysik im weitesten Sinne, dann ist die Verzweiflung so vollständig, dass der Freitod zur Option wird. Von Doris Wieser
Von dieser Konstellation geht Valter Hugo Mãe (*1971 in Angola) aus. Das Thema Alter könnte aktueller nicht sein. Wie geläufig ist es uns doch als administratives und finanzielles Problem. Und wie fremd sind uns Berufstätigen oft die innersten, bittersten Nöte dieser kranken, schwerfälligen, an zunehmender Demenz leidenden Menschen, die wir nicht als unseresgleichen behandeln, sondern als eine Art unselbständige Kinder.
Bei einem im Altersheim spielenden Roman drängt es sich geradezu auf, mit Rückblenden auf das Leben der Bewohner zu arbeiten und, wenn sich das Heim in Portugal befindet, diese mit der Salazar-Diktatur in Verbindung zu setzen. Genau das macht auch Valter Hugo Mãe, womit er ein zweites gesellschaftlich relevantes Thema verarbeitet. Die Bewältigung einer immer noch relativ jungen, traumatischen Vergangenheit. Anders als Pascal Merciers Roman „Nachtzug nach Lissabon“, dessen Verfilmung von Bille Auguste gerade in den Kinos läuft, handelt „Das Haus der glücklichen Alten“ nicht vom heldenhaften Widerstand junger Leute, die bereit sind, für ihre Freiheit zu kämpfen, und dabei alle möglichen Risiken eingehen.
Senhor Silva ist ein Portugiese anderer Sorte. Er ist wie die meisten Menschen ein ganz normaler Mann, der nicht zum Helden geboren wurde und auch nicht den Drang verspürt, aktiv etwas zu verändern. Er richtet sich mit der Situation ein, beugt sich, fügt sich, verbiegt sich bis zu einem gewissen Grad, und dies immer unter dem Vorwand, seine Familie zu schützen. Tatsächlich aber mangelt es ihm an Mut. Seine Geschichte hat bei aller Durchschnittlichkeit trotzdem etwas Tragisches: Er gewährt 1967 einem jungen Widerstandskämpfer Zuflucht in seinem Frisörladen und schafft es, vor den Agenten der PIDE dicht zu halten. In den folgenden Jahren freundet er sich mit dem jungen Mann an, verpfeift ihn jedoch schließlich mit einer allzu großen Leichtigkeit und nur geringem Bedauern, weswegen der Junge vom Regime unter ungeklärten Umständen ermordet wird. So hat Senhor Silva mit dieser Schuld zu leben und zu sterben.
Dieses Ereignis ist der Teil an Vergangenheitsbewältigung, den António Silva persönlich leisten muss. Leider kommen für mein Empfinden die sich daran anschließenden moralischen und „metaphysischen“ Fragestellungen etwas zu kurz, da der Erzähler ein deutlich größeres Gewicht auf die manchmal etwas dröge Darstellung des Alltags im Altersheim legt, die aber immerhin einer gewissen Situationskomik nicht entbehrt. Trotzdem fehlt auch der Geschichte um Dona Marta, eine Frau, die wie Senhor Silva an einem gebrochenen Herzen leidet, in letzter Konsequenz eine tief greifende Auslotung ihrer Bedeutung. In der Begegnung zwischen den beiden Senioren fließen Unbeholfenheit und Bosheit ineinander. Angebotene und tatsächlich geleistete Hilfe gehen Hand in Hand mit dem mutwilligen Erzeugen von Seelenqualen, weswegen sich der Protagonist am Ende nicht sicher sein kann, ob er Schuld an Martas Tod trägt.
Metaphysik
Die etwas zu kurz gekommene Reichweite solcher Episoden und das zum Teil fehlende Herzblut in der Darstellung wird jedoch durch eine ziemlich geniale Idee kompensiert: Valter Hugo Mãe spielt mit der literarischen Tradition und damit auch der nationalen Identität Portugals, indem er eine Figur einführt, die behauptet, den großen Dichter Fernando Pessoa nicht nur gekannt, sondern diesen sogar zu einem ganz bestimmten Gedicht inspiriert zu haben. Er sei nämlich der „unmetaphysische Esteves“ aus dem Gedicht „Tabakladen“ (Tabacaria) von Pessoas Heteronym Álvaro de Campos, dessen Thema das Leiden aufgrund unverwirklichter Träume ist. Als junger Mann habe er regelmäßig im Tabakladen von Herrn Alves eingekauft und sei dort immer wieder Pessoa begegnet, habe ihn gegrüßt, aber nie ein Gespräch mit ihm geführt. Später habe er vom Ladenbesitzer erfahren, dass er Pessoa zu einem seiner schönsten Gedichte überhaupt inspiriert habe.
Die Begegnung mit Esteves ist eines jener Ereignisse, die dem Leben des Protagonisten allmählich einen neuen Sinn verleihen oder zumindest eine neue Qualität. Nach der quasi lebenslangen Ehe mit Laura entwickelt António Silva in den letzten Jahren vor dem Tod eine nie gekannte Nähe zu anderen Menschen, eine beseelende Vertrautheit, die Trost und einige glückliche Momente spendet. Doch die Auseinandersetzung mit dem Tod ist omnipräsent, sei es durch das Ableben von anderen Heimbewohnern, den Blick auf den Friedhof durch die Fenster der „letzten Station“ oder einfach die Gespräche mit den „Freunden“ über den „unmetaphysischen Esteves“, den Álvaro de Campos für sein einfaches Gemüt beneidete, der tatsächlich aber gar nicht so „unmetaphysisch“ ist.
Eine Maschine, die Spanier produziert
Der Originaltitel des Romans „Maschine zur Herstellung von Spaniern“ ist erklärungsbedürftig. Mit diesem Bild wird auf die momentane wirtschaftliche Situation Portugals sowie seine Schwierigkeit, sich mit Europa zu identifizieren, angespielt. Im Krisenland, das seit dem 12. Jahrhundert ein Nationalstaat ist (mit einer vergleichsweise kurzen Unterbrechung von 1580 bis 1640), rühren sich Stimmen, die ironisch den Zusammenschluss mit Spanien fordern, denn dann gäbe es zumindest ein klitzekleines bisschen mehr Arbeit. Überhaupt ist die jahrhundertealte Identitätskrise Portugals eines der Hauptthemen des Romans. Senhor Silva hadert mit der religiösen und faschistischen Indoktrination, der er während der Diktatur ausgesetzt war, und dem verpflichtenden Nationalstolz, den er im Rückblick angesichts der vorherrschenden Armut und der kulturellen Orientierung auf Frankreich und Spanien als reinsten Hohn empfindet. Die unleidliche Ehe des Estado Novo mit der Katholischen Kirche brachte den jungen Silva zudem um seinen Glauben, um jeglichen Zugang zur Metaphysik, was ihm kurz vor seinem Tod ein Gefühl schmerzhafter Trostlosigkeit beschert.
Das hat sich Valter Hugo Mãe alles wunderbar ausgedacht. Trotzdem hat das Buch seine Schwächen, die vor allem etwas mit Stringenz, Relevanz und gedanklicher Tiefe zu tun haben. Was den letzten Punkt betrifft, so ist es natürlich auch nicht einfach, die portugiesische Vergangenheit besser oder zumindest ebenso erfolgreich und ergreifend zu bearbeiten wie Antonio Tabucchi in „Erklärt Pereira“ oder der schon erwähnte Pascal Mercier. Trotzdem hat es mich nicht wirklich erstaunt, Anfang April in Lissabon in den Buchhandlungen auf die 13. Auflage des Romans zu stoßen (die portugiesischen Auflagen sind allerdings winzig) und eine ganze Reihe weiterer Romane des Autors in praktisch jeder Buchhandlung anzutreffen. Denn:
Er trifft den Zahn der Zeit und glänzt durch Einfallsreichtum und eine ganze Reihe von verführerisch formulierten Denkansätzen.
Doris Wieser
Valter Hugo Mãe: Das Haus der glücklichen Alten (Máquina de fazer espanhóis, 2010). Aus dem Portugiesischen von Ulrich Kunzmann und Klaus Laabs. München: Nagel & Kimche Verlag 2013. 302 Seiten. 22,90 Euro.











