Ein Aspekt von Literaturkritik ist die Wertung von Büchern – die stößt auf verschiedenen Interessenlagen. Es kommt zu Reibereien. Zoë Beck ist im Flur Dr. Müller-Böhne begegnet und schon entzündet sich die Diskussion:
 Wem was glauben, oder: Welche Rezension ist die richtige?
Wem was glauben, oder: Welche Rezension ist die richtige?
Mein Nachbar, Herr Dr. Müller-Böhne, ist als Richter nicht nur beruflich an Verbrechen interessiert. Er hat auch eine Schwäche für literarische Todesfälle, und so fragt er mich, gerne auf offener Straße und vorzugsweise so, dass es noch zwanzig andere Leute hören, Dinge wie: „Na, wie viele Kerle haben Sie denn heute schon auf dem Gewissen?“ oder „Heute schon gemordet?“ Im Interesse einer friedlichen Nachbarschaft nicke ich dann immer freundlich und sehe zu, dass ich schnell weiterkomme. Nicht so leicht ist es, wenn wir uns im Treppenhaus begegnen, ich den Schlüssel in der Hand, er wie zufällig vor meiner Wohnungstür. Er hat dann immer was auf dem Herzen, was er fachkundig klären will. So auch diesmal, er braucht „Expertenrat“, wie er es nennt. Noch vor mir schultert er sich in die Wohnung, nimmt in der Küche Platz und lässt sich einen Tee machen.
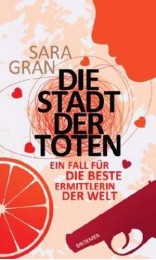 Was ihm auf der Seele brennt: Er hat sich auf meinen Rat hin „Die Stadt der Toten“ von Sara Gran gekauft, ebenfalls auf meinen Rat hin in der Buchhandlung ums Eck. Dann hat er, bevor er mit dem Lesen angefangen hat, auf Amazon herumermittelt, um festzustellen, dass die Meinungen meilenweit auseinandergehen. Dass Meinungen weit auseinandergehen können, erlebt er nun tagtäglich vor Gericht. Was ihn aber umtreibt, ist der Frontenkrieg, den er herausgelesen zu haben glaubt: sogenannte Leitmedien vs. Amazon-Kunden. Ob ich ihm das bitte mal erklären könne, und welche Seite da nun die richtige sei.
Was ihm auf der Seele brennt: Er hat sich auf meinen Rat hin „Die Stadt der Toten“ von Sara Gran gekauft, ebenfalls auf meinen Rat hin in der Buchhandlung ums Eck. Dann hat er, bevor er mit dem Lesen angefangen hat, auf Amazon herumermittelt, um festzustellen, dass die Meinungen meilenweit auseinandergehen. Dass Meinungen weit auseinandergehen können, erlebt er nun tagtäglich vor Gericht. Was ihn aber umtreibt, ist der Frontenkrieg, den er herausgelesen zu haben glaubt: sogenannte Leitmedien vs. Amazon-Kunden. Ob ich ihm das bitte mal erklären könne, und welche Seite da nun die richtige sei.
„Worauf soll ich mich denn verlassen? Auf die echten Kritiker? Oder auf die Leute, die auch gern lesen?“, fragt er. Und macht damit denselben Fehler wie alle in dieser Diskussion. Warum dieses ewige Gegeneinander? Es ist doch so:
Kritiker
Kritiker, ganz egal, wie sie zu dieser Bezeichnung gekommen sind, sind auch nur Leser. Menschen mit Vorlieben und Abneigungen. Kritiker A findet was super, Kritiker B schmeißt es weg, vielleicht liegt es sogar daran, dass Kritiker B Kritiker A nicht leiden kann. So gesehen haben wir sowohl bei einem Kritiker, der für ein Leitmedium schreibt, wie auch bei dem Amazon-Kunden, der dort seine Meinung veröffentlicht, erst mal Menschen, die Bücher lesen.
Eine äußere Unterscheidung mag sein, dass die einen Geld für ihre Meinung bekommen, die anderen nicht. Bei allem anderen hört es aber auch schon wieder auf, da sind die Grenzen fließend. Ein Amazon-Kunde hat nicht zwingend eine andere (akademische) Bildung als ein Kritiker. Ein Kritiker liest nicht einmal unbedingt mehr Bücher als ein Amazon-Kunde, und auch die fachliche Spezialisierung würde ich vielen Amazon-Kunden nicht ohne weiteres absprechen. Kein Wunder also, dass sich viele Verfasser von Amazon-Rezensionen sagen wir mal unwohl damit fühlen, wenn der Kritiker einer Zeitung oder eines Rundfunksenders eine gewichtigere Meinung haben soll, nur weil das Etikett „Kritiker“ dranhängt. Manchmal kritisieren große Kritiker Bücher aus Bereichen, für die sie nicht dringend Experten sind. Zum Beispiel. Manchmal hat man auch bei Kritikern den Eindruck, sie hätten ein Buch nicht zu Ende gelesen oder sich einfach nur über den Autor geärgert, weil der ihnen mal auf einer Buchmessenparty den Rotwein aufs Hemd gekippt oder den Partner ausgespannt hat, oder oder oder. Klar, dass sich viele dann fragen: „Wieso sollen die da oben recht haben mit ihrer Meinung und wir nicht?“

Oben – unten
„Die da oben“? Dadurch wird eine Hierarchie behauptet, die in Zeiten von Netzdemokratie niedergerissen werden muss: Die Schwarmintelligenz hat recht. Die Basis bestimmt. Wenn genug Leute ein Buch bewerten, dann entscheidet die Mehrheit. Die da oben haben gar nichts zu diktieren. Erst recht nicht, was man zu mögen hat.
Die da oben sagen dann: Was, Schwarmintelligenz? Schmarrnintelligenz! Die erkennen doch kein gutes Buch, wenn es ihnen in den Kaffee pinkelt, die haben doch alle gar keine Ahnung.
Prima, vielen Dank, auf dieser Basis kann man großartig diskutieren.
Ich will es mal anders versuchen.
An der Uni (aus der Reihe: „Tante Beck erzählt von früher“) hielt ich mal ein Referat zum Thema Sinn und Unsinn von Literaturkritik. Schon damals – und da spielte Amazon nun wirklich noch keine Rolle, die Plattform war in den USA gerade mal gegründet worden – schon damals also kam die Frage auf: Warum soll ich mir von so komischen Leuten im Fernsehen oder in der Zeitung sagen lassen, was ich zu lesen habe, die empfehlen eh nur langweiligen Schrott. Und die Gegenargumente, die ich bis heute noch stimmig finde: Wenn man oft genug Kritiken liest, kann man unabhängig vom Fazit herausfinden, ob das Buch etwas für einen ist oder nicht. Man lernt, zwischen den Zeilen zu lesen, und man weiß, mit welchem Kritiker man auf einer Wellenlänge ist, oder eben auch nicht, und sich so orientieren.
Letztlich ist es eine konsequente Weiterführung dieses Gedankens, wenn man heute bestimmten Bloggern und deren Empfehlungen folgt. Und im Kern ist es dasselbe, wenn man auf den Rat von langjährigen Freunden hört, deren Geschmack man bereits mehrfach mit dem eigenen abgeglichen hat. Hingegen das Verlassen auf die Schwarmintelligenz, das ist ungefähr so sinnvoll wie einen Durchschnittswert aller professionellen Kritiken zu erstellen und danach einzukaufen.
Von den fließenden Übergängen einmal abgesehen, würde ich gerne ein paar Unterschiede zwischen Kritikern bei Leitmedien und Amazon-Kunden aufzeigen. Der Anspruch ans Buch ist nämlich oft ein anderer. Während die einen vor allem eine gute Zeit haben wollen – ist es spannend, liest es sich gut, kommt man gut wieder rein, wenn man es ein paar Tage liegenlassen musste, usw. –, arbeiten die anderen eine völlig andere Liste ab: Passiert in diesem Buch stilistisch etwas Neues, wie ist das Werk zu sehen im Vergleich zu den anderen Büchern des Autors, der Epoche, des Genres, werden hier Traditionen bedient oder gebrochen, werden gesellschaftlich relevante Themen behandelt, etc. Bei allen persönlichen Vorlieben sehen sich Kritiker doch auch in der Verantwortung, das Besondere zu finden und nicht etwas durchzuwinken, das einfach gefällig ist. Und da das Gefällige oft massentauglich ist, kommt die Literaturkritik wiederum schnell in den Verdacht, elitär sein zu wollen. Hunderttausende lieben ein hypothetisches Buch, es bekommt fast ausschließlich vier und fünf Sterne auf Amazon, aber die Kritiker sind nicht begeistert? Warum? Weil sie das Buch als nicht besonders originellen Rückschritt in die Erzähltradition des 19. Jahrhunderts betrachten. Das finden sie langweilig und öde und fad. Nur so als – wie gesagt, hypothetisches – Beispiel. Etwas anderes feiern sie, weil es so noch nicht dagewesen ist, und Amazon-Kundin XY aus Z wundert sich, weil sie nicht einmal über die erste Seite rauskommt.
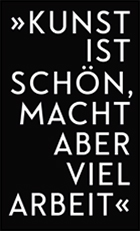 Exkurs
Exkurs
Letztens im Kunstbau in München, um einen kleinen Exkurs in die bildende Kunst zu machen, durften die Besucher wegen Neuhängung alter Bilder so etwas wie realweltliche „Gefällt mir“-Aufkleber verteilen. (Nur, dass „Ist schön“ draufstand. Und nein, die Aufkleber kamen nicht auf die Bilder, sondern auf Zettel, die unter den Bildern auf Tischen lagen.) Die Bilder mit den meisten „Gefällt mirs“ werden vermutlich im neuen Lenbachhaus besondere Plätze bekommen, so jedenfalls erklärte es eine Aufseherin. Was bekam die meisten Aufkleber? Schöne Landschaftsbilder, wie sie in Massen anzutreffen sind. Was schräg, anders, sperrig war, bekam natürlich nicht so viel Zuspruch. Das waren für die Menschen, mit denen ich im Museum war und die sich sehr intensiv mit Kunst beschäftigen, oft genug die „besseren“ Bilder, und ich rede von der Maltechnik, der Idee dahinter, der Innovation, der Ausdruckskraft. Wer sich sattgesehen hat an hübschen Landschaften des späten 19. Jahrhunderts, der erfreut sich an der Moderne. Wer es noch nicht hat, der hebt da den Daumen und sagt: Ja, das find ich schön, das beruhigt mich, das würde ich mir übers Sofa hängen.
Erkenntnisinteresse
Ein Kritiker will nichts über dem Sofa hängen haben, an dem er sich leid gesehen hat. Und will auch nichts lesen, was er schon hundertfach gelesen hat. Jemand anderes, der nicht berufsbedingt liest, will vielleicht genau das: die zuverlässige Wiederholung, die Variation des geliebten Themas. Da herrschen unterschiedliche Bedürfnisse. Deshalb die klare Schlussfolgerung: Ein Amazon-Kunde hat genauso recht und unrecht wie ein Kritiker. Wenn ich herausfinden will, wessen Urteil ich vertrauen kann, muss ich zuallererst wissen, wonach ich suche, und dem entsprechend die Beurteilungen wiederum beurteilen. Schreibt jemand über seinen Zorn und seine Abscheu beim Lesen, interessiert mich das Buch vielleicht gerade deshalb – so starke Gefühle erzeugt ein Autor? Da will ich möglicherweise mehr wissen, ein Stern bei Amazon hin oder her. Schreibt ein Kritiker über die Großartigkeit des unmittelbaren, gehetzten Stils eines Autors, klingt das für mich vielleicht anstrengend, und bei allem Jubel mag ich doch das Buch nicht so wirklich gerne lesen. Eine Bestenliste, die durch Kritikerauswahl entsteht, ist etwas anderes als eine Bestsellerliste. Ich bin es doch, die sich entscheidet, was sie lesen will. Und wie. Da gibt es kein „Der Kritiker hat recht“, ebenso wie es kein „Meine Kumpels auf Amazon haben recht“ gibt.
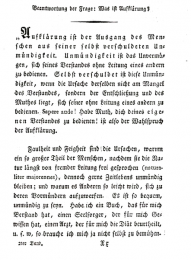 Qualität
Qualität
Es soll hier auch nicht über die Qualität der Rezensionen geurteilt werden. Natürlich kann ich weniger damit anfangen, wenn jemand schreibt: „Ich habe das Buch in einem Rutsch ausgelesen.“ Das heißt zwar erst mal, dass es offenbar spannend war, sagt mir aber nicht warum. War es die Sprache, die so fesselte? Oder überzeugten die Charaktere? Oder einfach der Plot? Auch die Formulierung „Der Schreibstil ist flüssig“ sagt mir nicht viel. Heißt „flüssig“ hier simpel oder schön? Und ob Dinge wie „Ich habe es in der Badewanne gelesen“ oder „Beim Lesen habe ich mich irgendwie gut/schlecht/mittelmäßig gefühlt“ in eine Rezension gehören – nun. Kann man mögen, oder auch nicht. Es gibt Menschen, die genau das wissen wollen. Und dann gibt es Menschen, die ganz andere Dinge erfahren wollen. Die lesen dann eben andere Kritiken. Aber wozu bitte ein Entweder-Oder-Ding daraus machen? Wozu die Kriegserklärung „Hört nicht auf das, was euch die Leitmedien weismachen wollen“? Und, was ich die ganze Zeit schon fragen wollte: Was sind denn heute noch Leitmedien? Aber das ist ein anderes Thema.
Nein, wirklich, es gehört beides zusammen. Die kritische Analyse, die Einordnung eines Werks in gewisse Kontexte, der Diskurs einerseits, und die Befindlichkeit, das spontane Mögen oder Ablehnen, die Äußerung der persönlichen Erwartungen andererseits.
Ich fürchte, am Ende hilft wieder nur: selbst lesen.
Zoë Beck











