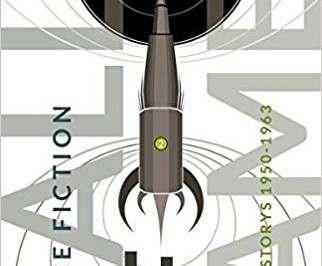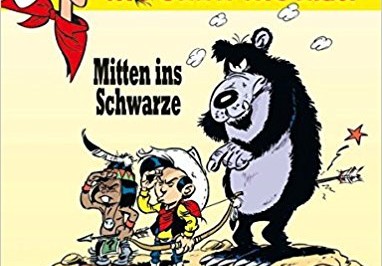Interessante Literaturzeitschriften gibt es viele und in ihnen verstecken sich so manche Perlen. „Am Erker“-Redakteur Andreas Heckmann sorgt dafür, dass wir den Überblick behalten; er wird von nun an regelmäßig über interessante neue Hefte berichten. Los geht es erst einmal mit einer Rückschau auf Literaturzeitschriften aus dem Jahr 2010. Diesmal mit Ausgaben von Edit, Neue Rundschau, Schreibheft. Den ersten Teil des Überblicks finden Sie hier.
 Edit
Edit
Edit 52 erfreut mit dem Essay „Wenn die Sonne stillsteht“ von Serhij Zhadan, den Claudia Dathe aus dem Ukrainischen übersetzt hat und in dem es um den Sommer geht, „90 Tage, um in heiße Luft und kaltes Flusswasser einzutauchen“. Wie so oft lassen sich erst aus der Beschwörung der Vergänglichkeit, mithin des Herbstes, poetische Funken schlagen: „Die Augustwälder sind leer, von Spinnennetzen durchzogen und von Kiefernnadeln übersät, auf die man völlig lautlos tritt. Nur ab und zu entdeckt man hinter den Bäumen die Silhouetten der Pilzsucher. Es ist eine zweifelhafte Beschäftigung, das Pilze-Sammeln, es erinnert mich immer ans Flaschen-Sammeln. Und wenn du zwischen Baumstümpfen herumkriechst und plötzlich auf die nächste Pilzkolonie stößt, ist das trotz allem faszinierend, als wäre es wirklich wichtig, so viele Pilze wie möglich zu sammeln, als ginge es nicht nur um ein Spiel, sondern wäre eine echte Notwendigkeit.“ Auch enthält die Nummer 52 Erzählungen der Schweizer Schriftstellerin Adelheid Duvanel (1936-96).
Edit. Papier für neue Texte. Nr. 52/2010. 5,00 Euro. Ein Inhaltsverzeichnis finden Sie hier.
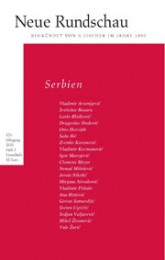 Neue Rundschau
Neue Rundschau
Die Neue Rundschau stellt in Heft 121/3 Literatur aus „Serbien“ – das Gastland der Leipziger Buchmesse 2011 – vor, und zwar erst Gegenwartsprosa, dann Gegenwartslyrik, was in seiner schieren Häufung leisen Überdruss erzeugt. Zwar haben Rundschau-Hefte stets ausgeprägte Schwerpunkte, doch waren sie oft geschickter strukturiert (wie in „Film und Erzählen“ (119/4) oder „Hans Keilson“ (120/4)) oder von Nebenschwerpunkten flankiert, was den Eindruck einer etwas drögen Monokultur wirksam unterband. Mit dem „Serbien“-Heft dagegen ist der Rezensent so wenig froh geworden wie mit dessen Vorgänger, der „Carte Blanche“-Ausgabe 121/2, in der der Verzicht auf einen klaren Schwerpunkt eine Monokultur anderer Art ins Kraut schießen ließ. Zum Glück hat immerhin Anne Weber mit ihrer „Ankleben verboten!“-Beilage einen wundervollen Beitrag geliefert. „1. Mach’s nicht wie Homer“, rät sie in der ersten ihrer dreizehn Thesen zur Technik des Schriftstellers und fährt munter fort: „2. Mach’s nicht wie Walser. 3. Mach’s nicht dem Stifter nach. 4. Noch dem Handke. 5. Und schon gar nicht dem Bernhard. 6. Mach’s nicht zu lang. 7. Mach’s nicht wie Thomas Mann. 8. Mach’s nicht wie die Sonnenuhr. 9. Setz‘ keine Pünktchen. 10. Schlag‘ nicht zu viel Fünkchen. 11. Schreib‘ nicht im Gehen. 12. Bleib‘ nicht stehen. 13. Mach’s gut.“
Neue Rundschau, Heft 121/3. 272 Seiten. 12,00 Euro. Das Inhaltsverzeichnis finden Sie hier.
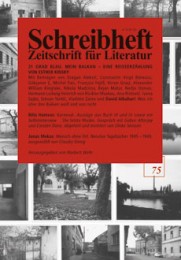 Schreibheft
Schreibheft
Wie man’s gut macht, zeigt das Schreibheft in seiner Jubiläumsausgabe mit einer Reiseerzählung von Esther Kinsky. „21 Grad Blau. Mein Balkan“ versammelt eher essayistische Tastbewegungen in den Südosten Europas, die ihren Ausgang gern am Budapester Ostbahnhof nehmen und neben Kindheitserinnerungen der Autorin und Reiseerlebnissen auch Reflexionen über Kultur und Geschichte einzelner Balkanregionen enthalten. Das ist so subjektiv wie kundig, so sensibel wie analytisch und stellt insofern schon für sich genommen einen literarischen Glücksfall dar. Doch indem Kinsky längere Textpassagen von AutorInnen der Region zitiert (u.a. Vladimir Zarev, dessen Roman „Feuerköpfe“ im Juli bei Zsolnay erscheinen wird), weitet sie ihren Text zum Gespräch und kann so auf zwanglose und stets fruchtbare Weise einer Reihe von Stimmen, die ihr wichtig sind, eindrucksvoll Gehör verschaffen. Darf man da von einer embedded anthology sprechen? Jedenfalls ist diese Form, bei der eine Schriftstellerin die Leser auf essayistischer Fahrt an literarischen Bildungserlebnissen teilhaben lässt, ausbauwürdig. W. G. Sebald hat Ähnliches in „Die Ringe des Saturn“ auf andere Art versucht, und es wäre schön, Esther Kinskys anders gelagertes, aber nicht minder reizvolles Vorhaben bald auch als Einzelpublikation in Händen zu halten.
Mit „Mensch ohne Ort. Nervöse Tagebücher 1944-1949“ des Schriftstellers und Filmemachers Jonas Mekas, die Claudia Sinnig schlicht glänzend aus dem Litauischen übersetzt hat, findet sich im Schreibheft ein weiterer umfangreicher Beitrag, der auch als Einzelpublikation vorliegen sollte. Der 1922 in Litauen geborene, in New York lebende Mekas berichtet in seinen Tagebüchern, wie er 1944 mit seinem Bruder vor der Roten Armee nach Wien fliehen will, stattdessen aber nach Elmshorn bei Hamburg kommt, dort Zwangsarbeit leisten muss und nach Kriegsende als Displaced Person in den Westzonen bleibt (erst in Schleswig-Holstein, dann in Wiesbaden/Mainz (wo er 1946-48 Philosophie studiert), schließlich in Kassel), ehe er Deutschland via Bremerhaven im Oktober 49 Richtung New York verlässt. Im Juli 45 notiert Mekas über einen Ausflug nach Glücksburg: „Nicht umsonst rühmt man sich hier, der schönste Ort an der ganzen Westküste der Ostsee zu sein. Ach, wir haben da gestanden, auf unsere Fahrräder gestützt, und auf die Ostsee geschaut. Ostsee, oh Ostsee. Hinter deinen blauen Wassern liegt Litauen, zum Greifen nah mit unseren sehnsüchtigen Blicken.“ Im Herbst 47 heißt es: „Wenn ich schlafe, dringt die Ungewißheit in meine Träume ein und ich erwache – zitternd am ganzen Leib, mit schreckgeweiteten Augen, und ich schaue mich um und sehe, das Zimmer ist schwarz und leer, leere Stühle und in den Gardinen am Fenster nur Wind, nur die Nacht drückt von draußen gegen alle Fenster.“
Diese Zitate dürften die hohe literarische Qualität der Tagebücher zeigen, in die zudem – darf man hier von embedded poems sprechen? – Mekas-Gedichte eingestreut sind: „Idyllen“ von 1948 sowie „Reminiszenzen“ von 1972. Die erste Idylle beginnt so: „Alt ist das Rauschen des Regens in den Zweigen der Sträucher,/ das Kollern des Birkhuhns im roten Morgen des Sommers,/ alt ist dieses, ist unser Sprechen:// über die gelben Felder mit Gerste und Hafer,/ die Feuer der Hirten im feuchten Herbst, in Wind und Einsamkeit,/ übers Kartoffelgraben,/ und über die schwere Sommerschwüle,/ das weiße Glitzern der Winter, das Bimmeln der Schlitten auf endlosen Wegen.“ Und die erste Reminiszenz: „Es war schon Sommer, als wir Flensburg verließen./ In der Bucht kreuzten schon Segelschiffe, und/ auf den Molen, auf Fischerbooten, auf dem Wasser/ flimmerte die Hitze./ Und als wir weiter liefen,/ immer weiter fort, bis Glücksburg -/ da sahen wir schon lärmende Kinder beim Baden,/ wie sie durch dichten Schilfwald wateten.// Uns zog es fort./ Der Krieg war gerade zu Ende. Die letzten/ Geschosse, die letzten Bombenschläge/ hallten noch wider an den Hängen. Durch zertrümmerte/ Bahnhöfe, ausgebrannte und verkohlte Kleinstädte/ zogen wir fort, drängelten uns hindurch/ zwischen Frauen, zwischen Kindern,/ Gefangenen und zerschlagenen, elenden Soldaten,/ Scharen von Flüchtlingen“.
Andreas Heckmann
Schreibheft 75: Béla Hamvas, Esther Kinsky, Jonas Mekas. 12 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier.