 Im Mai hat Carsten Jensen den ersten Europa-Preis der Europa Universität Flensburg erhalten. Jensen gehört zweifelsohne zu den wichtigsten Erzählern unserer Tage – sein Roman „Der erste Stein“ setzte Maßstäbe – so sieht aktuelle politische (Kriminal-) Literatur aus. CM präsentiert stolz seine Rede anläßlich der Preisverleihung im Mai 2018:
Im Mai hat Carsten Jensen den ersten Europa-Preis der Europa Universität Flensburg erhalten. Jensen gehört zweifelsohne zu den wichtigsten Erzählern unserer Tage – sein Roman „Der erste Stein“ setzte Maßstäbe – so sieht aktuelle politische (Kriminal-) Literatur aus. CM präsentiert stolz seine Rede anläßlich der Preisverleihung im Mai 2018:
Heimatlosigkeit
Der Begriff Heimat hat im Dänischen keinen düsteren Klang. Es gibt sogar eine Art Heimatliteratur, die aber vermutlich nur von Literaturhistorikern gelesen wird – es sind Autoren wie Jeppe Aakjær und Johan Skjoldborg. Erstaunlicherweise prangern diese Schriftsteller aber soziale Missstände an und schildern Heimat als einen verrohten und brutalen Ort, in dem Aufbruch als Befreiung erscheint.
 In Deutschland hat der Begriff Heimat einen ganz anderen, düsteren Klang. Untrennbar ist er mit der rassistischen Verehrung von Blut und Boden durch den Nationalsozialismus verbunden, seither ist das Wort kompromittiert. Wurzellosigkeit war eine menschliche Bürde, Verwurzelung die Voraussetzung aller wahren Menschlichkeit, und Heimatlosigkeit ist ein sperriges Wort, das nur auf Deutsch einen Sinn zu ergeben scheint – ein Fluch. Erst viele Jahre später können wir wieder mit einer gewissen Unbefangenheit mit diesen Worten umgehen.
In Deutschland hat der Begriff Heimat einen ganz anderen, düsteren Klang. Untrennbar ist er mit der rassistischen Verehrung von Blut und Boden durch den Nationalsozialismus verbunden, seither ist das Wort kompromittiert. Wurzellosigkeit war eine menschliche Bürde, Verwurzelung die Voraussetzung aller wahren Menschlichkeit, und Heimatlosigkeit ist ein sperriges Wort, das nur auf Deutsch einen Sinn zu ergeben scheint – ein Fluch. Erst viele Jahre später können wir wieder mit einer gewissen Unbefangenheit mit diesen Worten umgehen.
Der deutsche Soziologe Ulrich Beck behauptete in seinem optimistischen Buch Der kosmopolitische Blick aus dem Jahr 2005, dass der Begriff »Heimatlosigkeit« endlich seinen düsteren Klang verloren habe. Wir alle seien auf die eine oder andere Weise zu Bürgern der globalen Welt geworden.
Hatte Ulrich Beck recht? Ja und nein. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, tatsächlich zu Bürger des Globalen geworden. In einer globalisierten Welt hat es keinen Sinn mehr, zwischen der Innen- und Außenpolitik einer Nation zu unterscheiden. Außenpolitik ist Innenpolitik und umgekehrt. Also ja, Ulrich Beck hatte recht. Und nein, er hatte nicht recht.
Seine Definition von Heimat, die wir so leichtherzig für eine globale Bürgerschaft aufgegeben haben sollen, ist falsch. Wir haben uns nicht von irgendeiner unberührten Dorf-Idylle mit Kühen und grünen Wiesen getrennt. An diese Idylle glauben nicht einmal mehr die Produzenten von Postkarten. Die wirkliche Heimat für die Europäer von heute ist der Wohlfahrtsstaat.
Erstattet man die Dorf-Idylle durch den Wohlfahrtsstaat, bekommt der Begriff »Heimatlosigkeit« sofort wieder den drohenden Klang einer apokalyptischen Vorsehung. Ein Leben ohne Wohlfahrtsstaat ist der wahre Albtraum der Europäer. Der Wohlfahrtsstaat ist der dauerhafte Beitrag Europas zum 20. Jahrhundert. Die Technokraten sind gerade dabei, es zu vergessen. Doch die Menschen erinnern sich daran. Und genau darum geht es bei den populistischen Protesten.
Dass Deutschland plötzlich ein Heimatministerium bekommen hat, ist ein Zugeständnis an diese populistischen Strömungen. Die Aufgabe des Ministeriums ist die Landesentwicklung, die wahre Funktion jedoch ist symbolisch, und als Symbol ist es selbstreferentiell. Das Ministerium selbst ist die Heimat, nicht ein fernes Dorf in einer unberührten Landschaft.
 Eiszeit in Europa
Eiszeit in Europa
Der Angriff auf den Wohlfahrtsstaat begann vor langer Zeit. Margaret Thatcher, die 1979 Großbritanniens konservative Premierministerin wurde, fing damit an, als sie erklärte, »so etwas wie Gesellschaft gibt es nicht«. Ihrer Ansicht nach existiert eine gemeinsame Verantwortung oder gegenseitige Fürsorge über die Klassen und gesellschaftlichen Gruppen hinweg nicht. Es gibt nur den freien Markt, der aus menschlicher Sicht am ehesten an eine vom Sturm verwehte Eisscholle erinnert, die mit unbekanntem Ziel in den Meeresströmungen treibt. Mit Margaret Thatcher beginnt die Eiszeit in der europäischen Politik.
Margaret Thatcher gab ihre mit Nägeln beschlagene Stafette an die unterschiedlichsten politische Parteien und Strömungen weiter, bis alle – auch die Sozialdemokraten – sich hinter der umhertreibenden Eisscholle der Marktideologie versammelt hatten, und Begriffe wie Privatisierung, Outsourcing und Auslagerung zu Synonymen für Realismus wurden.
Die Finanzkrise des Jahres 2008 wird zur Kulmination einer durch das Finanzkapital angestoßenen Entwicklung, das mit einer amoklaufenden Spekulationsspirale die astronomischen Verluste der Volkswirtschaft zu verantworten hat. Die Schlussfolgerung der Katastrophe ist grotesk, da demselben Staat, der vom Bankrott bedrohten Banken mit enormen Unterstützungsgeldern zu Hilfe eilt, vorgeworfen wird, die Krise durch einem extravaganten Überkonsum verursacht zu haben. Der Staat ist sowohl der Retter als auch der bequeme Sündenbock.
Das Resultat ist die von Deutschland angeführte Austeritäts-Politik, deren Ziel dramatische Einsparungen und Einschränkungen der staatlichen Aktivität sind. Ein anderes Wort für denselben Vorgang ist die sogenannte Politik der Notwendigkeit, während der Wohlfahrtsstaat, der seine Rolle nun offiziell ausgespielt hat, in Konkurrenzstaat umbenannt wird.
Von den Toten auferstanden
Das Wunder geschieht im Sommer 2015. Die christliche Wiederauferstehungstradition wird neu belebt, und Europa erlebt einen säkularen Ostermorgen, als der tote Wohlfahrtsstaat aus der Erde gezerrt wird, und dieselben Leichenbestattern, die ihn gerade begraben haben, ihm das Totenhemd abbürsten. Der Begriff Konkurrenzstaat wird aus den Wörterbüchern gestrichen, der Wohlfahrtsstaat wird in all seiner Herrlichkeit wieder eingesetzt – allerdings nur rhetorisch und nicht in den Staatshaushalten.

Als Institution der Fürsorge, der Gemeinschaft und der sozialen Gerechtigkeit hat der Wohlfahrtsstaat seine Rolle tatsächlich ausgespielt. Dafür wird ihm nun eine neue Rolle zuteil. Sein Leben ist bedroht. Wenn Europa seine Grenzen für all die Flüchtlinge öffnet, die nun auf den Kontinent strömen, wird der Wohlfahrtsstaat zusammenbrechen, heißt es in kakophonischer Verwirrung bei den achtundzwanzig Nationen, die in dem fatalen Flüchtlingssommer die Europäische Union bilden.
Jahrelang haben sie dem Wohlfahrtsstaat die Totenmesse gelesen. Nun präsentieren sie sich als dessen letzte Verteidiger gegen die anströmenden Flüchtlingshorden, die sich mit ihren Schmarotzerinstinkten auf einem historischen Plünderungszug durch Europa befinden.
Von seiner Grundidee her ist der Wohlfahrtsstaat Ausdruck einer Vorstellung von Gerechtigkeit, die alle Bevölkerungsschichten betrifft. Die Gleichheit aller Menschen ist sein oberstes Gebot. Der künstlich wiederbelebte Wohlfahrtsstaat, der nun ein Festtagskleid bekommt, das sich von seinem Totenhemd kaum unterscheidet, ist jedoch nicht für alle da, sondern nur für einige. Es ist der Wohlfahrtsstaat der Dänen oder der Deutschen, nicht nur, weil sie ihn aufgebaut haben, sondern auch, weil er exklusiv für sie erdacht wurde. Es ist nicht bloß eine nationale Konstruktion, sondern eine nationalistische.
Der ethnische Wohlfahrtsstaat: Eine historisch betrachtet ganz neue Institution, dessen Aufgabe es nicht ist, seine Türen zu öffnen, sondern zu verschließen. Der Wohlfahrtsstaat wird zu einer Festung, deren Zugbrücke hochgezogen ist.
Dies ist der große Augenblick des Populismus. Zwar reden Populisten nicht viel über den Wohlfahrtsstaat. Und doch feiern sie ihn indirekt, indem sie ständig von seinen Feinden sprechen.
Während der Wohlfahrtsstaat seine Popularität bewahrt, ist dies bei seinen Begründern, den Arbeiterparteien, nicht der Fall. Kompromittiert durch ihren leichtsinnigen Umgang mit der Politik der Notwendigkeit und der Schwärmerei für Privatisierungen, sind sie ihn den meisten europäischen Ländern dem Zusammenbruch nahe.
 Was suchen Flüchtlinge?
Was suchen Flüchtlinge?
Was suchen Flüchtlinge? Was treibt sie an? Wegkommen oder ankommen? Sind sie Experten für den Wohlfahrtsstaat, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um lebenslange Sozialhilfeempfänger in einer großen bürokratischen Maschinerie zu werden? Oder suchen sie nur die Abwesenheit von Krieg, Korruption und Unterdrückung? Das Europa, das wir verteidigen wollen, ist das Europa des Wohlfahrtsstaats. Das Europa, nach dem sie suchen, ist der freie Markt mit seinen Möglichkeiten. Das ist das Paradoxe an der sogenannten Flüchtlingskrise, die in Wahrheit eine politische Krise ist. Es geht nicht um den Zusammenstoß von Christentum und Islam, von religiösen und säkularen Werten. Es ist der Zusammenstoß von zwei unterschiedlichen Auffassungen von Europa – dem Kontinent der Begrenzungen gegenüber dem Kontinent der Möglichkeiten. Wir Europäer betonen unsere Begrenzungen. Die Flüchtlinge glauben an unsere Möglichkeiten.
Vielleicht ist dies die Parole der Zukunft: Europa als Kontinent der Möglichkeiten. Nicht als eine Verlängerung der neoliberalen Eiszeit, in der Europa bloß ein rund um die Uhr geöffneter Selbstbedienungsladen ohne Sicherheitspersonal ist. Und in dem Finanzspekulanten und multinationale Gesellschaften die menschlichen Ressourcen ungehindert ausplündern können, ohne etwas zurückgeben zu müssen. Sondern Europa als ein Kontinent der Möglichkeiten, wenn es zur Entstehung einer neuen Gemeinschaft kommt.
Der Kontinent der Alten
Darf ich es wagen, für einen Augenblick ein Tabu zu brechen? Irgendwann einmal waren alle einer Meinung, dass Europas großes Problem das immer höhere Durchschnittsalter seiner Bevölkerung ist. So ist es noch immer. Nur reden wir jetzt nicht mehr darüber. Stattdessen sind die Alten mit ihrer Ängstlichkeit zu einem politischer Machtfaktor geworden, sie halten es mit der Zukunft wie mit ihrem eigenen kommenden Tod: Sie wollen ihn möglichst nicht wahrhaben. In einer jungen Welt ist Europa zum Kontinent der Alten geworden.
Nordafrika und der Nahe Osten sind unsere großen Nachbarn, halbe Kontinente, in denen bis vor wenigen Jahren Hoffnung und Aufbruchsstimmung herrschte, an der wir hätten mitarbeiten können. Wir haben uns jedoch entschieden, es zu ignorieren.
Europa hat eine Schicksalsgemeinschaft mit Nordafrika und dem Nahen Osten. Es sind unsere Nachbarn. Europäische Großmächte haben sie kolonisiert. Dann haben sie sich losgerissen, oft genug mit blutigen Kriegen. Aber nach wie vor sind wir im Guten wie im Schlechten verbunden.
Die Begegnung zwischen einer jungen Generation in Nordafrika und einem alternden Europa hätte eine glückliche Begegnung werden können. Als der Nahe Osten mit der Suche nach neuen Regierungssystemen beschäftigt war, hätten wir mit unseren reichen Erfahrungen beitragen können. Was hätten wir nicht alles zusammen vollbringen können? Diese historische Chance ist nun verpasst. Unsere Nachbarkontinente sind zu autoritären Herrschaftsformen zurückgekehrt oder werden in zerstörerischen Kriegen zerrissen, für die wir die Mitverantwortung tragen.
Eine entlarvende Denkpause
Menschenrechte oder Bürgerrechte? Was ist der Unterschied? Wir sollten nachdenken, bevor wir die Frage beantworten, und vielleicht entlarvt diese Denkpause unser Problem.
Menschenrechte schützen uns vor staatlichen Übergriffen, Bürgerrechte sichern uns Einfluss auf den Staat. Bei den Menschenrechten geht es um das Recht, beschützt zu werden. Bei den Bürgerrechten um das Recht zu bestimmen. Die Menschenrechte gelten für alle, die Bürgerrechte für die Bürger einer einzigen Nation. In einem Land ohne Bürgerrechte gibt es auch keine Menschenrechte.
Aber braucht es überhaupt Menschenrechte in einem Land, in dem es Bürgerrechte gibt? Das ist die Frage, die jetzt auch in Ländern gestellt wird, die sich demokratisch nennen. Was bedeutet es, wenn eine Mehrzahl im Land dafür stimmt, die Menschenrechte zu »revidieren« oder schlichtweg abzuschaffen; wenn eine Mehrzahl sich gegen die Verpflichtung ausspricht, Menschen in Not zu helfen, die auf der Flucht aus einem Land sind, in dem Krieg herrscht?
Totalitäre Staaten wissen, wie eng Menschenrechte und Bürgerrechte miteinander verbunden sind, und wenn ein totalitärer Staat sich an der einen Art der Rechte vergreift, vergreift er sich auch an der anderen. Menschen werden willkürlichen Übergriffen ausgesetzt, gleichzeitig wird ihnen jede Form der Einflussnahme genommen. Wissen wir das auch?
Sollte es wirklich möglich sein, dass Menschenrechte und Bürgerrechte kollidieren können, dass die Bevölkerung einer Nation mit Hilfe ihrer Bürgerrechte Verfolgten und Opfern ihre Menschenrechte verweigern? Kann eine Mehrheit eine Minderheit aus dem Kreis der Menschen herauswählen? Ist das unsere traurige Schlussfolgerung aus dem Fall der Berliner Mauer, der Auflösung des südafrikanischen Apartheidstaats und dem Rückzug der Militärdiktaturen in Südamerika, dass Menschen keinen Bedarf an Rechten mehr haben und daher auch keinen Anspruch auf unseren Schutz, wenn sie auf der Flucht sind? Ist dies das wahre Dilemma Europas nach zwei Jahrzehnten des neuen Jahrtausends: die beginnende Aufkündigung der eigenen historischen Erfahrungen unseres Kontinents?
 Keine Nation existiert für sich allein
Keine Nation existiert für sich allein
Die Europäische Menschenrechtskonvention, die Anfang der fünfziger Jahre verabschiedet wurde, entstand – wie die Ursprünge der Europäischen Union – aufgrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Wenn aus dem Zweiten Weltkrieg eine Lehre gezogen werden konnte, dann die, dass eine einzelne Nation einen übermächtigen totalitären Feind nicht besiegen kann. Die Lehre aus der Niederlage des Nazismus war simpel. Die Nation, die sich auf ihre Souveränität berief und darauf bestand, sich allein gegen den eindringenden Feind zur Wehr zu setzen, war preisgegeben.
Nur eine Allianz, nicht nur zwischen Nationen, sondern auch zwischen den unterschiedlichsten Lebensanschauungen und politischen Systemen – von den liberalen USA über das konservative Großbritannien bis zur kommunistischen Sowjetunion, die selbst totalitäre Züge aufwies – war imstande, den vorpreschenden Nazismus zu besiegen. Im Kampf gegen den Nationalsozialismus mussten die Nationen jeden Gedanken an Souveränität aufgeben, wenn sie überleben wollten. Nur das Land, das Soldaten in fremden Uniformen auf seinem Boden zuließ, konnte den Feind vertreiben. Nur das Land, dessen Bevölkerung bereit war zu lernen, wie die Namen der ausländischen Generäle ausgesprochen wurden, würde befreit werden.
Der Zweite Weltkrieg war kein Kampf für nationale Souveränität, sondern in erster Linie ein Kampf gegen die Verletzung sämtlicher Menschenrechte durch einen totalitären Staat. Das Verbrechen des Nazismus bestand nicht nur darin, einen ungeheuren Eroberungskrieg angezettelt zu haben, der die Machtbalance in ganz Europa verschob, sondern auch darin, dass die Nazis im Kielwasser ihrer Eroberungen mit der vollständigen Auslöschung ganzer Bevölkerungsgruppen begannen oder deren Leben auf sklavenähnliche Bedingungen reduzierten.
Lassen Sie uns folgendes Gedankenexperiment versuchen: Adolf Hitler schickt seine Armee nicht über die Grenze in irgendein fremdes Land. Die Vernichtung der Juden bleibt stattdessen ein Phänomen, das sich auf deutsches Gebiet begrenzt. Wenn die umliegenden Länder die nationale Souveränität für unantastbar halten, bleibt ihnen nur der passive Protest, wenn in den Vernichtungslagern aus den Schornsteinen der Krematorien Rauch aufsteigt. Jeder Versuch, die Juden mit etwas anderem als den kraftlosen Händen der Diplomatie zu retten, ist ausgeschlossen.
Das ist die unheimliche Lehre des Zweiten Weltkriegs: Der Respekt vor der nationalen Souveränität kann damit enden, dass ein Völkermord zugelassen wird.
Ein Übergriff auf eine abweichende Minderheit kann von der Bevölkerung durchaus tatkräftig unterstützt werden. In Polen, Rumänien und Litauen wurde die Vernichtungskampagne der deutschen Besatzungstruppen gegen die Juden von mordlüsternen Einheimischen enthusiastisch unterstützt.
Der Populismus unserer Tage hält es für demokratisch legitimiert, wenn eine parlamentarische Mehrheit diskriminierende Gesetze gegen eine ethnische Minderheit verabschiedet. In Ungarn wird die Dreiteilung der Staatsgewalt, die den Gerichten ihre Unabhängigkeit sichert, in Frage gestellt, ebenso die Meinungsfreiheit.
Ist es das Recht einer demokratischen Mehrheit, für die Abschaffung der Demokratie zu stimmen? Nur, wenn die Demokratie ausschließlich als Rechenmaschine angesehen wird und die Rechte der Menschen komplett ignoriert werden können.
Das Recht der Mehrheit zu bestimmen, muss auch heute an eine Grenze stoßen, nicht nur, wenn die Übergriffe durch einen totalitären Staat erfolgen, sondern auch, wenn eine parlamentarische Mehrheit dahinter steht. Die Menschenrechte, nicht das Stimmrecht, sind der letzte Schutz gegen die Barbarei.
Was bedeutet es, wenn starke Kräfte heute den Menschenrechten ihre universelle Gültigkeit absprechen, weil die Situation heute angeblich anders ist als nach dem Zweiten Weltkrieg? Wieso ist die Situation anders? Wann brauchen Menschen auf der Flucht keinen Schutz mehr vor Übergriffen?
 Optimismus und Pessimismus
Optimismus und Pessimismus
Als ich Anfang der neunziger Jahre auf eine jahrelange Reise rund um die Welt ging, fuhr ich als Pessimist los und kehrte als Optimist zurück. Mein Pessimismus lag daran, dass ich kurz zuvor im blutigen Bürgerkrieg auf dem Balkan Augenzeuge der Barbarei geworden war. Ich verlor den in der humanistischen Tradition verankerten Glauben an das grundlegend Gute im Menschen, von dem der norwegische Dichter Nordahl Grieg in »Von Feinden umringt« schreibt: Er stellt fest, dass Betrug und Täuschung der Grund für Hunger und Not sind. Nein, meine neuen Erfahrungen lehrten mich, dass es oft genug auch an Bosheit als einer aktiv treibenden Kraft im Menschen liegt.
Mein Optimismus, der in den kommenden Jahren ein Gegengewicht zu den Erfahrungen vom Balkan werden sollte, lag an den Erlebnissen, die ich auf meiner Weltreise mit Menschen hatte, die alle den ernsthaften Willen hatten, miteinander auf eine anständige Art und Weise zu leben – auch in Ländern wie Cambodia und Vietnam, die in den vergangenen Jahrzehnten von Krieg und politischen Katastrophen verwüstet worden waren. Als Fremder war ich bis zur Hilflosigkeit abhängig von dem Wohlwollen anderer, aber überall wurde ich mit demselben Gestus empfangen: Bei meinem Anblick ballte sich keine Faust zur Verteidigung. Immer wurde ich mit ausgestreckten Armen begrüßt.
Pessimismus und Optimismus. War ich näher an der Wahrheit über den Menschen, als ich Zeuge der Barbarei auf dem Balkan wurde? War mein Optimismus naive Träumerei, möglicherweise geprägt von der Stimmung der frühen neunziger Jahre, als die Berliner Mauer gerade gefallen war, und die Diktaturen überall auf dem Rückzug waren, während die Demokratien sich auf dem Vormarsch befanden? Oder schwankte ich zwischen zwei Wahrheiten, die – obwohl sie sich zu widersprechen scheinen – tatsächlich beide gültig sind, als Beweis dafür, dass der Mensch ein freies Wesen ist, das selbst wählen muss, ob es auf der Seite des Guten oder des Bösen stehen will?
Wenn Letzteres der Fall ist, scheinen wir heute dem Balkan näher zu sein als dem Fall der Berliner Mauer. Überall werden neue Mauern errichtet, autoritäre Regime breiten sich aus, und darüber hinaus kommt es zu einem Stammesdenken über die Aufteilung der Welt in ein unversöhnliches Die-oder-Wir.
Der Westen selbst hat die Demokratie mit seinen fatalen Interventionen im Irak, Afghanistan und Libyen in Misskredit gebracht. Als es wenige Tage nach Saddam Husseins Fall zu umfassenden Plünderungen in Bagdad kam, und der amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld mit einem lakonischen »Freiheit ist unordentlich« reagierte, unterschrieb er damit auch das Todesurteil seiner Mission. Wenn Demokratie ein Synonym für Chaos und Kriminalität ist, gibt es niemanden, der in Freiheit leben will. Befindet sich die Demokratie aus diesem Grund auf dem Rückzug? Oder liegt es, wie einige behaupten, daran, dass die Kulturen verschieden sind, dass nicht alle Menschen auf dieselbe Weise leben wollen?
Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der abends nicht gern zu Bett gehen will, ohne Angst haben zu müssen, dass unbekannte Männern mitten in der Nacht die Tür zu seiner Wohnung eintreten. Jeder, der ruhig schlafen möchte, bis die Sonne aufgeht, tritt auch für die Menschenrechte ein. Unüberbrückbarer ist die Kluft zwischen den Kulturen auch nicht. Unterschiedlicher sind wir als Menschen nicht.
Die gewöhnlichen Tugenden
Nach einer dreijährigen Reise, die ihn zu den unterschiedlichsten Orten der Welt führte, kommt der kanadische Intellektuelle und ehemalige Vorsitzende der liberalen Partei des Landes, Michael Ignatieff, in seinem Buch The Ordinary Virtues zu einer ähnlichen Einschätzung. Überall, ob in den USA, Brasilien, Bosnien, Myanmar, Japan oder Südafrika, trifft er bei den Einheimischen auf dasselbe Bewusstsein: Niemand hat das Recht, sie beiseite zu schubsen, sie zu treten oder ihnen den Mund zu verbieten. Die Vorstellung, dass sie – ganz unabhängig von ihrem sozialen Status – Rechte haben, hat überall Wurzeln geschlagen. Auf dieses Bewusstsein zielt Ignatieffs Buchtitel ab, wenn er von den »gewöhnlichen Tugenden« spricht.
Doch diese Tugenden sind lokal verwurzelt und haben offensichtliche Grenzen. Das Solidaritätsgefühl und die Hilfsbereitschaft beziehen sich nur auf diejenigen, die genau wie die Einheimischen selbst sind – nicht auf diejenigen, die ethnisch, religiös oder kulturell anders sind. Und damit sind wir mitten in Europas Dilemma: Der Feindseligkeit gegenüber Flüchtlingen.
In Ignatieffs Buch, das 2017 erschien, ohne dass das Wort Nationalismus ein einziges Mal auftaucht, findet sich eine ebenso vorsichtige wie polemische Formulierung des Dilemmas. In einem Land, das sich weigert, sich dem Strom der Flüchtlinge zu öffnen, stehen wir seiner Meinung nach einem Konflikt zwischen der demokratischen Souveränität – das heißt dem Willen der Mehrheit, die will, dass die Grenzen des Landes geschlossen bleiben – und einem moralischen Universalismus gegenüber, der von uns verlangt, Menschen in Not zu helfen, egal, woher sie kommen.
Seine Formulierung ist vorsichtig, weil er hier einer Bevölkerungsmehrheit demokratische Souveränität zugesteht, die Menschenrechte außer Acht lassen möchte. Und sie ist polemisch, weil er an mehreren Stellen in seinem Buch Menschenrechte als eine abstrakte, globale Schreibtisch-Ethik beschreibt, obwohl sie doch etwas ganz anderes sind, nämlich ein hart erkämpftes historisches Recht, das zu vergessen fatale Folgen haben kann.
Wir gehören alle zur selben Art, aber wir leben nicht alle in der gleichen moralischen Welt, behauptet Ignatieff. Wir können uns nicht über unsere Unterscheide hinwegsetzen, wenn es um Hautfarbe, Rasse, Geschichte, Geschlecht und Kultur geht. Wir leben in einer globalisierten Ökonomie, aber unsere Herzen und Sinne sind nicht globalisiert, lautet seine Schlussfolgerung.
Wenn wir also die Grenzen für Flüchtlinge öffnen, sollten wir nicht über deren Rechte als Verfolgte reden. Wir sollten stattdessen die Rolle des Aufnahmelands als Geber betonen. Das Asyl ist seiner Ansicht nach ein Geschenk, das wir den Flüchtlingen geben, kein Recht, das sie haben.
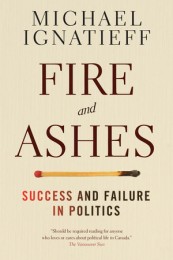 Zum Schweigen verurteilt
Zum Schweigen verurteilt
In seinem vorhergehenden Buch, „Fire and Ashes“, vertritt Michael Ignatieff eine andere Haltung. In diesem Buch setzt er sich mit seiner bitteren Wahlniederlage als Vorsitzender der liberalen Partei Kanadas auseinander, die später von seinem Nachfolger Justin Trudeau zu einem triumphierenden Wahlsieg geführt wurde. Ohne dezidiert die Flüchtlinge zu erwähnen, ist er der Meinung, dass es darum gehe, gegen die Kräfte zusammenzustehen, die versuchen, uns mit Andersartigkeit, Hass und Neid zu spalten.
»Es ist eine Geschichte, die uns lehrt, dass wir besser werden müssen, als wir sind.« Kein Wunder, dass Ignatieff als Vorsitzender der Liberalen scheiterte. Er vertritt gewissermaßen ein pädagogisches Projekt, doch heute ist es längst akzeptierte Wählerpsychologie, die Wähler niemals zu belehren oder ihnen zu erklären, dass sie nicht gut genug sind, so wie sie sind.
Das ist die Triebkraft hinter dem Erfolg des Populismus: Immer bestätigt er seinen Wählern, dass sie genau richtig sind, so wie sie sind – nicht trotz ihrer Mängel, sondern wegen ihrer Mängel. Ihnen wird der Spiegel der Selbstbestätigung vorgehalten, nicht der erziehende Zeigefinger.
Ist das der richtige Weg, dass uns niemand an die Rechte der Flüchtlinge erinnert, sondern sich stattdessen mit dem Appell an unsere eigene Generosität begnügt? Besteht damit nicht das Risiko, dass von vornherein ein hierarchisches Verhältnis aufgebaut wird, mit uns in der Rolle der Geber und den anderen in der weitaus demütigeren Rolle der Empfänger?
Welche Gefühle erwarten wir bei denen, denen wir ein Geschenk überreichen, obwohl wir ihr oder ihm nichts schulden? Dankbarkeit, wie die Vorsitzende der dänischen Sozialdemokratie Mette Frederiksen verriet, als sie auf Twitter eine junge dänische Frau mit somalischem Hintergrund attackierte, weil sie die Ausländerpolitik der Partei angegriffen hatte: »Es sind harte Worte von einer jungen Frau, die von Dänemark gut aufgenommen wurde.«
»Meine ethnische Herkunft wurde ins Spiel gebracht, und es wurde mir ziemlich deutlich erklärt, dass ich als Flüchtling dankbar zu sein habe. Und dass ich still sein und mich unkritisch verhalten solle«, so Hanna Mohamed Hassan, die mit ihrer Kritik die ungeschriebenen Spielregeln für lebenslange Dankbarkeit verletzt hat, die Flüchtlinge zum Schweigen verurteilen.
Mit der Rolle des Flüchtlings als Geschenkeempfänger geht ein reduzierter Status einher. Schweigend und folgsam sollen sie Danke sagen und damit ihren Willen zur Anpassung bekunden. Das Schicksal des Geschenkeempfängers ist es, ein Außenstehender zu sein, nicht nur kulturell als Flüchtling aus einem anderen Erdteil, sondern auch, wenn es um ihr Stellung innerhalb der Demokratie geht. Es verhält sich hier wie in George Orwells Dystopie »Animal Farm«: Einige sind gleicher als andere, und der Flüchtling ist kein Bürger, sondern dazu verurteilt, sein Leben lang ein Halb-Bürger zu bleiben.
Alle haben etwas zu geben
Der Wohlfahrtsstaat war nie ein Almosen-Staat, sondern ein Rechtsstaat, ein Staat der Gleichwertigkeit, ein Staat der gegenseitigen Hilfsbereitschaft. Seine ursprüngliche Idee war nicht, dass Schwäche auch eine Art Identität sein kann, sondern immer nur ein vorübergehendes, vorläufiges Stadium. Daher war der Wohlfahrtsstaat auch ein Inklusionsstaat und nicht sein Gegenteil, ein Exklusionsstaat.
Wenn die Wohlfahrt aber zur Hintertür verwiesen wird, während die Wohltätigkeit zur Vordertür eintritt, beschränkt sich der Wortschatz des Empfängers notwendigerweise auf dieses eine Wort: danke. Das ist der tiefere Sinn des inzwischen tabuisierten Begriffs Konkurrenzstaat – die Verwandlung des Wohlfahrtsstaates von einem Inklusionsstaat zu einem Exklusionsstaat. Denn die konkurrierende Gesellschaft ist eine Exklusions-Gesellschaft, keine Inklusions-Gesellschaft.
Die plötzliche, explosionsartige Verbreitung des Wortes »Verlierer« ist ein eindeutiger Beweis dafür. Der Wohlfahrtsstaat kennt keine Gewinner oder Verlierer, aber genügend Starke und vorübergehend Schwache, also eine Hierarchie, die nicht auf Dauer angelegt ist.
»Es gibt immer etwas, worin man gut ist. Man muss nur herausfinden, was das ist«, sagt der Kranführer Ole in Ole Lund Kierkegaards Kinderbuch »Gummi Tarzan«. Das Mobbingopfer Ivan Olsen, der als Gummi Tarzan verspottet wird, lernt schließlich, mit hocherhobenem Kopf durch die Welt zu gehen, als er herausfindet, was er gut kann.
Wir können uns selbst in der Rolle der hochmütigen Geber sehen, oder wir können uns in Gummi Tarzans Geist entscheiden, jeden Menschen als jemanden zu sehen, der etwas zu geben hat. Die zweite Lösung scheint der richtige Weg zu sein, wenn wir die wachsende Ungleichheit und das überwinden wollen, was wir die Flüchtlingskrise nennen.
 Was können wir von Don Quichote lernen?
Was können wir von Don Quichote lernen?
Können wir zusammen leben? Der Roman des spanischen Schriftsteller Miguel de Cervantes über Don Quichote wurde berühmt als ein kompromittierendes Portrait eines naiven, idealistischen Träumers, der die Zeit, in der er lebt, nicht versteht, und zum Kampf gegen Riesen auszieht, wo andere nur Windmühlen sehen. Sein Widerpart ist sein treuer Knappe, der bodenständige und grundvernünftige Sancho Pansa – auch er eine komische Figur, von der aber in einem eher liebevollen Ton erzählt wird.
Irgendwann kommt Sancho Pansa in eine ähnliche Situation wie der versoffene Bauer Jeppe in Ludvig Holbergs Komödie »Jeppe vom Berge«, der im Bett des Barons landet, wo er als Beispiel für die Unfähigkeit der Bauern herhalten soll, wenn es um die Führung der Gesellschaft geht. In Sancho Pansas Fall ist es ein Herzog, der ihm anbietet, Gouverneur des Inselreiches Barataria zu werden. Sancho Pansa bittet den Ritter von der traurigen Gestalt um Hilfe, der sich trotz seiner närrischen Art als ein großer Menschenkenner erweist. Pansa folgt seinen Ratschlägen genau und besteht die Prüfung sogar so gut, dass seine Erlasse seither in der Stadt unter der Bezeichnung »Die Vorschriften des großen Gouverneurs Sancho Pansa« aufbewahrt werden.
Der verbitterte Herzog, der erkennt, dass sein Plan, den Knappen zu demütigen, gescheitert ist, vertreibt ihn von seinem Posten, doch Pansa geht als der moralische Sieger, nachdem er – im Gegensatz zu Ludvig Holbergs Jeppe – bewiesen hat, dass ein gewöhnlicher Mann ein Reich durchaus gut regieren kann.
Allerdings hätte er es nicht ohne den Rat des Idealisten Don Quichote geschafft, und das ist ein Erfolg für diese seltene Kombination von Bodenhaftung und Idealismus, gewöhnlicher Volkstümlichkeit und elitärer Träumerei, die nie die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient, obwohl ihre Botschaft an den Populismus unserer Zeit so deutlich ist.
Als das ungleiche Paar nach Barataria aufbricht, trifft Sancho Pansa einen alten Bekannten. Es ist ein Mann aus seinem Dorf, der aufgrund seiner maurischen, das heißt seiner muslimischen Herkunft per königlichem Dekret des Landes verwiesen wurde. Die beiden alten Freunde tauschen Geschichten über ihr Leben aus. Für den Mauren, der als deutscher Pilger verkleidet lebt, ist der Landesverweis eine Tragödie. Sein wahres Vaterland sei Spanien, erklärt er wieder und wieder. Er selbst ist, wie er es humoristisch beschreibt, überwiegend Christ und ein bisschen Moslem. Seine Frau und Tochter sind Christen, sein Schwager Moslem. Hier kann man wirklich von einer kulturell gemischten Familie sprechen, die sich irgendwann einmal in einem kulturell gemischten Land wohl gefühlt hat.
Und obwohl weder Pansa noch der Maure, königstreu wie sie beide sind, den Beschluss des Königs kritisieren, ist die Schilderung der Vertreibung an sich schon eine Kritik. Der Kultur- und Religionskrieg wird von oben angeordnet, doch im Dorf wurde geweint, als die ausgewiesenen Mauren den Ort verlassen mussten und viele Dorfbewohner anboten, sie zu verstecken.
Was war Cervantes’ Motiv für diese sympathisierende Schilderung des Schicksals der unglücklichen Mauren? Cervantes hatte an der Schlacht bei Lepanto teilgenommen, wo das Osmanische Reich in seinem Versuch aufgehalten wurde, Europa zu erobern. In der Schlacht wurde er mehrfach verwundet und verlor die Bewegungsfähigkeit einer Hand. Dann verschleppten ihn Piraten aus Algerien, und er musste fünf Jahre unter erbärmlichsten Umständen als Sklave leben, bevor er freigekauft wurde. Cervantes hatte also überhaupt keinen Grund, dem Islam oder den Muslimen gegenüber freundlich gesonnen zu sein. Dennoch überwand er seinen Widerwillen und entwickelte Sympathie für die Moslems, als sie Verfolgungen ausgesetzt waren – ebenso wie er, zumindest in Ansätzen, ein harmonisches Zusammenleben zwischen Islam und Christentum skizzierte.
Das alles passiert in einem Roman, der 1605 (sechzehnhundertfünf) erschienen ist. Zwischen Miguel Cervantes und uns liegen einerseits die Zeit der Aufklärung mit ihrer Botschaft von Humanismus und Toleranz, und andererseits das Zwanzigste Jahrhundert, in dem infame Kräfte die Dämonie des Zusammenstoßes der Kulturen ausleben durften. Und in der ganzen Zeit haben wir tatsächlich nichts gelernt und waren nicht in der Lage, uns auf das gleiche Niveau zu erheben, wie ein Roman, der vor vierhundertdreizehn Jahren von einem Kriegsveteran aus dem Krieg gegen den Islam geschrieben wurde?
Wer zur Klimaveränderung schweigt …
Jede Diskussion über Globalisierung, Ökonomie, Flüchtlinge und Populismus, die die Klimaveränderungen nicht mit einzubezieht, ist Eskapismus. Die gilt auch für Diskussionen über die Zukunft Europas.
Am Ende dieses Jahrhunderts wird der Nahe Osten aufgrund des Temperaturanstiegs unbewohnbar sein, halb Afrika wird auf der Wanderung nach Norden sein. Und wenn wir nicht wollen, dass Europa im Einundzwanzigsten Jahrhundert die Rolle als Schmelztiegel und Kontinent der kulturellen Vermischung übernimmt, die Amerika im Neunzehnten Jahrhundert innehatte, dann wird das Mittelmeer den Schauplatz für einen auf der historischen Skala noch nie zuvor gesehenen Massentod.
Der Golfstrom wird allmählich schwächer, und würde er aufhören zu fließen, würde auch Nordeuropa nicht mehr sicher sein, sondern von einer Eis-Apokalypse betroffen werden, die auch die privelegierten Skandinavier zwingen würde, sich der astronomisch wachsenden Zahl der Klima-Flüchtlinge anzuschließen.
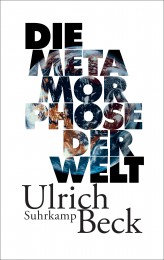 Die Katastrophe ist unsere Chance
Die Katastrophe ist unsere Chance
Ulrich Beck schrieb in seinem letzten, posthum herausgegebenen Buch »Die Metamorphose der Welt«, dass wir in einer Phase leben, die er eine Metamorphose nennt. Eine Metamorphose ist etwas Anderes und Größeres als bloß eine Veränderung, denn in einer Veränderung verfügen wir noch immer über Werkzeuge, die es uns gestatten, das Geschehen zu verstehen und zu benennen. Wir verfügen über Begriffe, Ideen und Worte, die uns eine scheinbare Kontrolle geben, und vor allem eine Idee, wo das Ganze hingeht, und was wir damit wollen. In der Gewalt einer Metamorphose sind wir wort- und begriffslos.
Es ist durchaus möglich, dass wir uns auf dem Weg zu einer namenlosen Katastrophe befinden – unsere wie immer verspäteten Reaktionen auf die Klimaveränderungen könnten darauf hindeuten. Wir müssen neue Worte und Begriffe finden, wenn wir die Welt verstehen und auch nur ein Minimum an Einfluss auf unser zukünftiges Schicksal behalten wollen.
Wir müssen uns selbst und die Idee unseres Daseins auf diesem Planeten neu erfinden. Die Katastrophe, sagt Ulrich Beck, ist die große Chance, uns von den Weltbildern und gesellschaftlichen Formen zu befreien, die uns an den Rand des Zusammenbruchs geführt haben. Wir haben die Chance, etwas entscheidend Neues zu denken und zu schaffen.
Wenn wir die Fragen nach Krieg, Flüchtlingskrise und Klimaveränderungen hören, ist unsere instinktive Reaktion, uns in einer populistischen oder nationalistischen Flucht vor der Wirklichkeit aus der Welt abzumelden. Stattdessen sollten wir uns der Welt mit militanten Vorschlägen zuwenden, wie alles anders sein könnte. Gewinnt der Populismus, sind wir alle die Verlierer. Die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sind so groß, dass sie sich nur lösen lassen, wenn wir alle zusammenstehen, über Kontinente, Religionen, ethnische Hintergründe und politische Haltungen hinweg.
Die Klimaveränderungen schenken uns die Möglichkeit, eine ganz neue Sprache zu finden und auf eine ganze andere Weise zu leben. Wir müssen wie nie zuvor in unserer Geschichte kreativ sein. Wir müssen ein ungeschriebenes Grundgesetz der Geschichte brechen. Betrachten wir die Geschichte der Stämme, der Nationen, der Kriege und der Feindschaften: Es scheint, als ob wir wissen erst wirklich wissen, wer wir sind, wenn wir einem Gegner gegenüberstehen.
Doch das Der-oder-Wir-Denken ist jetzt das Rezept für unseren Untergang. Wir müssen gemeinsam zu einer neuen Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg finden. Oder das Haus, in dem wir wohnen, stürzt bei dem Erdbeben zusammen, das die Klimaveränderungen für alles sein werden, woran wir geglaubt haben, und was wir über die Bedingungen des Lebens wussten.
Wir müssen in einem großen Maßstab denken. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, nur für uns persönlich fantasievoll zu sein, wir müssen es für die Menschheit sein. Es geht nicht nur um unser Überleben als Art, es geht auch um das Schaffen einer Gesellschaft, die anziehender und menschlicher ist als die gegenwärtige. Der Kampf ums Überleben darf nicht in einem Kampf jeder gegen jeden enden.
Wenn die Gefahr am größten ist, müssen es die Träume auch sein. Unsere gemeinsame Reise muss zu den Sternen führen. Nicht zu denen, die unerbittlich am Himmelszelt blinken, unerreichbare Lichtjahre entfernt, sondern zu denen, die wir selbst entzündet haben.
Ist Optimismus Pflicht?
»Pessimismus des Verstandes – Optimismus des Willens.« Das Zitat stammt von Antonio Gramsci, dem Gründer der kommunistischen Partei Italiens. Ein brillanter Denker, dessen Unabhängigkeit vom Stalinismus seiner Zeit an der Tragödie lag, dass er elf Jahre lang in einer der Gefängniszellen von Benito Mussolini in totaler Isolation verbrachte, bevor sein ohnehin geschwächter Körper aufgab.
Ich hatte immer das Gefühl, dass Pessimismus die klare Sicht verstärkt und daher intellektuell anziehend ist, doch umgekehrt kann Pessimismus auch der Schwarzseherei Nahrung liefern – dem resignierenden Gefühl, dass es ohnehin keinen Sinn hat zu denken oder zu handeln.
Und Optimismus? Der Optimismus des Willens? Reicht es zu wollen, ohne zu denken und einen klaren Blick zu haben? Oder gibt es eine mögliche Allianz zwischen dem Willen und dem Intellekt, dem Optimismus und dem Pessimismus, die diesen immer fatalen Entweder-Oder-Gedanken aufhebt?
Als ich mit Mitte vierzig Vater wurde, spürte ich, dass Optimismus zu einer moralische Pflicht wurde. Wenn ich nicht an eine Zukunft glauben würde, in der es wert ist zu leben, auch nach meinem eigenen Tod, hatte ich kein Recht, Kinder in die Welt zu setzen. Dann könnte ich das eigene Kind auch auf die Straße setzen und es dem Gesetz der Straße überlassen.
Allerding muss Optimismus nicht zu einem naiven Vertrauen führen, dass die Dinge sich schon irgendwie regeln werden. Optimismus erfordert Willen, auch den Willen zu handeln, und so kann der Pessimismus mit seiner nüchternen Klarsicht zu einem wichtigen Alliierten werden.
Viele von uns sind Eltern oder Großeltern, und diejenigen unter uns, die es nicht sind, sind Teil eines Netzwerks, in dem Kinder eine Rolle spielen. Alles, was von uns gefordert wird, ist die bereits bekannte Übung, einen Schritt beiseite zu treten und einzusehen, dass das Leben durch die Kinder und Enkelkinder weitergeht, auch wenn wir nicht mehr hier sind. Die Kinder sind auf einer Reise jenseits eines Horizonts, den wir niemals mehr überqueren werden, doch ihre Reise beginnt mit uns, und die Fortsetzung dieser Reise ist ebenfalls abhängig von unseren Entscheidungen und Handlungen.
Jedes Kind weiß, dass das Happy Ending im Märchen nie sofort kommt, sondern erst nach vielen Unannehmlichkeiten. Es ist nichts Abstraktes, den Blick auf den Horizont zu richten, egal ob er zehn, zwanzig oder fünfzig Jahre entfernt liegt. Unsere Kinder werden in diesem Horizont leben. Woran wir als ferne Zukunft denken, wird ihre Alltag sein.
Alle, die Kinder haben, sind von Natur aus weitsichtig. Nur schlechte Eltern, Werbefachleute und Kommunikationsratgeber leben im Augenblick. Doch genau das riskieren wir für unsere Kinder, für unsere Enkel und für den Planeten zu werden: schlechte Eltern.
Die Liebe ist zu einem ethischen Imperativ geworden, und es gibt keine psychologischen Entschuldigungen für das Versagen, wenn die Zukunft des Planeten auf dem Spiel steht. Wir müssen nach vorn blicken, nicht im Namen eines verkommenen Fortschritts, nicht im Namen einer Wachstumsdogmatik, sondern aus Fürsorge für die kommenden Generationen, im Namen unserer Kinder und Enkelkinder.
 Carsten Jensen, Mai 2018 – mit freundlicher Genehmigung des Autors, des Übersetzers Ulrich Sonnenberg und der EUF Flensburg
Carsten Jensen, Mai 2018 – mit freundlicher Genehmigung des Autors, des Übersetzers Ulrich Sonnenberg und der EUF Flensburg
Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg
Jensens großer Roman, auf CrimeMag besprochen von Thomas Wörtche:
Carsten Jensen: Der erste Stein (Den første sten, 2015). Roman. Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg. Knaus, München 2017. 638 Seiten, 26 Euro.
Die Internetseite von Carsten Jensen (nicht ganz aktuell).











