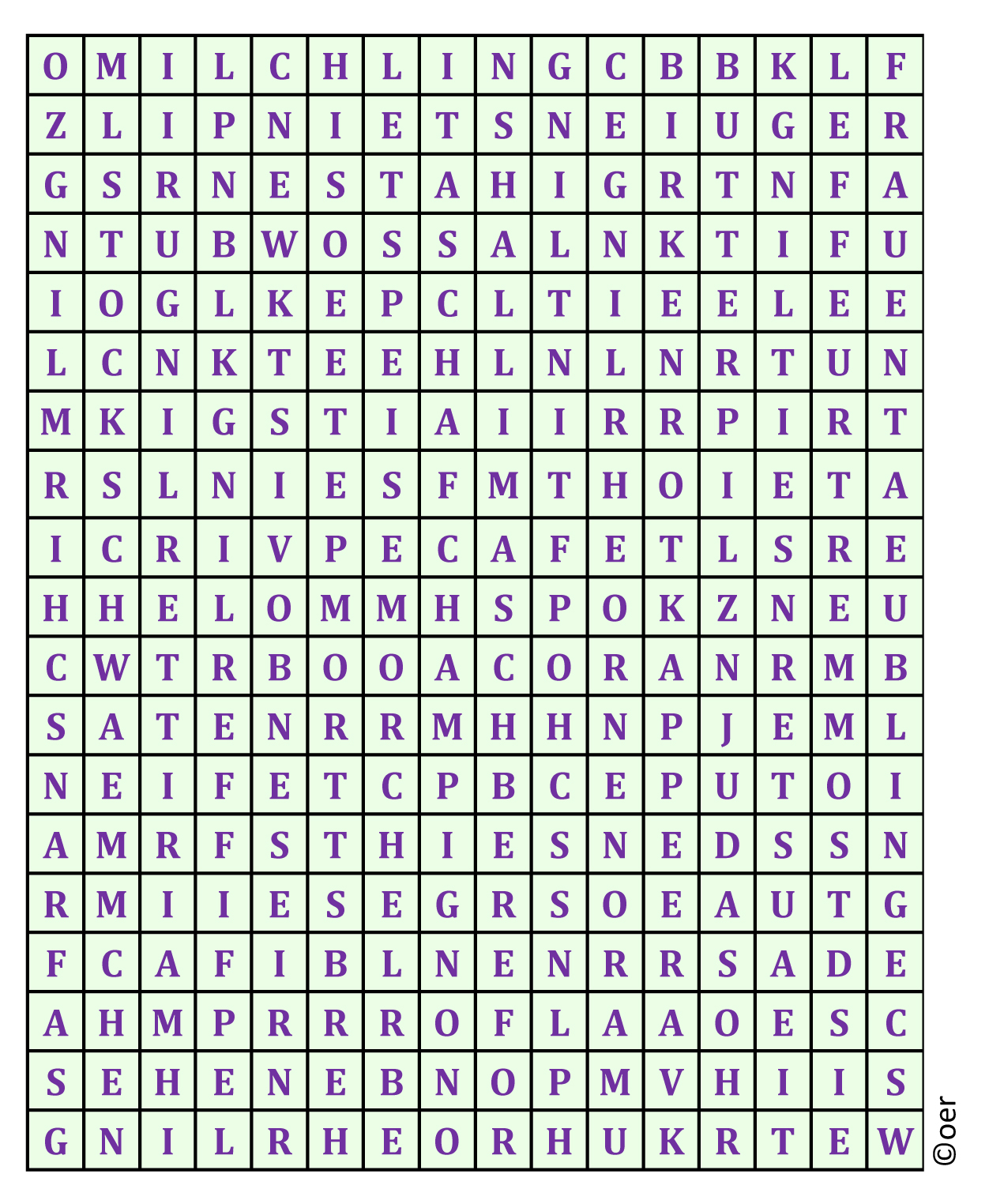Proletarier und Grobiane: „Rampart“ & „Skyfall“
Proletarier und Grobiane: „Rampart“ & „Skyfall“
„Für alle Fans von Schriftsteller James Ellroy kann ‚Rampart‘ nur eine Enttäuschung sein“, glaubt Cinema-Online zu wissen. Bullshit. Die „Rezension“ ist ein klassisches Beispiel jener kurz vor dem Abitur gelernten, von keinerlei Tiefgang getrübten und an der Sache an sich völlig desinteressierter Pseudoüberheblichkeit, die inzwischen als Online-Kritik durchgeht. Motto: Ich hab da mal schnell eine Meinung, ist ja nicht so wichtig wozu.
Auszüge: „Der ‚L. A. Confidential‘-Autor, der auch das Drehbuch zu diesem Film verfasste, schafft üblicherweise Figuren, die mit ihren ambivalenten Persönlichkeiten begeistern. Dave Brown (Woody Harrelson), der Held aus ‚Rampart‘, ist da eine unrühmliche Ausnahme. Denn sein Schicksal ist so erschütternd wie belanglos … Der dritte Film von Oren Moverman, der mit Woody Harrelson bereits das eindringliche Drama ‚The Messenger‘ gedreht hat, ist weder Krimi noch Thriller. Stattdessen inszenierte der für einen Oscar nominierte Regisseur das schwer nachvollziehbare Psychogramm eines an der Realität zerbrochenen Mannes.
 Klar, Drehbücher werden „verfasst“, ambivalente Persönlichkeiten „begeistern üblicherweise“ und „weder Krimi noch Thriller“, das kann nur unrühmlich sein. Nun, ich habe mir den bei uns leider nur auf DVD erschienenen „Rampart“ zweimal angesehen – nicht zuletzt wegen Musik, Kamera und Schnitt. Aber auch wegen der bis in die letzte Statistenrolle sorgfältig besetzen und agierenden Darstellerriege, zu der Sigourney Weaver als stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, Steve Buscemi als ihr Chef, Ned Beatty als alter Mentor, Ice Cube als Internal-Affairs-Bulle, Anne Heche, Cynthia Nixon und die großartige Robin Wright als die dem gestörten Cop nahestehenden Frauen gehören. Und dann ist da Woody Harrelson als altgedienter Streifenpolizist Dave Brown – mit einer grandios-intensiven Schauspielerleistung. Sehr low key gespielt, mit aller Zeit der Welt für seine doppelbödige Präsenz. In seiner Intensität und dem inneren Fieber an James Woods erinnernd, bietet der weithin unterschätzte Harrelson hier einen Glanzpunkt seiner Karriere. Regisseur Oren Moverman lässt sich in vielen Szenen viel Zeit – insofern ist der Film vielleicht für die Fuzzi-Generation wirklich zu langsam. James Ellroy als Drehbuchautor ist versiert genug, dem Medium Film viel Platz zwischen den Worten zu geben. Der Film endet mit einem minutenlangen Schweigen, in dem der seelisch beschädigte, sich selbst aus jeder Gemeinschaft katapultierte Polizist im Dunkel steht und seine dysfunktionale Familie aus dem Gebüsch heraus beobachtet.
Klar, Drehbücher werden „verfasst“, ambivalente Persönlichkeiten „begeistern üblicherweise“ und „weder Krimi noch Thriller“, das kann nur unrühmlich sein. Nun, ich habe mir den bei uns leider nur auf DVD erschienenen „Rampart“ zweimal angesehen – nicht zuletzt wegen Musik, Kamera und Schnitt. Aber auch wegen der bis in die letzte Statistenrolle sorgfältig besetzen und agierenden Darstellerriege, zu der Sigourney Weaver als stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, Steve Buscemi als ihr Chef, Ned Beatty als alter Mentor, Ice Cube als Internal-Affairs-Bulle, Anne Heche, Cynthia Nixon und die großartige Robin Wright als die dem gestörten Cop nahestehenden Frauen gehören. Und dann ist da Woody Harrelson als altgedienter Streifenpolizist Dave Brown – mit einer grandios-intensiven Schauspielerleistung. Sehr low key gespielt, mit aller Zeit der Welt für seine doppelbödige Präsenz. In seiner Intensität und dem inneren Fieber an James Woods erinnernd, bietet der weithin unterschätzte Harrelson hier einen Glanzpunkt seiner Karriere. Regisseur Oren Moverman lässt sich in vielen Szenen viel Zeit – insofern ist der Film vielleicht für die Fuzzi-Generation wirklich zu langsam. James Ellroy als Drehbuchautor ist versiert genug, dem Medium Film viel Platz zwischen den Worten zu geben. Der Film endet mit einem minutenlangen Schweigen, in dem der seelisch beschädigte, sich selbst aus jeder Gemeinschaft katapultierte Polizist im Dunkel steht und seine dysfunktionale Familie aus dem Gebüsch heraus beobachtet.
Zeitlich ist der Film 1999 in Los Angeles angesiedelt, acht Jahre nach dem Rodney-King-Skandal, der den titelgebenden Bezirk weltweit bekannt machte. Rampart in Downtown L.A. ist mit beinahe 400.000 Einwohnern auf 20 Quadratkilometern das dicht besiedeltste Viertel dieser Stadt und Ellroy kennt genug Rampart-Geschichten, um daraus mehrere Filme zu machen. Hier reduziert er, arbeitet minimalistisch, nimmt sich – unüblich für ihn – ziemlich zurück. Die Fernsehserie „The Shield“ (wer sie nicht kennt: ANSCHAUEN!) sollte ursprünglich „Rampart“ heißen, bis das LAPD intervenierte. Die Polizeifilme „Colors“ (von 1988) und „Training Day“ (2001) ebenso wie das Videospiel „Grand Theft Auto: San Andreas“ sind ohne den Ortsbezug zu diesem Viertel nicht vorstellbar. „Rampart“ ist ein würdiger Vertreter dieses speziellen Genres.
Rampart, USA 2010, R: Oren Moverman, B: James Ellroy und O.M., L: 104 Min. (DVD: Ascot Elite)
 Das abgegraste Ödland als Metapher
Das abgegraste Ödland als Metapher
Hm. Das also ist er, der 23. Bond-Film zum 50jährigen Jubiläum? Und aller Erden schwelgt, wie gut er sei. Schlecht ist er nicht, im Zeitalter von Copy&Paste und digital perfekter Animation, aber ist das noch ein Bond? Ein James-Bond-Film, das war immer ein bisschen mehr; schon der Titel kündigt ja diesmal eine Abkehr vom Höherstreben an. Als der Film nach einem durchaus beherzten Humorversuch (Judy Dench zu Bond im wieder aktivierten alten Aston Martin, als er den Schalthebel aufklappt und der rote Knopf zum Vorschein kommt: „Wollen Sie mich jetzt hochschießen?“) zum Schauplatz des Finales einschwenkt, das Filmgefährt aus „Goldfinger“ das Tor zu „Skyfall“ passiert, als würde gleich Daphne du Mauriers verwunschenes Schloss Manderley erscheinen, da liegt vor uns eine weite, leere Öde mit einem Haus darauf. O.k., Schottland sieht so aus. Das abgegraste Ödland aber und die dann folgenden Geschehnisse darauf taugen auch als prima Metapher für den klinischen Zustand dieses Bond-Films. Bereits der weithin lachhaft peinliche Vorspann – einst ein Glanzlicht der Filmgestaltung – zeigt die Verzweiflung, die in den Produktions- und Kreativbüros geherrscht haben muss. Die Zentralmetapher des Films, die Brando-Nachahmungstalent Nr. 1, Javier Bardem, rezitieren darf, handelt davon, wie man Ratten zu Kannibalen macht, die sich dann gegenseitig dezimieren, bis es nur noch zwei sind und dann eine übrig bleibt. Der Schlusssatz des Films, als Bösewicht Bardem sterbend am Boden liegt, lautet dann auch, von Bond mit pseudocooler Häme gesprochen: „Ratte frisst Ratte!“ Na großartig, how very british. Aus dem alten James Bond ist ein prolliges Arschloch wie alle anderen geworden, welch Fortschritt der filmischen Evolution.
Daniel Craig, für mich eine Fehlbesetzung seit Beginn, eine wandelnde Rasierwasserreklame, seine schauspielerische Tiefe der Höhe des 007-Handys entsprechend, für das er gerade Werbung macht, sieht dieses Mal aus wie ein sibirischer Häftling. Kommunikation a la Ich-Tarzan-du-Jane hat inzwischen auch den britischen Geheimdienst erreicht: „Männer wollen uns töten. Wir kommen ihnen zuvor. Und töten sie.“ Ironie, wie er sie im quasi Nachspann des Films (mit neuer Moneypenny und neuem „M“) zeigen soll, ist ihm äußerlich, der Bagger, mit dem er zu Beginn einen fahrenden Zug zerlegt, steht ihm da besser. Nur: Draufhauen, über Dächer hetzen, waghalsig Motorradfahren oder sich prügeln, das können andere besser, viel, viel besser, dazu braucht es keinen Bond. Dafür gibt es „Bourne“ (Craig sollte sich mal den ganz und gar uneitlen Jeremy Renner anschauen) und „Mission Impossible“, bald auch „Jack Reacher“.
Hätte ich je gedacht, dass mir Tom Cruise lieber wird als ein Bond? Oh, England, wohin bist du gesunken? Das Ödland um das „Skyfall“-Schloss entspricht den im Jubiliäumsfilm kannibalisierten Bond-Filmen, in dem auch der am Schluss (als wäre er ein nutzloser Dinosaurier) von einer Hubschrauber-Bordkanone zusammengeschossene Aston Martin einfach auf den Schrotthaufen der Bond-Geschichte geworfen wird. „Skyfall“ ist die endgültige Proletari- und Grobianisierung des Bond-Genres. Schade drum. Schade um einen Film, der eine Judi Dench als Geheimdienstchefin vor einem Untersuchungsausschuss zu einem Tennyson-Zitat anheben lässt, mit dem sie den moralischen Kern ihrer Arbeitsausfassung zu beschreiben sucht, die Szene aber mit wüster Ballerei beendet, und einer „M“, die sich wie eine schlechte Schülerin wieder setzt, weil sie aus der Zeit gefallen scheint. Ja, die Kraft, sie hat die Bond-Macher verlassen. Mal sehen, wie es weitergeht.
P.S. Hier die im Film zitierten Zeilen, es sind die letzten aus Alfred Lord Tennysons „Ulysses“ von 1833:
Obwohl wir nicht die Kraft besitzen,
die einmal den Himmel und die Erd‘ bewegt;
wir sind das, was wir sind;
von gleichem Sinn und Mut,
vom Zeitgeschick geschwächt,
doch stark im Will’n zu streben,
suchen, sehn – und nie zu ruhn.
(hier auf Englisch)
Alf Mayer