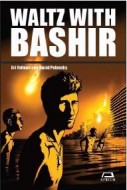 Waltz with Bashir – der Comic
Waltz with Bashir – der Comic
Was ist authentischer? Ein Film oder ein Comic? Auch wenn beide versprechen dokumentarisch zu sein. Den Film hatte sich weiland Christian Lailach angeschaut, den Comic jetzt Thomas Wörtche.
Als Film war Waltz with Bashir ein Medien-Ereignis. Gefeiert und mit Preisen (Golden Globe 2009, César 2009 und Academy Award-Nominierung) ausgezeichnet, stand doch eher die Machart des Films im Vordergrund des Interesses. Ein „animierter Dokumentarfilm“, der nicht mit authentischen Bildvorlagen arbeitet, die dann etwa „roboskopiert“ (wie der Fachterminus heißt) waren, sondern mit fotorealistischen Bildern, die allesamt manuell bzw. computergestützt gezeichnet sind. Das Verfahren ist so neu nicht, wie man uns das glauben machen wollte, und so unproblematisch schon gar nicht – weil man bei dem Wort „Dokumentar“ grundsätzlich mindestens von authentischen und nicht von generierten Abbildungen ausgeht. Dass Bilder auch im Dokumentarfilm manipuliert, arrangiert oder sonst wie aufbereitet sein können, ist klar und kein Gegenstand der Diskussion. Prompt wurde auch das Argument ins Feld geführt, dass ein gezeichneter Film über die fatale Rolle der israelischen Armee bei den Massakern von Sabra und Shabira 1982 einfach günstiger herzustellen gewesen sei, als ein voll ausgestatteter Kriegsfilm. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn die Frage, warum das Thema von Waltz with Bashir unbedingt nach einer animierten Darstellung verlangt, ist nicht allzu einleuchtend zu beantworten. Das gelingt auch dem „Comic zum Film“ nicht, als der Graphic Novel, zu der die Filmbilder montiert sind.
Anamnese als Kunstwerk
 Der Film und damit auch der Comic versuchen sich an einer Art Anamnese – israelische Soldaten, die damals unter Ariel Scharon im Libanon gekämpft haben, möchten heute, weil von allerlei Traumata gequält, herausfinden, welche Rolle konkret sie persönlich bei den falangistischen Massakern in den Palästinenserlagern Sabra und Shabira gespielt haben. Und damit gehen sie auch der Frage nach, wie bewusst und wie weit mehr als duldend die israelische Armee die Gräuel der Gemayel-Falange möglich gemacht hat. Die komplexe und explosiv aufgeladene historische Situation nach der Ermordung Bashir Gemayels (damals christlich-maronitischer Staatspräsident des Libanons) wird aufgelöst in eine Reihe tiefenpsychologischer, individueller Erkundungen. Aufgelöst auch in die privaten Bilderwelten der handelnden Personen – die Anfangssequenz mit 26 Hunden, die eine Figur quälen, weil sie im Einsatz immer Hunde erschießen musste, oder eine Art Variante von Frauen – Fluten – Körper (à la Theweleit) bei einer anderen Figur, setzen ganz bewusst die Individuen in eine böse historische Situation, die kaum Kongruenzen mit diesen Personen hat. Verdrängung, Indolenz, Ausblendung – das ganze Bündel psychischer Mechanismen, die auch aus Tätern komplexere Entitäten machen, als die Geschichte dann (auch zurecht!!!) urteilt, all das fällt sozusagen den israelischen Soldaten, die doch nur legitimerweise ihren Staat verteidigen wollen, auf die Füße. Und damit auch der Holocaust, wie das Projekt massiv andeutet. Das ist ohne Zweifel ein kluges, mutiges und schmerzhaftes Konzept. Der Comic bemüht sich, mit seiner klugen Panelaufteilung und der sehr gedämpften, virtuosen Farbdramaturgie all diesen Implikationen gerecht zu werden. Aber dennoch wirkt er, gemessen am Film, der ja noch zusätzlich die Optionen von Musik und Schnitt und Tempo hat, seltsam umständlich. Am Anfang seltsam langsam agierend und seltsam ungelenk in seiner didaktischen Machart, in seinem massiven moralischen Anliegen. Ein bisschen wie Schulfunk in Bildern.
Der Film und damit auch der Comic versuchen sich an einer Art Anamnese – israelische Soldaten, die damals unter Ariel Scharon im Libanon gekämpft haben, möchten heute, weil von allerlei Traumata gequält, herausfinden, welche Rolle konkret sie persönlich bei den falangistischen Massakern in den Palästinenserlagern Sabra und Shabira gespielt haben. Und damit gehen sie auch der Frage nach, wie bewusst und wie weit mehr als duldend die israelische Armee die Gräuel der Gemayel-Falange möglich gemacht hat. Die komplexe und explosiv aufgeladene historische Situation nach der Ermordung Bashir Gemayels (damals christlich-maronitischer Staatspräsident des Libanons) wird aufgelöst in eine Reihe tiefenpsychologischer, individueller Erkundungen. Aufgelöst auch in die privaten Bilderwelten der handelnden Personen – die Anfangssequenz mit 26 Hunden, die eine Figur quälen, weil sie im Einsatz immer Hunde erschießen musste, oder eine Art Variante von Frauen – Fluten – Körper (à la Theweleit) bei einer anderen Figur, setzen ganz bewusst die Individuen in eine böse historische Situation, die kaum Kongruenzen mit diesen Personen hat. Verdrängung, Indolenz, Ausblendung – das ganze Bündel psychischer Mechanismen, die auch aus Tätern komplexere Entitäten machen, als die Geschichte dann (auch zurecht!!!) urteilt, all das fällt sozusagen den israelischen Soldaten, die doch nur legitimerweise ihren Staat verteidigen wollen, auf die Füße. Und damit auch der Holocaust, wie das Projekt massiv andeutet. Das ist ohne Zweifel ein kluges, mutiges und schmerzhaftes Konzept. Der Comic bemüht sich, mit seiner klugen Panelaufteilung und der sehr gedämpften, virtuosen Farbdramaturgie all diesen Implikationen gerecht zu werden. Aber dennoch wirkt er, gemessen am Film, der ja noch zusätzlich die Optionen von Musik und Schnitt und Tempo hat, seltsam umständlich. Am Anfang seltsam langsam agierend und seltsam ungelenk in seiner didaktischen Machart, in seinem massiven moralischen Anliegen. Ein bisschen wie Schulfunk in Bildern.
Man könnte vermuten, dass dies an dem eher populären Medium Comic liege, aber Comic, wir wissen es alle, braucht keine Komplexion zu scheuen. Vielmehr scheint mir hier der Comic mit seinen festgefrorenen Bildern auf eine Achillesferse des ganzen Projektes hinzuweisen, die sogar ganz besonders deutlich sichtbar wird: Waltz with Bashir hat einen massiven moralischen Akzent, eine massive didaktische Last, die für eine künstlerische Auseinandersetzung mit einem brisanten Thema zu erdrückend sind. Deswegen der legitimatorische Umweg übers anscheinend „Dokumentarische“, der eben nicht wahrhaftig ist. Und das geht letzten Endes nicht wirklich gut, künstlerisch gesehen.
Thomas Wörtche
Ari Folman/David Polonsky: Waltz with Bashir. Eine Kriegsgeschichte aus dem Libanon.
(Waltz with Bashir, 2008) Graphic Novel. Deutsch von Heinz Freitag.
Zürich: Atrium Verlag 2009. 128 Seiten. 22,00 Euro.
Diesen Artikel können Sie auch in der Printfassung bei unserem Partnermedium, den Literatur Nachrichten N° 101 Sommer 2009 nachlesen.











