 Umhertreiben im grundlosen Kinomeer
Umhertreiben im grundlosen Kinomeer
Blick zurück auf die Berlinale 2018 von Dominique Ott
(Und ganz unten die Links zu unserer weiteren Berlinale-Berichterstattung.)
Wenn eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung ein Kinosaal bereits voll ist, dann muss die Berlinale-Zeit angebrochen sein. „Das einzig Gute am Berliner Winter“, habe ich immer behauptet. Eine Aussage, die ich bereits am Eröffnungstag in Frage stelle, als ich um halb elf Uhr morgens keinen Platz mehr in einem überfüllten Kinosaal finde, während draußen bei wolkenlosem Himmel die Sonne wie sonst nur selten zu dieser Jahreszeit strahlt. Mit den anderen Sitzlosen werde ich zu einem weiteren Kinosaal geschleust, wo zeitgleich ebenfalls der Eröffnungsfilm Isle of Dogs (dt. Ataris Reise) gezeigt wird. Obwohl dieser Saal ebenfalls rappelvoll ist, gelingt es mir, im Gewusel noch einen Kinosessel zu kapern. Man möchte gar nicht glauben, wie viele Menschen über das Festival Bericht erstatten, damit sogar die Pressevorführungen hoffnungslos überrannt sind. In den Sitzreihen scheinen vor allem jene Nationen vertreten, die auf eine traditionsreiche Filmkultur Anspruch erheben: Man hört zunächst Italienisch, viel Französisch, auch Japanisch und Russisch, fast mehr noch als Englisch oder Deutsch. Beim Film wird lauthals gelacht, danach geht es direkt zur Pressekonferenz mit Regisseur, Drehbuchautoren und Cast. Während sich aus der hinteren Hälfte des Saals eine eindrucksvolle Batterie aus mindestens vierzig Kameras auf Wes Anderson und seine Begleiter richten, bleibt der Ton im vorderen Bereich extrem wohlwollend: Man spricht Wes mit Vornamen an, freut sich riesig, dass er bei der Berlinale wieder (zum  vierten Mal) dabei ist. Keine Fragen zu am Rande vorkommenden Themen wie Umweltverschmutzung, Korruption oder gar das Scheitern demokratischer Verfahren in Andersons überzogener Zukunftsvision Japans. Stattdessen möchte man erfahren, wer auf dem Podium Hunde besitzt und welche Hundefilme der Regisseur mag. 101 Dalmatiner liegt ihm besonders am Herzen. Vielleicht hätte er sich lieber Samuel Fullers kontroversen White Dog (dt. Der weiße Hund von Beverly Hills) anschauen sollen, über einen rassistischen weißen Hund, der darauf dressiert wurde, schwarze Menschen zu attackieren. Womöglich hätte Wes dann darauf verzichtet, den Streuner mit schwarzem Fell, Chief (gesprochen von Bryan Cranston), wortwörtlich zu whitewashen und ihn dabei in einen gehorsamen Wachhund zu verwandeln. Während die Schauspieler sich darum bemühen, einander mit Witz zu überbieten, bekommt die Veranstaltung allmählich eine etwas bedrückend entzückende Atmosphäre: Alle freuen sich unheimlich, so große Namen auf der Berlinale begrüßen zu dürfen. Deshalb erstaunt es wenig, dass man Wes Anderson ebenso wohlwollend die Festivalseröffnung wie den silbernen Bären für die beste Regie überlässt.
vierten Mal) dabei ist. Keine Fragen zu am Rande vorkommenden Themen wie Umweltverschmutzung, Korruption oder gar das Scheitern demokratischer Verfahren in Andersons überzogener Zukunftsvision Japans. Stattdessen möchte man erfahren, wer auf dem Podium Hunde besitzt und welche Hundefilme der Regisseur mag. 101 Dalmatiner liegt ihm besonders am Herzen. Vielleicht hätte er sich lieber Samuel Fullers kontroversen White Dog (dt. Der weiße Hund von Beverly Hills) anschauen sollen, über einen rassistischen weißen Hund, der darauf dressiert wurde, schwarze Menschen zu attackieren. Womöglich hätte Wes dann darauf verzichtet, den Streuner mit schwarzem Fell, Chief (gesprochen von Bryan Cranston), wortwörtlich zu whitewashen und ihn dabei in einen gehorsamen Wachhund zu verwandeln. Während die Schauspieler sich darum bemühen, einander mit Witz zu überbieten, bekommt die Veranstaltung allmählich eine etwas bedrückend entzückende Atmosphäre: Alle freuen sich unheimlich, so große Namen auf der Berlinale begrüßen zu dürfen. Deshalb erstaunt es wenig, dass man Wes Anderson ebenso wohlwollend die Festivalseröffnung wie den silbernen Bären für die beste Regie überlässt.
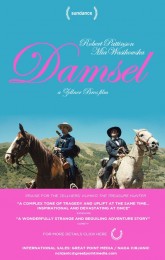 Ein allzu vorhersehbarer Auftakt für einen Wettbewerb, der mich mit wiederholten Enttäuschungen schnell in andere Sektionen gescheucht hat. Entscheidender und früher Tiefpunkt war hierfür Damsel von den Zellner Brothers, der sich als Western-Parodie mit feministischem Twist ausgibt. Trotz vielversprechender Einstiegsszene gelingt ihm de facto weder noch. Mit dem Genre, zu dem Damsel sich positionieren möchte, hat er außer dem Setting des wilden Westens wenig gemeinsam: keine Spur von einem Gesellschaftsquerschnitt – wie er so oft im klassischen Western versucht wurde –, nicht einmal ein shootout und lediglich ein missglückter Versuch, Landschaftsaufnahmen im Stil von Technicolor darzubieten. Die paradigmatische Maxime „Go-West“ kollabiert hier zu einem unentschlossenen und letztlich ziellosen Hin und Her. Dabei wird über Klamauk eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen inszeniert, die nur in einer größeren Enttäuschung münden kann. Das Einzige, zu dem Stellung genommen wird, ist die stereotype Rolle der Frau als ‚damsel in distress‘, die vom Helden gerettet werden muss. In diesem Fall aber möchte die – wohlgemerkt einzige – weibliche Rolle (Penelope, gespielt von einer wütenden Mia Wasikowska) gar nicht gerettet werden. Und das muss sie permanent wiederholen. Anstatt eine Western-Heldin in Szene zu setzen, rückt somit eine unausgearbeitete Figur in den Vordergrund, die weder Ziel noch klare Motivation besitzt, sondern lediglich auf überaus dümmliche Männer reagiert. Sie wird ausschließlich über ihre Fähigkeit, ‚Nein‘ zu sagen, definiert und deshalb nach wie vor nur in Relation zu (und als Negation der) umgebenden Männerfiguren verstanden.
Ein allzu vorhersehbarer Auftakt für einen Wettbewerb, der mich mit wiederholten Enttäuschungen schnell in andere Sektionen gescheucht hat. Entscheidender und früher Tiefpunkt war hierfür Damsel von den Zellner Brothers, der sich als Western-Parodie mit feministischem Twist ausgibt. Trotz vielversprechender Einstiegsszene gelingt ihm de facto weder noch. Mit dem Genre, zu dem Damsel sich positionieren möchte, hat er außer dem Setting des wilden Westens wenig gemeinsam: keine Spur von einem Gesellschaftsquerschnitt – wie er so oft im klassischen Western versucht wurde –, nicht einmal ein shootout und lediglich ein missglückter Versuch, Landschaftsaufnahmen im Stil von Technicolor darzubieten. Die paradigmatische Maxime „Go-West“ kollabiert hier zu einem unentschlossenen und letztlich ziellosen Hin und Her. Dabei wird über Klamauk eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen inszeniert, die nur in einer größeren Enttäuschung münden kann. Das Einzige, zu dem Stellung genommen wird, ist die stereotype Rolle der Frau als ‚damsel in distress‘, die vom Helden gerettet werden muss. In diesem Fall aber möchte die – wohlgemerkt einzige – weibliche Rolle (Penelope, gespielt von einer wütenden Mia Wasikowska) gar nicht gerettet werden. Und das muss sie permanent wiederholen. Anstatt eine Western-Heldin in Szene zu setzen, rückt somit eine unausgearbeitete Figur in den Vordergrund, die weder Ziel noch klare Motivation besitzt, sondern lediglich auf überaus dümmliche Männer reagiert. Sie wird ausschließlich über ihre Fähigkeit, ‚Nein‘ zu sagen, definiert und deshalb nach wie vor nur in Relation zu (und als Negation der) umgebenden Männerfiguren verstanden.
 Ein Wettbewerbsbeitrag, der dann doch Spaß macht, weil er sich selbst längst nicht so ernst nimmt, womöglich aus dem gleichen Grund aber keine Aufmerksamkeit erfährt, ist der iranische Film Khook (dt. Schwein) von Mani Haghighi. Dessen Protagonist Hasan (Hasan Majuni) ist ein großes Mannskind, das ohne die Frauen in seinem Leben (seiner Tochter, seiner Muse Shiva, seiner Stalkerin und natürlich seiner Mama) nicht wüsste, wie er handeln und was er fühlen soll. Als Regisseur, dessen Name auf der sogenannten ‚Blacklist‘ steht, darf er seit zwei Jahren keine Filme mehr machen. Stattdessen ist er dazu verdonnert, Werbespots für Insekten-Spray zu drehen, die er künstlerisch möglichst anspruchsvoll gestaltet. Seiner Lage entsprechend hat er schrecklich Angst davor, in Vergessenheit zu geraten. Als ein Serienmörder dann systematisch seine Kollegen enthauptet, ihn jedoch in Frieden lässt, stürzt Hasan in neurotische Verzweiflung. Gezwungenermaßen muss er sich nun mit social media Portalen auseinandersetzen, um sein öffentliches Image aufrechtzuerhalten bzw. zu retablieren. Mit langen Steadycam-Fahrten wird zu animierender Rockmusik das Bild einer sensationalistischen und hektischen Gesellschaft konstruiert, in der nie jemand ausreden kann, ohne vom Brummen eines Smartphones unterbrochen zu werden. Während man sich über die leeren Parolen und die Aufgesetztheit der Kunstszene mokiert, wird klar, dass nichts wichtiger ist als die öffentliche Wahrnehmung der eigenen Persona. Begriffe wie Privatsphäre haben hier längst ihren Platz verloren. Dem Regisseur Mani Haghighi gelingt eine durchaus beachtenswerte Komödie, welche die eigentlich sehr ernste und durchaus problematische Lage eines Filmschaffenden verhandelt, der seiner Leidenschaft nicht nachgehen darf, während sie durch ihren überzogenen Ton der Zensur im Heimatland entgehen dürfte.
Ein Wettbewerbsbeitrag, der dann doch Spaß macht, weil er sich selbst längst nicht so ernst nimmt, womöglich aus dem gleichen Grund aber keine Aufmerksamkeit erfährt, ist der iranische Film Khook (dt. Schwein) von Mani Haghighi. Dessen Protagonist Hasan (Hasan Majuni) ist ein großes Mannskind, das ohne die Frauen in seinem Leben (seiner Tochter, seiner Muse Shiva, seiner Stalkerin und natürlich seiner Mama) nicht wüsste, wie er handeln und was er fühlen soll. Als Regisseur, dessen Name auf der sogenannten ‚Blacklist‘ steht, darf er seit zwei Jahren keine Filme mehr machen. Stattdessen ist er dazu verdonnert, Werbespots für Insekten-Spray zu drehen, die er künstlerisch möglichst anspruchsvoll gestaltet. Seiner Lage entsprechend hat er schrecklich Angst davor, in Vergessenheit zu geraten. Als ein Serienmörder dann systematisch seine Kollegen enthauptet, ihn jedoch in Frieden lässt, stürzt Hasan in neurotische Verzweiflung. Gezwungenermaßen muss er sich nun mit social media Portalen auseinandersetzen, um sein öffentliches Image aufrechtzuerhalten bzw. zu retablieren. Mit langen Steadycam-Fahrten wird zu animierender Rockmusik das Bild einer sensationalistischen und hektischen Gesellschaft konstruiert, in der nie jemand ausreden kann, ohne vom Brummen eines Smartphones unterbrochen zu werden. Während man sich über die leeren Parolen und die Aufgesetztheit der Kunstszene mokiert, wird klar, dass nichts wichtiger ist als die öffentliche Wahrnehmung der eigenen Persona. Begriffe wie Privatsphäre haben hier längst ihren Platz verloren. Dem Regisseur Mani Haghighi gelingt eine durchaus beachtenswerte Komödie, welche die eigentlich sehr ernste und durchaus problematische Lage eines Filmschaffenden verhandelt, der seiner Leidenschaft nicht nachgehen darf, während sie durch ihren überzogenen Ton der Zensur im Heimatland entgehen dürfte.
 Intellektuelle und Militante
Intellektuelle und Militante
Im Forum geht es dann entschieden intellektueller zu: Einerseits ist da der französische Found Footage Film L’empire de la perfection von Julien Faraut, der beweist, dass die Auseinandersetzung mit auf den ersten Blick belanglosen Bewegtbildern durchaus spannend gestaltet werden kann. Das Material besteht zu achtzig Prozent aus outtakes von einem pädagogischen Dokumentarfilm zum Spiel von Achtzigerjahre Tennislegende John McEnroe. Was zunächst nach einer langwierigen Bewegungsstudie aussieht, entfaltet sich auf Dauer zu einer stimulierenden Reflexion über das Spiel des Spielers und sein Schauspiel, sowie über die Nähe von Spiel und Kino dank deren Verhältnis zu Bewegung (die sie schaffen) und Zeit (die sie gewinnen). Die Kamera bleibt hauptsächlich bei John McEnroe, einem Perfektionisten, der vordergründig gegen sich selber spielt. Dennoch sucht sie am Rande des Spielfelds immer wieder den damaligen Regisseur Gil der Karmadec auf, der seinerseits in das Dokument eingreift, den Fluss bestimmt, das Spiel beeinflusst. Angereichert durch Daney- und Godard-Zitate, indirekte Western- und Tati- sowie direkte Scorsese- und Forman-Referenzen ist L’empire de la perfection ein ebenso großes Vergnügen für Film- wie für Tennisliebhaber. Zum Schluss wendet er sich nochmal letzteren zu, indem er ein Roland-Garros-Finale streng getaktet wiedergibt, um sich selbst nochmals Spannung zu verleihen. Dabei bleibt lediglich die Frage offen, die der Film (nach Godard) an den Anfang stellt: Warum das Kino lügt, nicht aber der Sport.
 Andererseits findet sich im Forum der arrogante Notes on an Appearance von Ricky D’Ambrose, der einer (überwiegend weißen) New Yorker Bourgeoisie und deren Weltfremdheit verhaftet ist. Innerhalb einer verwirrenden Handlung mit verschiedenen Protagonisten in wechselnden Zeitspannen interagieren junge Menschen auf eine durch ihr Milieu scheinbar vorbestimmte und zutiefst befremdliche Weise. Ein unnatürlich künstliches Schauspiel, das nur gewollt sein kann, liefert die Grundlage für oberflächliche Wortwechsel und Begegnungen, die zutiefst von ‚first world problems‘ durchdrungen sind. Zwischengeschnitten werden Bilder von Tagebucheinträgen, Postkarten, mehr oder weniger relevanten Zeitungsartikeln und green screens sowie endlose unbewegte Bilder von Frühstück-Arrangements, die dem ganzen eine Instagram-Ästhetik verleihen. Hinzu kommen Buch- und Videoausschnitte von einem Politikwissenschaftler, über den der erste Protagonist recherchiert; die VHS-Bilder gleichen amateurhaften Ferienaufnahmen. Tatsächlich scheint das Reisen der einzige Ausweg aus dem Geschwafel der privilegierten Manhattan-Jugend, doch selbst das Ausland verbleibt auf einer Postkartenebene, in die sich eine egozentrische Introspektion einschreibt. Regisseur Ricky D’Ambrose hinterlässt den Zuschauer mit einen Gefühl der Unsicherheit: Hat man soeben einer selbstreflexiven Abhandlung der Oberflächlichkeit dieses pseudointellektuellen Milieus beigewohnt oder lediglich seiner unzusammenhängenden Darbietung? Ob man Woody Allen mag oder nicht, zumindest war sein Blick auf das New Yorker Intellektuellen-Dasein dezidiert selbstironisch. Zudem konnte er dessen Probleme bereits vor über 40 Jahren deutlich klarer formulieren.
Andererseits findet sich im Forum der arrogante Notes on an Appearance von Ricky D’Ambrose, der einer (überwiegend weißen) New Yorker Bourgeoisie und deren Weltfremdheit verhaftet ist. Innerhalb einer verwirrenden Handlung mit verschiedenen Protagonisten in wechselnden Zeitspannen interagieren junge Menschen auf eine durch ihr Milieu scheinbar vorbestimmte und zutiefst befremdliche Weise. Ein unnatürlich künstliches Schauspiel, das nur gewollt sein kann, liefert die Grundlage für oberflächliche Wortwechsel und Begegnungen, die zutiefst von ‚first world problems‘ durchdrungen sind. Zwischengeschnitten werden Bilder von Tagebucheinträgen, Postkarten, mehr oder weniger relevanten Zeitungsartikeln und green screens sowie endlose unbewegte Bilder von Frühstück-Arrangements, die dem ganzen eine Instagram-Ästhetik verleihen. Hinzu kommen Buch- und Videoausschnitte von einem Politikwissenschaftler, über den der erste Protagonist recherchiert; die VHS-Bilder gleichen amateurhaften Ferienaufnahmen. Tatsächlich scheint das Reisen der einzige Ausweg aus dem Geschwafel der privilegierten Manhattan-Jugend, doch selbst das Ausland verbleibt auf einer Postkartenebene, in die sich eine egozentrische Introspektion einschreibt. Regisseur Ricky D’Ambrose hinterlässt den Zuschauer mit einen Gefühl der Unsicherheit: Hat man soeben einer selbstreflexiven Abhandlung der Oberflächlichkeit dieses pseudointellektuellen Milieus beigewohnt oder lediglich seiner unzusammenhängenden Darbietung? Ob man Woody Allen mag oder nicht, zumindest war sein Blick auf das New Yorker Intellektuellen-Dasein dezidiert selbstironisch. Zudem konnte er dessen Probleme bereits vor über 40 Jahren deutlich klarer formulieren.
 Dann doch lieber nach Japan, zum Beispiel mit der zurückhaltenden Studentenproduktion Watashitachi no ie von Yui Kiyohara. Ein Haus, zwei Geschichten, vier Frauen. Auf der einen Seite sind da die alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter Serie, auf der anderen Sana, die ihr Gedächtnis verloren hat und von Toko aufgenommen wird – ein Gewohnheitstier, das aus mysteriösen Gründen Kleidung von Kleinkindern flickt. Sie alle haben ihre Vergangenheit und Geheimnisse, die im wiedergegebenen Alltag jedoch ausbleiben und wie verdrängte Gespenster in den Wänden des alten Hauses für eine Atmosphäre sorgen, bei der man jederzeit ihre Rückkehr befürchtet. Die beiden Duos treffen sich nie: Sie leben in den selben vier Wänden, aber in zwei verschiedenen Welten. Dennoch gibt es klare Berührungspunkte zwischen ihnen, die Geschichte der einen sucht die der anderen heim und umgekehrt: Serie wartet besonders an Feiertagen vergebens auf ihren Vater, während bei Toko und Sana ein merkwürdiger Mann auftaucht, der behauptet, sie zu kennen. Hinzu kommen ein Geschenk ohne Adressaten und eine Vase, deren eigenartige Form Serie bemerkt, und deren mysteriöse Bildpräsenz an die endlos besprochene Vase in Ozus Banshun erinnert. Vom Großmeister scheint Regisseurin Yui Kiyohara sich auch auf gestalterischer Ebene zu inspirieren: Bei langen, unbewegten und gesetzten Einstellungen entfalten sich zwischenmenschliche Beziehungen im eigenen Heim. Mit dieser behutsamen und offenen Herangehensweise gelingt es Watashitachi no ie, Kinobesucher auch nach dem Film lange Zeit immer wieder heimzusuchen.
Dann doch lieber nach Japan, zum Beispiel mit der zurückhaltenden Studentenproduktion Watashitachi no ie von Yui Kiyohara. Ein Haus, zwei Geschichten, vier Frauen. Auf der einen Seite sind da die alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter Serie, auf der anderen Sana, die ihr Gedächtnis verloren hat und von Toko aufgenommen wird – ein Gewohnheitstier, das aus mysteriösen Gründen Kleidung von Kleinkindern flickt. Sie alle haben ihre Vergangenheit und Geheimnisse, die im wiedergegebenen Alltag jedoch ausbleiben und wie verdrängte Gespenster in den Wänden des alten Hauses für eine Atmosphäre sorgen, bei der man jederzeit ihre Rückkehr befürchtet. Die beiden Duos treffen sich nie: Sie leben in den selben vier Wänden, aber in zwei verschiedenen Welten. Dennoch gibt es klare Berührungspunkte zwischen ihnen, die Geschichte der einen sucht die der anderen heim und umgekehrt: Serie wartet besonders an Feiertagen vergebens auf ihren Vater, während bei Toko und Sana ein merkwürdiger Mann auftaucht, der behauptet, sie zu kennen. Hinzu kommen ein Geschenk ohne Adressaten und eine Vase, deren eigenartige Form Serie bemerkt, und deren mysteriöse Bildpräsenz an die endlos besprochene Vase in Ozus Banshun erinnert. Vom Großmeister scheint Regisseurin Yui Kiyohara sich auch auf gestalterischer Ebene zu inspirieren: Bei langen, unbewegten und gesetzten Einstellungen entfalten sich zwischenmenschliche Beziehungen im eigenen Heim. Mit dieser behutsamen und offenen Herangehensweise gelingt es Watashitachi no ie, Kinobesucher auch nach dem Film lange Zeit immer wieder heimzusuchen.
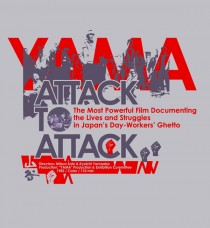 Den ästhetischen Gegenpol hierzu bietet der ebenfalls aus Japan stammende Yama – Attack to Attack, der ebenso rastlos und kämpferisch vorgeht wie seine Kameraführung. Dieser Dokumentarfilm von 1984 zeigt das damalige Milieu der Tagelöhner aus San’ya, einem Arbeiterviertel in Tokyo. Zu der Zeit regierte eine nationalistische Yakuza-Gang den Tagelöhnermarkt, kontrollierte die Bezahlung in Absprache mit Arbeitgebern und organisierte auf der Straße Glücksspiel, um den Tagarbeitern nach Feierabend nochmals einen Teil ihres mickrigen Einkommens abzuknüpfen. Als Gegenmaßnahme gründeten diese dann Gewerkschaften, um ihren Arbeitgebern und den Yakuza die Stirn zu bieten. Yama ist keine mitleiderregende Reportage über das Leben der Tagelöhner in Japan, sondern ein militanter Film, der an ihrem Kampf teilhat: Zusammen mit Gewerkschaftsvertretern werden Firmenleiter aufgesucht, zur Rede gestellt, vor laufender Kamera beschimpft und unter Druck gesetzt, bis sie nachgeben und auf die gestellten Forderungen eingehen. Auch bei Straßenkämpfen zwischen Tagelöhnern und Yakuza oder der Polizei befindet sich die Kamera stets mitten im Geschehen. Angeblich werden hier nur Gewerkschaftler verhaftet, keine Yakuza. Sicher ist, dass die Tagelöhner von der Regierung keine Unterstützung erhalten, diese erkennt Son’ya nicht mal mehr als Stadtviertel an. Yama resultiert in einem anstrengenden, aber wundervollen Durcheinander, für das gleich zwei Regisseure (Mitsuo Sato kurz nach Drehbeginn, Kyoichi Yamaoka einige Monate nach Fertigstellung des Films) ihr Leben geben mussten. Man sollte sich glücklich schätzen, dass sein Produzent bis heute mit 16 mm Kopien im Gepäck durch Japan zieht (zum Anlass der Berlinale ausnahmsweise auch nach Deutschland), um ihn vorzuführen.
Den ästhetischen Gegenpol hierzu bietet der ebenfalls aus Japan stammende Yama – Attack to Attack, der ebenso rastlos und kämpferisch vorgeht wie seine Kameraführung. Dieser Dokumentarfilm von 1984 zeigt das damalige Milieu der Tagelöhner aus San’ya, einem Arbeiterviertel in Tokyo. Zu der Zeit regierte eine nationalistische Yakuza-Gang den Tagelöhnermarkt, kontrollierte die Bezahlung in Absprache mit Arbeitgebern und organisierte auf der Straße Glücksspiel, um den Tagarbeitern nach Feierabend nochmals einen Teil ihres mickrigen Einkommens abzuknüpfen. Als Gegenmaßnahme gründeten diese dann Gewerkschaften, um ihren Arbeitgebern und den Yakuza die Stirn zu bieten. Yama ist keine mitleiderregende Reportage über das Leben der Tagelöhner in Japan, sondern ein militanter Film, der an ihrem Kampf teilhat: Zusammen mit Gewerkschaftsvertretern werden Firmenleiter aufgesucht, zur Rede gestellt, vor laufender Kamera beschimpft und unter Druck gesetzt, bis sie nachgeben und auf die gestellten Forderungen eingehen. Auch bei Straßenkämpfen zwischen Tagelöhnern und Yakuza oder der Polizei befindet sich die Kamera stets mitten im Geschehen. Angeblich werden hier nur Gewerkschaftler verhaftet, keine Yakuza. Sicher ist, dass die Tagelöhner von der Regierung keine Unterstützung erhalten, diese erkennt Son’ya nicht mal mehr als Stadtviertel an. Yama resultiert in einem anstrengenden, aber wundervollen Durcheinander, für das gleich zwei Regisseure (Mitsuo Sato kurz nach Drehbeginn, Kyoichi Yamaoka einige Monate nach Fertigstellung des Films) ihr Leben geben mussten. Man sollte sich glücklich schätzen, dass sein Produzent bis heute mit 16 mm Kopien im Gepäck durch Japan zieht (zum Anlass der Berlinale ausnahmsweise auch nach Deutschland), um ihn vorzuführen.
 Dokumente der Marginalisierten
Dokumente der Marginalisierten
Im Panorama sind es ebenfalls Dokumentarfilme, die besonders hervorstechen. Nennenswert ist hier Al Gami’ya, der jahrelang verschiedene Bewohner eines der ärmsten Viertel Kairos begleitet, die sich aus finanzieller Motivation als Gruppe zusammenfinden. Dabei handelt es sich gewissermaßen um eine – auf dem Afrikanischen Kontinent sehr gängige – selbstauferlegte Kollektivsparmaßnahme, bei der jedes Mitglied regelmäßig einen festgelegten Betrag einzahlt, um der Reihenfolge nach (der Dringlichkeit entsprechend) einmalig das angesammelte Geld der ganzen Gruppe ausgezahlt zu bekommen. Über sieben Jahre hinweg hat die Regisseurin Reem Saleh immer wieder ihre diversen Protagonisten aufgesucht, um deren Geschichte weiterzuverfolgen. Das Ergebnis sind viele Szenen, in denen gesprächige Figuren ihr Leid schildern, wobei man zeitweise den Eindruck bekommt, zu tief in ihr Privatleben vorzudringen. Umso positiver wirken Augenblicke der Ruhe, beeindruckende Bilder eines armen und heruntergekommenen, dafür lebendigen Kairos, sowie zahlreiche Momente des Lachens und des Feierns. „Zeig der Welt, dass man selbst den ärmsten Ägyptern das Tanzen nicht austreiben kann!“ ruft eine Großmutter der nicht einmal zehnjährigen Dunja zu, die für die Kamera beeindruckende Bauchtanzbewegungen aneinanderreiht. Das kleine Mädchen liebt die Aufmerksamkeit und weiß sich bestens zu inszenieren. Ihre enthusiastische Schilderung, wie sie sich trotz des Verbots ihres Vaters hat beschneiden lassen, vergisst niemand so schnell. Als der Vater davon erfährt, bricht ein Streit mit der Mutter aus, sie fangen an sich zu schlagen, dann zu lachen. Die Szene war für die Zuschauer nachgestellt, das Paar hat sich inzwischen wieder versöhnt. So verläuft nur eine von mehreren durchaus willkommenen Szenen, welche die Präsenz der Kamera und ihren Einfluss auf das Verhalten der Protagonisten ausstellen. Mit der Zeit wird klar, dass sich im Viertel alle bestens kennen und ihre einzelnen Geschichten innerhalb der Community verknüpft sind. Sie wirken wie eine große Familie, in der miteinander gestritten und gelacht wird und der man für die Offenheit danken möchte, mit der sie die Kamera bei sich empfangen.
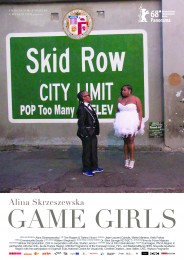 Alina Skrzeszewskas Game Girls handelt ebenfalls vom Leben in einem armen Viertel, dem Skid Row in Los Angeles, der ‚homeless capital‘ der USA. Hier herrscht jedoch ein ganz anderer Ton: Pausenlos wird geschrien und gestritten, niemals Schwäche gezeigt. Von diesem Milieu sieht man allerdings verhältnismäßig wenig, denn eigentlich steht hier das lesbische Paar aus Teri und Tiahna im Fokus. Deren Ziel besteht wiederum darin – wie scheinbar bei allen, die in den zurückgelassenen (neighbor)hoods der Vereinigten Staaten leben –, möglichst schnell davon weg zu kommen. Kein einfaches Unternehmen, denn Tiahna wurde gerade erst aus dem Gefängnis entlassen (weshalb sie dort war, wird nur angedeutet) und Teri bekommt regelmäßig ernsthafte Wutanfälle, wegen derer sie später ebenfalls dort landet. Trotzdem stellt sie sich mit bemerkenswerter Geduld zahlreichen bürokratischen Hürden, um Anspruch auf Sozialwohungsbeihilfe zu erhalten. Einmal leisten sich die beiden einen Ausflug nach Las Vegas: Während sie sich dort die Springbrunnen anschauen, wirkt momentan alles gut in ihrer Welt. Die Szene wäre schrecklich kitschig, wenn man nicht direkt im Anschluss Zeuge häuslicher Gewalt würde. Leider erhält das Publikum keinen richtigen Einblick in das Leben der Game Girls Terri und Tiahna, höchstens vereinzelte Eindrücke, aus denen kein zusamenhängendes Ganzes entsteht. Man würde gerne mehr verstehen über ihr Milieu, ihren Werdegang und ihre Probleme. Dass sie mehr Unterstützung bräuchten, als welche die Therapiestunden hergeben, in denen Terri immer wieder mit Kinderspielzeug unwillkürliche Assoziationen knüpfen soll, scheint jedoch offensichtlich.
Alina Skrzeszewskas Game Girls handelt ebenfalls vom Leben in einem armen Viertel, dem Skid Row in Los Angeles, der ‚homeless capital‘ der USA. Hier herrscht jedoch ein ganz anderer Ton: Pausenlos wird geschrien und gestritten, niemals Schwäche gezeigt. Von diesem Milieu sieht man allerdings verhältnismäßig wenig, denn eigentlich steht hier das lesbische Paar aus Teri und Tiahna im Fokus. Deren Ziel besteht wiederum darin – wie scheinbar bei allen, die in den zurückgelassenen (neighbor)hoods der Vereinigten Staaten leben –, möglichst schnell davon weg zu kommen. Kein einfaches Unternehmen, denn Tiahna wurde gerade erst aus dem Gefängnis entlassen (weshalb sie dort war, wird nur angedeutet) und Teri bekommt regelmäßig ernsthafte Wutanfälle, wegen derer sie später ebenfalls dort landet. Trotzdem stellt sie sich mit bemerkenswerter Geduld zahlreichen bürokratischen Hürden, um Anspruch auf Sozialwohungsbeihilfe zu erhalten. Einmal leisten sich die beiden einen Ausflug nach Las Vegas: Während sie sich dort die Springbrunnen anschauen, wirkt momentan alles gut in ihrer Welt. Die Szene wäre schrecklich kitschig, wenn man nicht direkt im Anschluss Zeuge häuslicher Gewalt würde. Leider erhält das Publikum keinen richtigen Einblick in das Leben der Game Girls Terri und Tiahna, höchstens vereinzelte Eindrücke, aus denen kein zusamenhängendes Ganzes entsteht. Man würde gerne mehr verstehen über ihr Milieu, ihren Werdegang und ihre Probleme. Dass sie mehr Unterstützung bräuchten, als welche die Therapiestunden hergeben, in denen Terri immer wieder mit Kinderspielzeug unwillkürliche Assoziationen knüpfen soll, scheint jedoch offensichtlich.
 Eine ganz andere Herangehensweise an eine weitere marginalisierte Gruppe der USA bringt Land von Babak Jalali, eine internationale Koproduktion, an der gerade das betroffene Land nicht beteiligt war. Irgendwo in dessen vergessener Mitte lebt die Familie Yellow Eagle auf der fiktiven ‚Prairie Wolf Reservation‘. Selten wird sich heute noch in Spielfilmen derart Zeit genommen, um mit langen dokumentaresken Aufnahmen das Milieu, die Arbeit, die familiären Strukturen, die Figuren und ihre von den Jahren gezeichneten Gesichter zu porträtieren. Der erste Bruder Wesley ist Alkoholiker und wird täglich von seiner Mutter aus dem Reservat gefahren (dort ist Alkohol verboten), um seiner Sucht nachgehen zu können. Nachdem der jüngste Bruder Floyd in Afghanistan gefallen ist, liegt es an dem übrig gebliebenen Bruder Raymond, die Dinge in die Hand zu nehmen. Raymond muss sich nicht nur um seinen Sohn sorgen, er sieht sich zudem mit einer US-Armee konfrontiert, die ihm erzählt, Floyd hätte sich umbringen lassen, weshalb seine Familie kein Anrecht auf die vorgesehene Kompensation hat. Als Wesley dann noch zusamengeschlagen wird, bietet sich die Option Polizei für die Familie nicht einmal an. Land zeichnet eine abgrundtiefe Kluft zwischen native americans, die sich auf ihr Reservat zurückziehen, und dem sie umgebenden Land, das sie auch heute weiterhin ausbeutet, obwohl sie sich ihm in keinster Weise zugehörig fühlen.
Eine ganz andere Herangehensweise an eine weitere marginalisierte Gruppe der USA bringt Land von Babak Jalali, eine internationale Koproduktion, an der gerade das betroffene Land nicht beteiligt war. Irgendwo in dessen vergessener Mitte lebt die Familie Yellow Eagle auf der fiktiven ‚Prairie Wolf Reservation‘. Selten wird sich heute noch in Spielfilmen derart Zeit genommen, um mit langen dokumentaresken Aufnahmen das Milieu, die Arbeit, die familiären Strukturen, die Figuren und ihre von den Jahren gezeichneten Gesichter zu porträtieren. Der erste Bruder Wesley ist Alkoholiker und wird täglich von seiner Mutter aus dem Reservat gefahren (dort ist Alkohol verboten), um seiner Sucht nachgehen zu können. Nachdem der jüngste Bruder Floyd in Afghanistan gefallen ist, liegt es an dem übrig gebliebenen Bruder Raymond, die Dinge in die Hand zu nehmen. Raymond muss sich nicht nur um seinen Sohn sorgen, er sieht sich zudem mit einer US-Armee konfrontiert, die ihm erzählt, Floyd hätte sich umbringen lassen, weshalb seine Familie kein Anrecht auf die vorgesehene Kompensation hat. Als Wesley dann noch zusamengeschlagen wird, bietet sich die Option Polizei für die Familie nicht einmal an. Land zeichnet eine abgrundtiefe Kluft zwischen native americans, die sich auf ihr Reservat zurückziehen, und dem sie umgebenden Land, das sie auch heute weiterhin ausbeutet, obwohl sie sich ihm in keinster Weise zugehörig fühlen.
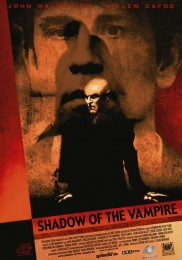 Filmische und eigene Reflexionen
Filmische und eigene Reflexionen
Während es mir nicht mehr gelingt, für die Retrospektive Karten zu ergattern, fühle ich mich letztlich in der Hommage an Willem Dafoe am meisten zu Hause. Das mag daran liegen, dass hier Filme gezeigt werden, welche eine gewisse Zeit überdauert haben und somit nicht ganz so willkürlich ausgewählt scheinen wie in anderen Sektionen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man sich hier noch in der weichen Textur der einen oder anderen 35 mm Kopie wiegen darf (inzwischen auf der Berlinale eine absolute Rarität). Oder eben damit, dass all die Filme, die ich in dieser Kategorie sehen konnte, das Medium Film selbst problematisieren. Nennenswert ist hier Shadow of the Vampire, eine skurrile Komödie, welche die Entstehungsgeschichte von Nosferatu fiktionalisiert, um die vampirischen Eigenschaften von Film allgemein aufzuzeigen: Er saugt einem Leben aus und verspricht dabei Unsterblichkeit. Zudem praktiziert er einen obsessiven Voyeurismus, der in E. Elias Merhiges ersten von nur zwei Langspielfilmen für entsprechend leidenschaftliche Bilder des Filme-Machens sorgt. Noch eindrucksvoller ist Paul Schraders Auto Focus, ein Film von 2002, dem es anfangs gelingt auszusehen, als würde er aus den späten Sechzigern stammen. Dort setzt er auch ein und erzählt in kräftigen Farben und mit souveräner Kameraführung das Leben des liebenswerten Radioshow-Hosts und Schauspielers Bob Crane. Alles läuft traumhaft in dessen (film)bildhafter Welt: Er lebt mit Frau und Kindern in einem große Haus, er liebt seine Arbeit und seine neue TV-Serie Hogan’s Heroes ist ein Hit. Eines Tages begegnet er jedoch John Henry Carpenter (Willem Dafoe), der ihn mit einer gefährlichen Kombination vertraut macht: Sex und (die damals erst entstehende) Videotechnik. Zwischen beiden entsteht eine eigenartige Freundschaft mit homoerotischen Untertönen, in deren Rahmen Bob zunehmend seinen Status als Fernsehstar ausnutzt, um Frauen ins Bett zu kriegen. Mit der Zeit entwickelt er die Obsession, sich dabei auf Video aufzunehmen. Ihm erscheint das ganz natürlich; er sieht nicht ein, wieso Familie und Arbeitgeber wie Disney damit Probleme haben. Mit seiner wachsenden Sucht gewinnt die VHS-Ästhetik jedoch allmählich  Oberhand und geht sogar in die Bildgestaltung von Auto Focus über. Spätestens wenn Bob nur noch in entsättigten Farben bei überbelichteter Wackelkamera zu sehen ist, wird klar, dass überhaupt nichts mehr richtig läuft in seiner Welt. Schrader gestaltet das gnadenlose Bild einer dekadenten Videoästhetik, die in den frühen Zweitausenderjahren bereits an ihrem unweigerlichen Endpunkt angelangt war.
Oberhand und geht sogar in die Bildgestaltung von Auto Focus über. Spätestens wenn Bob nur noch in entsättigten Farben bei überbelichteter Wackelkamera zu sehen ist, wird klar, dass überhaupt nichts mehr richtig läuft in seiner Welt. Schrader gestaltet das gnadenlose Bild einer dekadenten Videoästhetik, die in den frühen Zweitausenderjahren bereits an ihrem unweigerlichen Endpunkt angelangt war.
Was mag das heißen, dass ich mich auf der Berlinale umso aufgehobener fühle, je weiter weg ich mich vom Wettbewerb bewege? Ich werde den Eindruck nicht los, man möchte zu viel auf einmal in diesem Berliner Winter: die Hollywoodstars auf dem roten Teppich und aufstrebende, bisher unbekannte Filmschaffende im Rampenlicht paradieren lassen, ein Aufeinandertreffen von Beiträgen aus aller Welt und eine Plattform für den Deutschen Film bieten, Ort für die Neuentdeckung alter Klassiker und Treffpunkt für die Filmindustrie sein (wo Verleihrechte ausgehandelt und Fördergelder für zukünftige Produktionen gefunden werden), Kino-Programm sowie TV-Serien, Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, Spaziergänge und kulinarische Extravaganzen anbieten, Filme mit politischem Gegenstand belohnen und die Nähe zum Publikum wahren, die prestigereiche Berlinale und zugleich ihre Gegenveranstaltung sein. Vielleicht ist dann ja für alle etwas dabei. Aber angesichts eines solchen Konvoluts blickt erstens keiner mehr durch, sodass es ein Ding der Unmöglichkeit wird, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, und zweitens bleibt notgedrungen etwas auf der Strecke. Hier der Verdacht, dass es vor allem diejenigen sind, die eben nicht bereits der Filmwelt angehören und vor einem derartigen Moloch zurückschrecken. Denn für ein Festival, dass sich als Publikumsfestival versteht, erscheint mir die Berlinale erstaunlich unzugänglich: Zu viele undurchschaubare Kategorien sowie zu verleihende Preise (über 50 an der Zahl), zu wenige Vorstellungen der einzelnen Filme, sodass die Jagd nach Karten sich oftmals in eine Lotterie verwandelt. Hinzu kommen die jährlich ansteigenden Preise, die inzwischen mit 12€ für reguläre und 15€ für Wettbewerbsvorstellungen (ohne mögliche Ermäßigungen, außer ’nach Verfügbarkeit‘ an der Tageskasse) doch nur ein recht auserwähltes Publikum ansprechen. Angesichts der noch unsicheren künftigen Leitung der Berliner Filmfestspiele wäre es an der Zeit darüber nachzudenken, welchen Weg das Festival in Zukunft einschlagen soll. Denn die inkonsequente Logik des ‚alles unter einen Hut bringen‘ raubt ihm gegenwärtig jegliche Brisanz. Künftig also bitte ohne kulinarische Kinoerfahrung für 95€.
Dominique Ott
Unsere weitere Berlinale-Berichterstattung 2018:
Katrin Doerksen: Berlinale-Tagebuch (III): Es gibt nichts Uninteressantes auf der Welt
Katrin Doerksen: Berlinale-Tagebuch (II): Wo noch Zeichen und Wunder geschehen
Katrin Doerksen: Berlinale-Tagebuch (I): Der nasse Glanz der Scherben
Katrin Doerksen: Vorauswahl: Hundertundein Fenster zur Welt
Dominique Ott: Vorschau: Erwartungsvoll
Zur Berlinale 2017 hier.











