
Bücher kurz serviert
Kurzbesprechungen von fiction – Unsere Rubrik „non fiction, kurz“ finden Sie in dieser Ausgabe nebenan. Hier Hanspeter Eggenberger (hpe), Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM), Kolja Mensing (KM), Ulrich Noller (UN), Jan Christian Schmidt (jcs) und Thomas Wörtche (TW) über:
Larry Beinhart: American Hero
Lawrence Block: Kellers Hitparade
Robert E. Dunn: Dead Man’s Badge
Robert Harris: Der zweite Schlaf
Doug Headline, Max Cabanes: Nada
David Ignatius: Quantum Spy
Richard Lorenz: Hinter den Gesichtern
Ian McEwan: Die Kakerlake
Ottessa Moshfegh: Heimweh nach einer anderen Welt
Steven Price: Die Frau in der Themse
Anthony J. Quinn: Gestrandet
Melanie Raabe: Die Wälder
Carlos Sampayo und José Muñoz: Alack Sinner
Yishai Sarid: Limassol

Wieder mehr als aktuell
(jcs) Das ist ’n Ding – Larry Beinhart ist wieder da! Der Frankfurter Westend Verlag wagt sich an eine Neuausgabe des Klassikers American Hero von 1993, der unter dem Titel „Wag the Dog“ in Starbesetzung verfilmt wurde. Es ist die Zeit der Präsidentschaft von George H. W. Bush (das war der Ältere), der – im Roman / Film – angeschlagen von einem Sex-Skandal um seine Wiederwahl fürchten muss. Hilfe verspricht ein Notfallplan, den sein genialer Berater Lee Atwater auf dem Sterbebett entwickelt hat: Das Drehbuch zu einem kleinen, sauber designtem Krieg mit glasklaren Fronten zwischen Gut und Böse, der in Hollywood inszeniert wird.
Beinharts kapitale Polit-Satire – mit unzähligen Anmerkungen in Fußnoten versehen, die zum Teil auf Tatsachen verweisen, zum Teil wieder rein fiktiv und damit Bestandteil der Narration sind – fügt sich prima in die aktuelle Debatte um Fakenews und „alternative Wahrheiten“. Ob die Neuausgabe nach einem Vierteljahrhundert wirklich reüssiert, muss man sehen: Colin Powell hat American Hero schon 2003 überholt und gezeigt, dass eine kurze Powerpoint-Präsentation vor den Vereinten Nationen reicht, um mit der Welt Schlitten zu fahren. Wir drücken dem Verlag und dem Autor die Daumen!
- Larry Beinhart: American Hero (American Hero, 1993). Übersetzt von Jürgen Bürger und Peter Torberg. Überarbeitete und ergänzte Ausgabe, neuer Schluss. Westend Verlag, Frankfurt 2020. Klappenbroschur, 320 Seiten, 17,95 Euro.

Großer Zyklus mit Subtext
(TW) Die beiden Argentinier Carlos Sampayo und José Muñoz haben mit dem Alack Sinner-Zyklus in den Jahren 1975 bis 2006 einen epischen Meilenstein der Graphic Novel geschaffen, der erst jetzt vollständig auf Deutsch zu bewundern ist. Alack Sinner ist ein Ex-Cop, der sich jetzt als Privatdetektiv in New York durchschlägt. Ein ganz und gar imaginiertes New York, das die beiden Künstler zunächst gar nicht kannten. Ein New York, das vor (Polizei-)Gewalt, Rassismus, sozialem Gefälle und faschistoidem Denken vibriert. Alack Sinner, wie schon der Name sagt, ist wahrlich kein Unschuldslamm, aber er hat Haltung inmitten einer haltlosen Welt. Auch wenn seine Fälle in den Peripherien der Gesellschaft beginnen, sie enden meistens in Gegenden, in denen Politik und Macht zusammenlaufen. Deswegen enden sie auch nicht immer glücklich.
Zur Überzeugungskraft von derlei Stories über einen explizit „linken“ Privatdetektiv (der zwei Jahre vor dem Auftauchen von Roger L. Simons dauerkiffendem Hippie-Detektiv Moses Wine entstand), brauchte es eine kräftige Bildsprache, für die José Muñoz‘ holzschnittartige schwarz-weiß Panels benutzte, die ihrerseits eine Menge zusätzliche Bildkontexte aufrufen – von Frans Masereel über Georg Grosz und Alberto Breccia bis zur Harlem Renaissance. Letztere wiederum bildet die Klammer zu einem anderen, ständig präsenten Subtext, dem Jazz (dem das Duo später eigene Comics widmete: „Billie Holiday“ oder „Fats Waller“ zum Beispiel), der den organischen Soundtrack zu den Geschichten liefert. Alack Sinner versucht nicht realistisch zu sein, sondern visionär und halluzinant. Das macht den Zyklus zu einem großen Kunstwerk.
- Carlos Sampayo und José Muñoz: Alack Sinner. Deutsch von André Höchemer. Avant Verlag, Berlin 2019. Gebunden, 704 Seiten, 49 Euro.
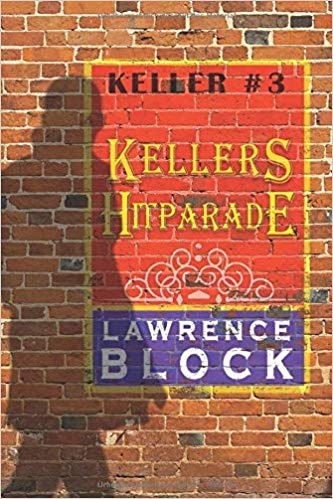
Killer und Briefmarkensammler
(hpe) Irgendwie macht John Keller sein Job nicht mehr so richtig Spaß. Die neuen Sicherheitsmaßnahmen überall nach 9/11 machen einem Hit Man, einem Auftragskiller, den Berufsalltag schwer. Dafür geht Keller als freiwilliger Helfer an Ground Zero Essen an diejenigen austeilen, welche dort die Leichen bergen.
Den Killer Keller hat der große New Yorker Autor Lawrence Block für Shortstorys im amerikanischen Playboy erfunden. Vor zwanzig Jahren hat er diese Geschichten im Band »Hit Man« (Deutsch: »Kellers Metier«) zusammengefasst. Diesem ließ er weitere Keller-Bände folgen, von denen nach dem zweiten (»Hit List«, Deutsch: »Kellers Konkurrenz«) jetzt der dritte erstmals auf Deutsch erschienen ist: Kellers Hitparade. Da werden zwar nicht Shortstorys weiterverwertet, aber es ist dennoch ein Episodenroman, bei dem einzelne Geschichten nur lose verknüpft sind. Etwa dadurch, das Keller langsam aber sicher ein bisschen genug hat von seinem Job.
Aber er kann ja nichts anderes, und darum muss er damit erst noch genug für den Rest seines Lebens verdienen. Und für ein paar Neuerwerbungen für seine Briemarkensammlung, Spezialgebiert französische Kolonien. Alles macht er deswegen noch nicht. Auch wenn er seinen Job strikt als Business betrachtet, bei dem Moral keine Rolle spielt, hält er sich an eine Art Ehrenkodex. »Für einen Soziopathen wäre so was wesentlich einfacher«, denkt er schon mal. »Wirklich schade, dass es dafür keine Kurse gab, nach deren Abschluss man vielleicht sogar ein Zertifikat als geprüfte soziopathische Persönlichkeit bekam.« Kinder etwa bringt Keller nicht um. Frauen schon. »Du warst ja schon immer für Gleichberechtigung«, stellt seine Agentin Dot dazu fest. Mit ihr trinkt er auf der Veranda ihres Hauses im New Yorker Vorort White Plains Eistee. Dabei werden die Jobs besprochen. Oft erfahren wir erst hier, wie Keller diese oder jede Zielperson in die ewigen Jagdgründe beförderte.
Ziemlich kompliziert wurde der seltsame Auftrag, einen Hund zu töten. Dieser hatte im Central Park die Hunde von zwei Freundinnen getötet. Bevor Keller aber den Auftrag erfüllen kann, bezahlt ihn die eine Frau dafür, die andere umzubringen. Und diese beauftragt ihn, die andere umzubringen, und zwar zusammen mit ihrem eigenen Mann, der mir ihrer Freundin ein Verhältnis habe. Keller kassiert überall ab und hinterlässt ein Schlachtfeld.
Lakonie und staubtrockener Humor tragen neben den originellen kleinen Plots bei «Kellers Hitparade» wesentlich zum Lesevergnügen bei. Ein besonderer Reiz liegt in den Veranda-Gesprächen in White Plain, bei denen Keller oft eher wortkarg bleibt. «Du bist mir vielleicht einer», sagt Dot einmal. Er habe doch gar nichts gesagt, antwortet er. »Es war die Art, wie du nichts gesagt hast«, sagt sie. »Das hat Bände gesprochen.«
- Lawrence Block: Kellers Hitparade (Hit Parade, 2006). Aus dem Englischen von Sepp Leeb. LB Productions, New York 2019. 278 Seiten, 15,31 Euro.
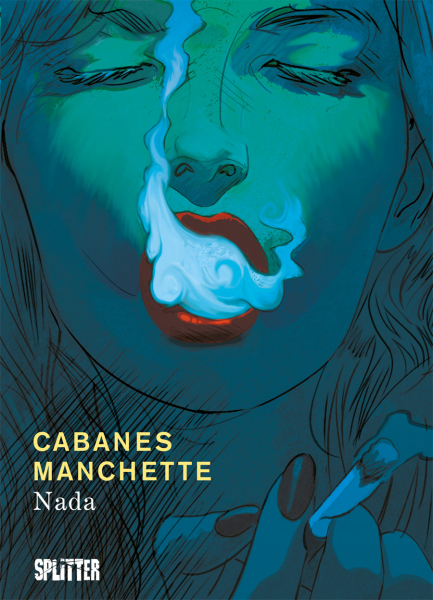
Vielleicht ein grundsätzliches Problem
(TW) Doug Headline, der Sohn von Jean-Patrick Manchette, hat mit dem Zeichner Max Cabanes Manchettes wohl berühmtesten Roman, Nada (Splitter, dt. von Tanja Krämling), als Graphic Novel adaptiert, ein Duo, das sich auch schon der »Blutprinzessin« und »Fatale« angenommen hatte. Der Comic folgt mit seinen fahlen Farben und den blutroten Akzenten der Story von Manchette ziemlich genau, ohne allzu sehr auf die Chabrol-Verfilmung zu rekurrieren (naja, ein bisschen schon), aber was die Bilder nicht rüberbringen, ist die ätzend sarkastische Komik, mit der Manchette seine Abrechnung mit dem politischen Terrorismus einer diffus gewordenen Linken mit seinen sprachlichen Minimalismen inszeniert hat.
Der Vorteil von vielen Comic-Adaptionen ist oft, dass sie gegenüber der Romanvorlage mehr oder andere Sinndimensionen ins Spiel bringen können, hier kann ich keine erkennen, weniger ist hier in der Tat weniger. Nada, der Comic, bebildert »Nada«, den Roman. Aber das ist vielleicht ein grundsätzliches Rezeptionsproblem von Manchette, den man lieber als Noir-Autor wahrnehmen will, mit allem Pathos, den der Begriff „Noir“ mit sich schleppt und damit auch seine Aficionados nobilitiert, anstatt als großen komischen Autor, denn Manchettes Subversivität besteht in seiner Sprachverwendung.
- Doug Headline, Max Cabanes: Nada. Von Jean-Patrick Manchette. Splitter Verlag, Bielefeld 2019. Hardcover, 192 Seiten, 35 Euro.

Vergebliche Suche nach Ordnung
(JF) Im Jahre 2001 wurde die nordirische Polizei umbenannt. Aus der Royal Ulster Constabulary, die sich zu über 90 Prozent aus dem protestantisch-unionistischen Bevölkerungsteil rekrutierte, wurde der Police Service of Northern Ireland. Am traditionellen Misstrauen der Katholiken gegenüber der Ordnungsmacht hat diese Namensänderung allerdings wenig geändert. Trotz Proporz bei Neueinstellungen sind katholische Polizisten immer noch selten, ein in der Realität beklagenswerter Umstand, der aber vielleicht ihre Beliebtheit als fiktive Ermittler erklärt. Sean Duffy, der trinkfreudige „katholische Bulle“ aus den Romanen Adrian McKintys, ist einer von ihnen, der eher introvertierte Celcius Daly ein weiterer. Erfunden hat ihn der 1971 im nordirischen County Tyrone geborene Autor Anthony J. Quinn, der erste Band „Disappeared“ erschien 2012, vier weitere folgten seitdem. Glaubt man einem Werbetext, muss man sie nicht unbedingt in der Reihenfolge ihrer Publikation lesen. Dennoch mutet es ein bisschen seltsam an, dass Celcius Daly ausgerechnet mit dem fünften Band Gestrandet („Undertow“, 2017) dem hiesigen Krimipublikum vorgestellt wird, denn so mancher Handlungsfaden aus den vorhergehenden Romanen wird in diesem Buch wieder aufgenommen. Und nicht alles erklärt sich von selbst.
In dieser Hinsicht weist die Lektüreerfahrung allerdings Parallelen zu Dalys ziemlich mühseliger Ermittlungsarbeit auf. Im Verlauf der Reihe, so Anthony J. Quinn in einem Beitrag für die (nordirische) Zeitung Irish News, sei Daly zu einem verwirrten Kriminalisten geworden, der sich in dem unüberschaubaren Netz der Wege und Straßen diesseits und jenseits der inneririschen Grenze buchstäblich verlaufe. Die republikanischen und loyalistischen Terrortruppen sind von Gangstern ähnlichen brutalen Kalibers beerbt worden, deren Machenschaften nur schwer auf die Schliche zu kommen ist, zumal es Verbindungen bis in höchste Polizeikreise gibt. Jedes gelöste Rätsel ergibt ein neues. Am Ende sind einige der Hauptschurken tot, aber Daly und sein Kollege von der anderen Seite der Grenze suchen immer noch vergeblich „nach einer Symmetrie, irgendeiner Ordnung in diesem Durcheinander aus Verbrechen und Verrat“.
Mit Gestrandet ist Anthony J. Quinn ein atmosphärisch dichter und sehr düsterer Kriminalroman gelungen, dessen Lektüre sich unbedingt lohnt. Das sollte seinen deutschen Verlag aber nicht davon abhalten, sich auch der vier Vorgängerromane anzunehmen.
- Anthony J. Quinn: Gestrandet (Undertow, 2017). Aus dem Englischen von Robert Brack. Polar Verlag, Stuttgart 2019. 318 Seiten, 20 Euro.
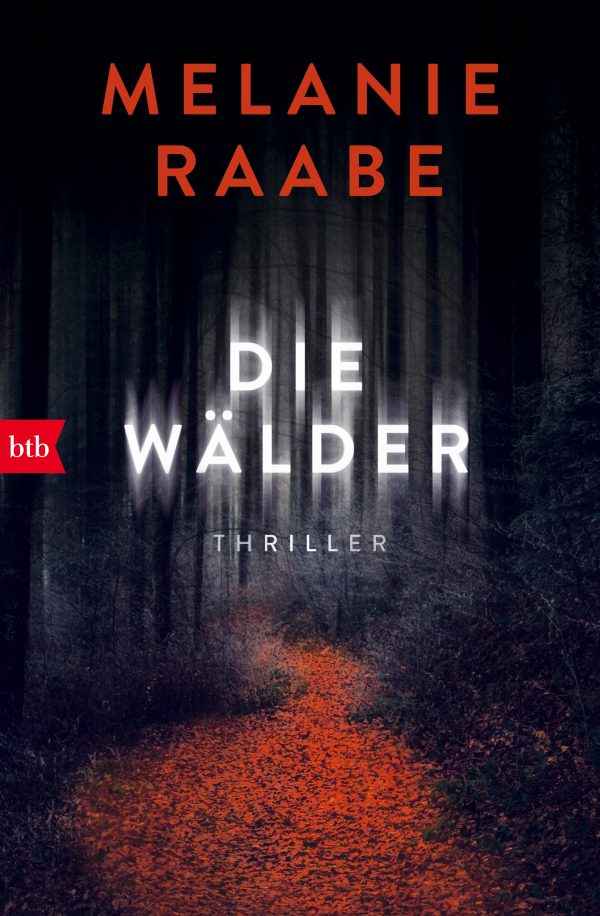
Mit Fingerspitzengefühl
(UN) Wie umgehen damit, wenn die Schatten der Vergangenheit allzu sehr in die Gegenwart ragen? Melanie Raabe schickt in ihrem neuen Roman Die Wälder ein paar Jugendfreunde, die sich über die Jahre mehr oder minder aus den Augen verloren haben, zurück in das Dorf, aus dem sie einst fortgingen. Sie müssen sich den Ängsten stellen, die sie fort trieben – und die Geheimnisse klären, die dahinter stecken, aktuelle und vergangene. Um dahin zu kommen, müssen sie allerdings erst einmal den Weg bewältigen, der in die “Heimat”, zum Herkunftsort, ins Vergangene führt – den eben durch die Wälder, die das Dorf umgeben. Und wer weiß, was sich da, unterwegs zurück, so alles ereignen wird …
Ein weiterer “unblutiger Thriller” von Melanie Raabe, der es in sich hat; abgründig, wendungsreich, immer wieder überraschend – und einmal mehr spiegelt Melanie Raabe in ihrem neuen Roman aktuelle gesellschaftliche Themen dabei sehr subtil mit Fingerspitzengefühl. Herkunft, Heimat – klar, auch so kann man das sehen. Dieser gewitzte Roman ist außerdem eine große Hommage an die Freundschaft, klasse! Melanie Raabe gilt als Deutschlands Thriller-Shootingstar, sie bekommt viel mediale Aufmerksamkeit, und zwar völlig zu Recht, denn sie hat, als Schreibende wie als Redende, etwas zu sagen.
- Melanie Raabe: Die Wälder. btb, München 2020. Klappenbroschur, 432 Seiten, 16 Euro.
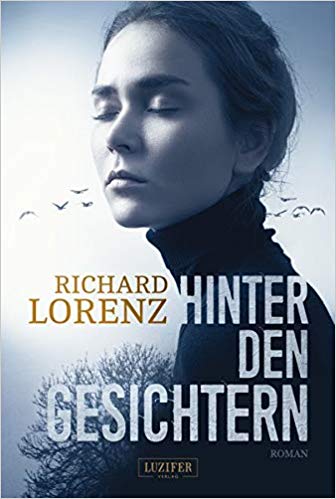
Ein eigener, unverwechselbarer Ton
(UN) Man wundert sich manchmal, wie gebannt “alle” auf zum Beispiel einen Stern wie Melanie Raabe am Firmament blicken – und dabei leicht übersehen, dass daneben noch andere Himmelskörper leuchten. Bestes Beispiel dafür ist der Schriftsteller Richard Lorenz, dessen neues Buch Hinter den Gesichtern kürzlich erschien – was aber niemanden zu interessieren scheint. Und zwar: zu Unrecht.
Richard Lorenz erzählt von einer nicht mehr ganz jungen Frau, allein erziehend, Intensivkrankenschwester, von der die Leute sagen, sie habe das zweite Gesicht, seitdem sie als Jugendliche eine Mordserie an Kindern “aufklärte”. Lisbeth Broussard hat damit längst abgeschlossen, Abstand gefunden – dann geht das Morden wieder los. Und bald zeigt sich, klar, dass sie mit ihrer Tochter im Visier des Täters steht. Oder der Täterin? Auch Richard Lorenz erzählt eine Geschichte über das Vergangene im Gegenwärtigen, auch bei ihm geht es letztlich um Identität und Herkunft. Dabei klingt Magisches und Mythisches an, was letztlich sehr geschickt aufgelöst wird; und Richard Lorenz trifft stilistisch einen sehr speziellen, unverwechselbaren Ton. Ein im besten Sinne ungewöhnlich packender Roman, der eine ganze eigene Welt erzählt – beeindruckend!
- Richard Lorenz: Hinter den Gesichtern. Luzifer Verlag, Borgdorf-Seedorf 2019. 294 Seiten, 13,95 Euro.
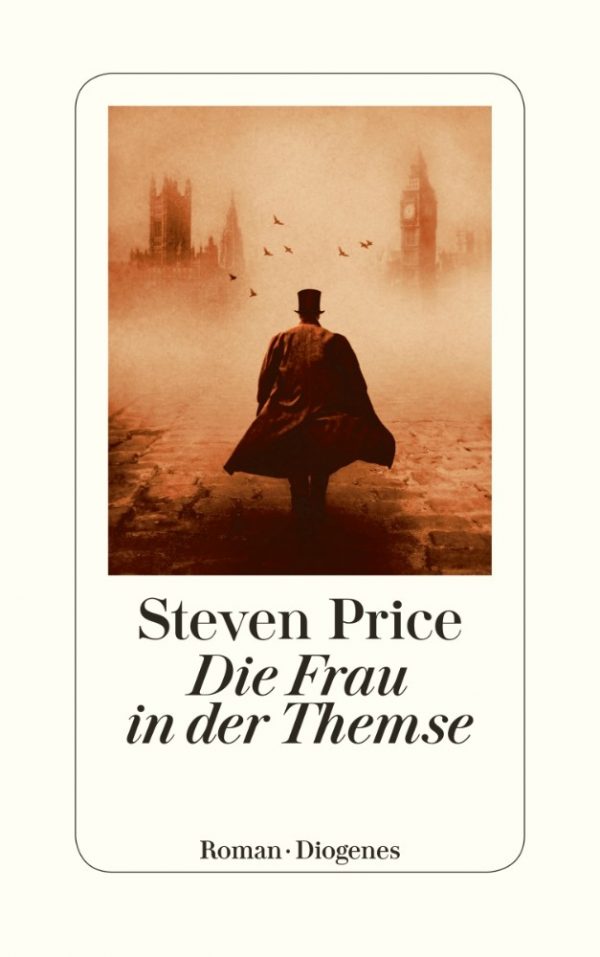
Ziemlich gewaltiges Buch
(TW) Verdächtig nach Steampunk sieht auf den ersten Blick Die Frau in der Themse des kanadischen Autors Steven Price aus, aber das täuscht. Zwar orientiert sich die Darstellung der Londoner Unterwelt des Jahres 1885 deutlich an den topischen Darstellungen der Zeit von Charles Dickens, Henry Mayhew und den Bildwelten von Gustave Doré, mit einem Schuss Atmosphäre der BBC-Serie »Taboo« (mit Tom Hardy), aber Price entwickelt eine durchaus nicht dauerzitierende Handlung um William Pinkerton, den nicht fiktiven Sohn von Allan Pinkerton, dem Gründer der ersten Privatdetektei und Spionagechef der Union im amerikanischen Bürgerkrieg. Pinkerton junior hetzt in London hinter einer Chimäre her, die seinen Vater obsessiv verfolgt hatte: Ein Meisterverbrecher namens Edward Shade, den aber anscheinend niemand je gesehen hat. Eine Spur führt über Charlotte Reckitt, eine Profiverbrecherin, die vor Pinkertons Augen in der Themse verschwindet. Charlotte Reckitt wiederum war die Komplizin des Gentleman-Gangsters Adam Foole, den sie mit einem Hilferuf nach London beordert hatte und der dort einen großen Coup plant.
Hört sich kompliziert an, ist aber lediglich komplex. Außerdem führt die Geschichte in Flashbacks in den amerikanischen Bürgerkrieg und wartet dort mit spannenden Szenen über Geheimdienstarbeit, Loyalität und Verrat auf und vor allem mit großartigen Szenen über die Rolle von Ballons in der damaligen Kriegsführung (Stichwort: Artilleriebeobachtung und Höhenaufklärung). Allein dieses Detail ist schon großartig. Es ehrt Price auch, dass er den zeitgleich umgehenden Jack the Ripper nur sehr im Hintergrund agieren lässt und daraus kein Cameo-Spektakel macht. Die Prosa des Romans ist subtil-wuchtig, sie lebt, könnte man fast sagen, stellenweise von Pleonasmen, aber das passt schon. Man muss kein Fan von historischen Kriminalromanen sein, um dieses ziemlich gewaltige Buch schätzen zu können.
- Steven Price: Die Frau in der Themse (By Gaslight, 2016). Aus dem Englischen von Anna-Nina Kroll und Lisa Kögeböhn. Diogenes, Zürich 2019. Hardcover, 915 Seiten, 28 Euro.
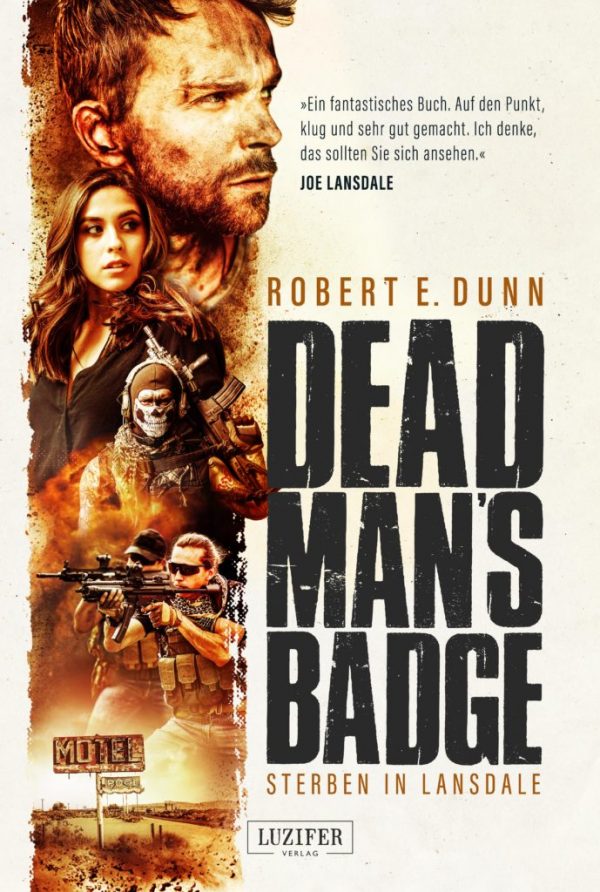
Karneval in Texas
(KM) Erstmal richtig gut anschnallen, bitte. Die Handlung von Dead Man’s Badge nimmt nämlich gleich am Anfang ein paar ziemlich scharfe Kurven. Longview Moody schmuggelt Drogengeld über die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Diesmal läuft die Übergabe in Juarez schief, und kurz darauf ist er auf der Flucht vor einer Handvoll brutaler Killer. Das erste Opfer – eine unglückliche Verwechslung! – ist Longviews Bruder, ein Cop, der gerade seinen neuen Job als Polizeichef in der gottverlassenen texanischen Kleinstadt Lansdale antreten sollte. Longview schnappt sich seine Dienstmarke – die „dead man’s badge“ aus dem Titel – und schlüpft in die Rolle seines Bruders: „Das ist schon komisch mit dem Gesetz und dieser Marke. Jeder, die Guten und die Bösen, verlassen sich auf die Regeln, für die sie stehen. Was passiert, wenn ein böser Mensch die Marke trägt?“
Das ist hochexplosive (und durchaus komische) Ausgangssituation in der listigen Verwechslungskomödie von Robert E. Dunn, Deutscher Untertitel: „Sterben in Lansdale“. Während Longview Moody sich noch darüber nachdenkt, was so ein Polizeichef wohl für Aufgaben haben könnte, stolpert er über eine Reihe von Leichen und ein mehr schlecht als recht getarntes Einsatzteam der DEA, der amerikanischen Drogenvollzugsbehörde. Offizielles Ziel: den Krieg gegen die Drogen zu „managen“. Inoffizielles Ziel: Geld beschaffen, um genau diesen Krieg zu finanzieren: „Polizei, Grenzschützer, DEA, mexikanische Sicherheitskräfte und Militär auf beiden Seiten“, dazu „Anwälte, Waffenhändler, Munitionshersteller, schusssichere Westen, Handschellen, gepanzerte Fahrzeuge – alles bis hin zu Kampfstiefeln“. In Lansdale erprobt die DEA darum einen unkonventionellen Weg zur Finanzierung: Sie kooperieren mit einem mexikanischen Drogenkartell, geheime Fluchttunnel und selbstgegründete Bankfilialen inklusive. „Das Einzige, was die alle verbindet, ist Geld.“ Läuft also.
Das ist nicht unrealistisch: Dead Man’s Badge erzählt von der Schattenökonomie, mit der die amerikanische Regierungsbehörden wie CIA oder DEA seit jeher ihre Kriegskassen füllen. Robert E. Dunn steckt diese politische Aufklärungsarbeit allerdings in ein grell gemustertes Genrekostüm, mit dem sprichwörtlichen „flachen Grab“ am Anfang und einem High-Noon-Zitat am Ende. Darüber hinaus steht er sich mit seiner bösartigen Verwechslungskomödie, in der ein skrupelloser Berufsverbrecher zum Kleinststadt-Polizisten wird, in der von Shakespeare begründeten Tradition. Gut und Böse, das ist in Lansdale nur ein Maskenspiel. Und genau wie Shakespeares Komödie der Irrungen vor knapp 500 Jahren zum Spiegelbild des frühneuzeitliche Chaos in Europa wurde, passt Dead Man’s Badge gerade ganz gut zum politischen Karneval unser Zeit.
- Robert E. Dunn: Dead Man’s Badge. Sterben in Lansdale (Dead Man’s Badge, 2018). Luzifer Verlag, Borgdorf-Seedorf 2019. 356 Seiten, 14,95 Euro.

Die Sache mit dem Quark
(TW) Hübsche Ideen soll man nicht allzu breittreten. In Ian McEwans Polit-Satire Die Kakerlake verwandelt sich eine Kakerlake in den britischen Premierminister und etabliert ein Kakerlaken-Kabinett (nein, die realen Bezüge muss man jetzt nicht noch erklären, auch nicht den literarischen Referenztext) und treibt mit Hilfe des möglicherweise auch schon mutierten US-Präsidenten die Welt in den Untergang, d.h. die Spezies homo sapiens wird sich fröhlich selbst erledigen und die evolutionär überlegenen Blattidae werden endlich wieder Ruhe haben auf dem Planeten.
Ins Werk gesetzt wird der Plan mit Hilfe der menschlichen Dummheit, die eine total bescheuerte Inversion des globalen Wirtschaftssystems, genannt Reversalismus (Waren bekommt man geschenkt, um arbeiten zu dürfen, muss man bezahlen) wird wider jeden Hauch von Vernunft freudig akzeptiert und damit sehenden Auges das Chaos losgetreten. Das ultimative Telos von Fake News und postfaktischer Politik ist erreicht. Das ist selbst für 132 Seiten zu dünn, für eine 30 Seiten Story hätte es allemal gereicht, zumal McEwan sich natürlich seinen Zorn über den irrsinnigen Brexit vom Leibe schreibt, was man wiederum nur zu gut verstehen kann.
- Ian McEwan: Die Kakerlake. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes Verlag, Zürich 2019.144 Seiten, 14 Euro.
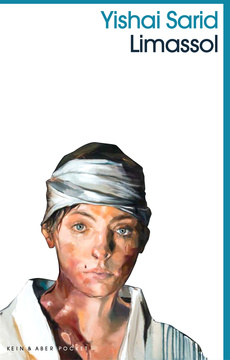
Endlich wieder da
(TW) Erfreulicherweise gibt es nach zehn Jahren eine Neuauflage von Yishai Sarids Limassol, einen Politthriller aus Israel, der damals, gemessen an seiner Qualität, zu wenig Beachtung gefunden hatte. Aktuell ist der Roman sowieso immer noch. Ein Agent des Schabak (eigentlich Schin Bet, der israelische Inlandsgeheimdienst), der keine großen Probleme damit hat, Araber unter Terrorverdacht zu foltern und auch zu töten, stößt an die ethischen Grenzen seiner Loyalität, als es darum geht, einen friedlichen, sterbenskranken und auch in Israel hochgeschätzten arabischen Dichter als Köder zu benutzen, um dessen in der Tat zum Terroristen gewordenen Sohn in Limassol auf Zypern in eine tödliche Falle zu locken.
Der schmale, nur 205 Seiten lange Text, stellt all die „unbequemen Fragen“, die zu thematisieren den Nucleus von guten Polit-Thrillern ausmacht. Das Dilemma, das sich zwischen Staatsraison (wie berechtigt sie auch ist, hier geht es darum, Selbstmordattentäter zu stoppen) und individueller Moral, auftut, ist eben das, was ein Dilemma ausmacht: Es gibt keinen richtigen Ausweg. Und davon erzählt das Buch, konzentriert, seriös, auf alle wunden Punkte gebracht, ohne je ein Thesenroman zu sein. Extrem unbehaglich, großartig.
- Yishai Sarid: Limassol (Limasol, 2009). Aus dem Hebräischen von Helene Seidler. Kein & Aber Pocket (1. Aufl. 2010), Zürich 2020. 205 Seiten, 12 Euro.
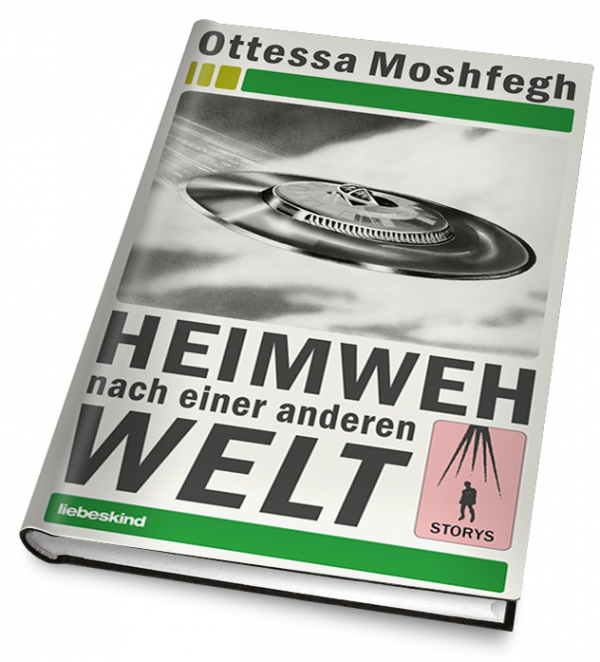
Fatalistisch, kühl und genial
(AM) Ihre für ein Honorar von 2.000 Dollar geschriebene Novelle McGlue aus dem Kleinverlag Fence-Books aus Albany (NY) – die Mordbeichte eines delirierenden Seemanns anno 1851 (CrimeMag-Rezension hier) – gehörte für mich zu den erzählerisch radikalsten Neuerscheinungen des Jahres 2016, beim Verlag Liebeskind erstklassig übersetzerisch betreut und als wertiges Buch präsentiert. Die aus Boston mittlerweile teilweise nach East Hollywood umgezogene Autorin kroatisch-persischer Herkunft, mehrfach hochkarätig für ihre Kurzgeschichten und Romane ausgezeichnet, ist eine aufregend neue, kräftige und originelle literarische Stimme. Ihr erster „richtiger“ Roman, Eileen aus dem Jahr 2015, ein Noir-Thriller der Extra-Klasse, angesiedelt in den frühen Sechzigern, mit einer jungen Frau in einem Jugendgefängnis als Erzählerin, war für den Booker Prize nominiert und hat auch hier Furore gemacht. Dann kam Mein Jahr der Ruhe und Entspannung und der Verlag Liebeskind blieb dran.
Nun erhöht sich Ottessa Moshfeghs Bugwelle Richtung deutscher Sprachraum, denn jetzt sind auch ihre gesammelten Erzählungen erschienen. Originaltitel: Homesick For Another World. Vierzehn, zwischen 2012 und 2017 entstandene Kurzgeschichten. Eine von ihnen heißt „The Weirdos“, das könnte auch auf dem Buchcover stehen, wenn der gewählte Titel mit dem Heimweh nach einer anderen Welt nicht so schön wäre. Die blendend geschriebenen, oft ins Surreale mündenden Geschichten erzählen von narzistischen, eher unfreundlichen, unattraktiven Charakteren mit seltenen Vorlieben und Zwängen. Oft sind sie auf jemand anderen fixiert, sei es aus Hass oder Verlangen. Oft haben sie noch nicht das bekommen, was sie zu verdienen glauben. Das zehrt immer wieder an der Wahrnehmung, auch an der aus der Leserperspektive. Die Dramen sind groß, der Ton oft leise gestellt, auf Fernseh- oder Internetvolumen, wo man auch die wundersamsten Dinge erfahren kann, die Emotion aber meist gedämpft bleibt. Ein interessanter Effekt. Eine Kühle wie bei Camus, ein Fatalismus wie bei den Existentialisten. Aber das eben heute, heimwehkrank nach einer anderen Welt. Minimalistisch. Surreal. Oft auch noir. Das Farbspiel des Originalcovers entfaltet sich erst ganz, wenn man auch den Buchrücken sieht …
- Ottessa Moshfegh: Heimweh nach einer anderen Welt (Homesick for Another World, 2017). Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger. Verlag Liebeskind, München 2020. Hardcover, 336 Seiten, 22 Euro.
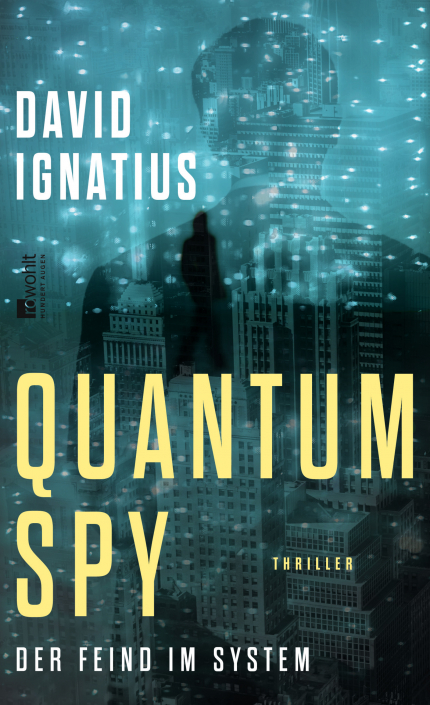
Der gute alte MacGuffin
(TW) Der Konflikt zwischen patriotischer Loyalität und ethnischer Bindung treibt den CIA-Agenten Harry Chang um, als er in ein Duell zwischen seinem Geheimdienst und dem chinesischen „Ministerium für Staatssicherheit“ gerät, die sich wegen eines potentiellen Durchbruchs auf dem Gebiet Quantencomputertechnologie in die Haare bekommen. Chang ist die Hauptfigur von David Ignatius‚ neuem Roman Quantum Spy – Der Feind im System, wobei der Quantencomputer leider nur der gute alte MacGuffin ist, der Ignatius dazu dient, das klassische Such-den-Maulwurf-Spiel zu inszenieren. Doch ach, trotz aller netten, gar artigen und unterhaltsamen Rochaden und Twist, ist dieser Plot viel zu durchsichtig und läuft nach dem business-as-usual-Algorithmus für Maulwurf-Romane, und warum der wackere Harry Chang sich dann plötzlich tatsächlich beinahe mit seiner Familiengeschichte von den Chinesen ködern lässt, bleibt rätselhaft. Das auf Happy-Ending getrimmte Buch tickt viel zu mechanisch, um auch nur einen Hauch von Drama, Dramatik, gar Tragik oder sonstige substantielle Elemente zu tragen. Bleibt nur die Botschaft: China ist böse und gefährlich und die Weltherrschaft steht letztendlich doch den Amis zu.
- David Ignatius: Quantum Spy – Der Feind im System (The Quantum Spy, 2017). Aus dem Amerikanischen von Stefan Lux. Rowohlt Hundert Augen, Hamburg 2020. Hardcover, 445 Seiten, 20 Euro.

Versandet
(TW) Leider ziemlich verschossen hat Robert Harris eine gute Idee in Der Zweite Schlaf: Vor ungefähr 800 Jahren hat es die Menschheit endlich geschafft, sich ins vorelektronische Zeitalter zurückzuschießen. England wird von einem rigiden Klerus beherrscht, der genau weiss, was die sündige „Zivilisation“ (also die von heute) zum Untergang gebracht hat – Gottlosigkeit. Insofern wurde Geschichte umgeschrieben und mystifiziert und voraufklärerische Sitten und Gebräuche wieder etabliert (hören wir da leichte Echos von »The Handmaid’s Tale«?), Klassengesellschaft, öffentliche Hinrichtungen, Ketzerverfolgung und was es derlei krude Dinge so gab und eben in der Realzeit des Romans wieder gibt.
Da tauchen in einem abgelegenen Kaff plötzlich Relikte wieder auf, die die offizielle Geschichtsschreibung widerlegen würden. Das darf natürlich nicht sein und so gerät der Jungkleriker Fairfax nicht nur in erotische Verstrickungen, was natürlich des Teufels ist, sondern auch in einen Glaubenskonflikt. Denn neugierig ist er ja schon, der kleine Ketzer. Das geht auch die ersten hundert Seiten gut, wird aber dann zunehmend zäher und absehbarer und endet mit einem totalen Luftausfall. Ein paar hübsche Details wie iPhone-Relikte und andere, jetzt total rätselhaft erscheinende Artefakte aus unserer Zeit, helfen leider auch nicht weiter, weil der Roman keine Pointe hat, keinen wirklich aufregenden Punkt, außer der fahlen Erkenntnis, dass die Leute in unserer Zeit auch ganz schön große Arschlöcher waren und deswegen mitsamt ihrer HighTech aus der Geschichte verschwunden sind. Much ado about nothing.
- Robert Harris: Der zweite Schlaf (The Second Sleep, 2019). Aus dem Englischen von Wolfgang Müller. Hardcover, 414 Seiten, 22 Euro.











