Bücher, kurz serviert
Kurzbesprechungen von fiction und non fiction. Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW) über …
William Boyle: Gravesend
Ian McGuire: Nordwasser
Dror Mishani: Die schwere Hand
Christoph Nix: Muzungu
Matt Rees: Die Damaskus-Connection
Christoph Ruf: Fieberwahn. Wie der Fußball seine Basis verkauft
Rudi Schweikert: „Durch eegenes Ingenium zusammengesetzt“: Studien zur Arbeitsweise Karl Mays
Roger Smith: Der Mann am Boden
Laura Spinney: 1918. Die Welt im Fieber
Antti Tuomainen: Die letzten Meter bis zum Friedhof
35 Millimeter. Das Retro-Film-Magazin.
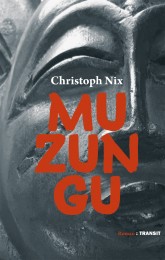 Afrika, mon amour
Afrika, mon amour
(AM) Es ist ein Markenzeichen dieses Verlages geworden: kluge, abgeklärte, politische Kriminalromane von Transit, wie etwa die von Ulrich Effenhauser (CrimeMag-Kritik hier). Nun also Afrika, Uganda genauer, eine tote schwedische Ärztin, der benevolente Rassismus der Gutmenschen, die Schatten der Vergangenheit, die Kriegsgewinnler, Karrieristen und Abgebrühten, die professionellen Helfer, die Geschäftsinteressen, „Gefördert von Deutschland GTZ“ als Aufkleber an Außenbordmotoren, das so verdammt schwierige richtige Leben in all dem Falschen.
Der erstaunliche Christoph Nix, noch bis 2020 als Intendant am Stadttheater Konstanz bestellt, magna-cum-laude-Jurist mit Erfahrungen als Strafverteidiger und auch im Wiederaufnahmerecht, nimmt in Muzungu den Faden zum Mordfall Olof Palme wieder auf, verknüpft ihn geschickt mit unseren afrikanischen Verschränkungen – von „Ärzte ohne Grenzen“ bis zu am Bodensee in deutscher Wertarbeit entwickelten Gewehren, die besonders für Kindersoldaten geeignet sind. Webt einen großen Erzählteppich. Lässt nach einer elegant und auf engem Raum vorgetragenen Tour d’Horizon etwas Gerechtigkeit ins Genre wehen.
Das Buch ist prall gefüllt mit Afrika, „wo die Verdammten zuhause sind“. Christoph Nix, der den Kontinent aus längeren Aufenthalten , Theaterarbeiten und Workshops kennt, zaubert einen großen Reichtum in dieses schmale Buch, einen schrägen Touristenunfall mit Nilpferd und viel „Porco Dio“ inklusive. Eine intensive, lohnende Lektüre. Muzungu übrigens ist ein Begriff aus der Bantusprache, stammt aus der Region der Großen Afrikanischen Seen, beschrieb europäische Forscher des 18. Jahrhunderts und bedeutet wörtlich „jemand der ziellos herum wandert“ oder „sich auf der Stelle drehen“, „taumeln“ – meint also Weiße.
Christoph Nix: Muzungu. Roman. Transit Verlag, Berlin 2018. Hardcover, 208 Seiten, 20 Euro. Verlagsinformationen.
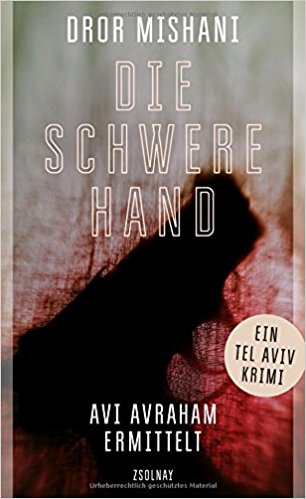 Kluges Spiel mit dem Genre (Ein Buch – zwei Perspektiven, I)
Kluges Spiel mit dem Genre (Ein Buch – zwei Perspektiven, I)
(JF) Avi Avraham ist zur Polizei gegangen, weil er gerne Kriminalromane liest. Und nun hat er seinen ersten Mordfall zu lösen. Allerdings entspricht der Verlauf der Ermittlungen nicht dem ihm geläufigen Muster: „Der Schuldige wird gefasst. Die Unschuldigen leben ihr Leben weiter.“ Dass ihn seine Freundin Marianka erinnert, ihr Leben sei halt kein Kriminalroman, macht die Sache nicht einfacher. Zum einen ist das Genre, wie Avraham als leidenschaftlicher Leser der Bücher Georges Simenons wissen sollte, schon lange über simple Zuschreibungen dieser Art hinaus, zum anderen handelt es sich bei ihm und Marianka, mögen sie auch anderes behaupten, eben doch um Bestandteile einer literarischen Fiktion, deren Schöpfer, der Jerusalemer Literaturwissenschaftler Dror Mishani, ein ausgewiesener Kenner der Geschichte des Kriminalromans ist.
„Die schwere Hand“ ist der dritte Fall für den Ermittler aus der nahe Tel Avivs gelegenen Stadt Cholon. Eine sechzigjährige Frau wird erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden. Dass sie vor einigen Jahren Opfer einer Vergewaltigung war, scheint für die Nachforschungen irrelevant, denn der Täter sitzt noch immer im Gefängnis. Auch dessen Verwandte, die auf seiner Unschuld beharren, scheiden, so die DNA-Analyse, als Verdächtige aus. Es bleibt eine einzige, ziemlich seltsame Spur, und die führt zu einem Mann in Polizeiuniform, der zum Zeitpunkt der Tat im Treppenhaus gesehen wurde. Als sich herausstellt, dass auch ein anderes Vergewaltigungsopfer von einem angeblichen Polizisten befragt worden ist, weiß Avraham, wonach er suchen muss.
Der Erzähler lässt zu diesem Zeitpunkt kaum noch Zweifel an der Identität des Mörders, wohl aber an seinem Motiv. Denn alles, was wir über ihn erfahren, stammt aus zweiter Hand. Von jemandem, der bis zum Ende meint, alles hätte anders ausgehen können, wäre sie nur aufmerksamer gewesen. Doch das ist, daran lässt der Handlungsverlauf wenig Zweifel, eine Illusion. Weder wird der Schuldige gefasst, noch leben die Unschuldigen ihr bisheriges Leben weiter.
Dror Mishani spielt mit den Strukturelementen des Genres, aber weil er gleichzeitig Realist ist, bleibt es ein trauriges Spiel. So traurig wie die Existenz des altersschwachen Hundes, der zu Beginn in einer Urinpfütze liegt und sich kaum rühren kann. Am Ende des Romans vermag er zumindest „ein Paar wässrige Augen“ auf den Kriminalisten zu richten. Dass dieses Tier ausgerechnet den Namen einer, nicht ganz unwichtigen, Nebenfigur trägt, ist verwirrende Absicht: Hier wird eine aufmerksame Lektüre eingefordert. Wir müssen uns Dror Mishani als einen anspruchsvollen Autor vorstellen.
(Anm. d. Red.: Joachim Feldmann über „Vermisst“ und „Die Möglichkeit eines Verbrechens„.)
Kein Entweder-Oder! (Ein Buch – zwei Perspektiven, II)
(TW) Hochkomplex ist Dror Mishanis Die schwere Hand. In Cholon – und nicht in Tel Aviv (Cholon ist nur technisch ein Vorort von Tel Aviv und hat immerhin fast 190.000 Einwohner) – wird eine Frau ermordet, die Jahre zuvor schon das Opfer einer Vergewaltigung war. Ihr Mörder, so sieht es aus, könnte ein Polizist gewesen sein. Oder zumindest eine Polizeiuniform getragen haben. Der grüblerische und unsichere Inspector Avi Avraham (Mishanis Serienheld) scheint festzustecken, die Variante mit dem Polizisten als Mörder wird natürlich in den oberen Etagen nicht gerne gesehen. Das Ganze scheint auf einen klassischen Whodunnit zuzulaufen – aber genau das ist Die schwere Hand nicht. Von Anfang an ist klar, wer der Täter ist. Was überhaupt nicht klar ist, ist jedoch sein Motiv, überhaupt die Gründe für sein eigenartiges Verhalten. Coby, so heißt der Unglückswurm, ist ein sehr verstörter Mensch. Seine Frau wurde auf einer Dienstreise ins schöne Eilat vergewaltigt, der Täter nie gefasst. Coby, dessen Berufswünsche Polizist oder Mossad-Agent kläglich gescheitert sind, muss sich aus einem inneren Zwang heraus, immer wieder von Vergewaltigungsopfern erzählen lassen, was en detail passiert ist. Seine Frau Mali ahnt (oder kennt) seine psychopathischen Züge, will aber nicht von ihm lassen – oder doch. Mishani verlässt ganz schnell die Ebene des „Wer“, konzentriert sich auf das „Warum“ – und lässt sowohl seinen Inspector als auch uns Leser an der Irrationalität menschlichen Handelns krachend scheitern. Letztendlich kann man weder Coby noch Mali verstehen und soll das auch nicht. Denn Mishani destruiert vorsätzlich, einlässlich und virtuos einen Hauptpfeiler der Kriminalliteratur – die Suche nach dem Motiv und dessen Funktion als Plausibilisierung von Gewalt. Avrahams langsamen Kreisen und Ausloten der conditio humana, sein eher intuitives als technokratisches Verständnis von Polizeiarbeit lässt ihn zwar, eher zufällig, auf den korrekten Tathergang kommen, aber am „warum“ scheitert er genauso wie seine Kollegen, die nach Vorschrift vorgehen. Die Figur Avraham ist deutlich an Simenons Maigret angelegt (nur komplizierter), aber seine Humanität kann eine Katastrophe nicht verhindern, wobei diese Katastrophe allerdings wiederum Folgeprobleme obsolet macht. Mishani hebelt damit den Dualismus von „happy ending“ versus „noir“ aus, übrig bleibt ein „kann sein“ oder „kann auch nicht sein“. Das ist zwar ziemlich meta und theoretisch, aber der Autor denkt ja auch hauptberuflich als Professor der Literaturwissenschaft über Kriminalliteratur nach.
Dror Mishani: Die schwere Hand (Ha isch she raz lada’at, 2015). Roman. Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. Zsolnay Verlag, Wien 2018. 287 Seiten, 22 Euro.
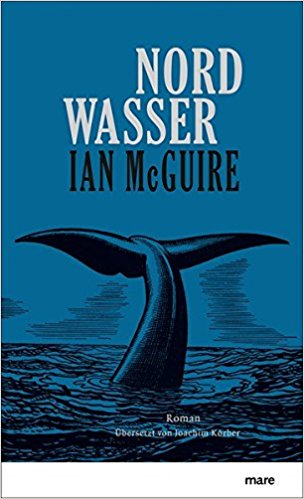 Wie die Meister
Wie die Meister
(AM) Achtung, in diesem Thriller werden Wale und Robben zuhauf brutal geschlachtet und gehäutet, zerquetscht ewiges Eis Haut und Seelen. „Nicht für Zartbesaitete“, empfahl der australische Thrillerautor Michael Robotham, damals gerade mit britischen Gold Dagger ausgezeichnet, im CulturMag-Jahresrückblick 2016 dieses Buch als eine nervenzerfetzende Lektüre. „Nur wenige Bücher dieses Jahres entwickelten solch eine erzählerische Spannung, bei der ich auf jeder Seite in Furcht war, dass etwas noch Schrecklicheres geschehen könnte.“
Zusammen mit dem Harpunisten Henry Drax gehen wir 1859 in einem vom Niedergang der Walindustrie bereits gezeichneten Hull an Bord der „Volunteer“ zu einer Fahrt ins Nordwasser. Paraffin und Petroleum sind dabei, den Walfischtran zu verdrängen. Schiffseignern, die in ihre Flotten investiert haben, droht der Ruin, nur die Agilsten und Skrupellosesten werden überleben. Drax ist ein Brutalo, manche in der Mannschaft werden ihn später für den Teufel halten. Innerhalb der ersten Buchseiten hat er bereits einen Shetländer ermordet, der ihm komisch kam, und einen Jungen vergewaltigt und bewusstlos geschlagen. Schon als er an Bord geht, ist klar, dass das alles nicht glücklich enden kann. Brownlee, der Kapitän, hat vor nicht langer Zeit ein anderes Schiff gegen einen Eisberg gesetzt und 18 Männer verloren. Auch der als Schiffsarzt angeheuerte irische Armeechirurg Patrick Summer, während der Belagerung von Delhi verwundet, bringt seine eigenen Dämonen mit. Eine bunt zusammengewürfelte Crew harter Männer, eine gnadenlose See, das ewige Eis, mörderische Konkurrenz und ein riskanter Versicherungsbetrug machen aus dem Schiff ein eigenes, im Eismeer isoliertes Universum. Noch schöner als im englischen Original liegt der Titel des Buches nicht von ungefähr nah an „Mordwasser“.
Wie eine Begegnung zwischen Joseph Conrad und Cormac McCarthy fand die New York Times Book Review diesen Roman, der 2016 für den Man Booker Prize nominiert war. In der Tat behauptet sich Ian McGuire beeindruckend souverän in einem von Patrick O’Brian, Joseph Conrad, Jack London, Edgar Allan Poe (besonders Arthur Gordon Pym) und Hermann Melville durchpflügten Terrain. Dabei konnte Ian McGuire auf keinem Walfänger anheuern – anders als Hermann Melville damals auf der „Acushnet“, von der dann elf der 26 Mann desertierten. Der Direktor des „Center for New Writing“ der University of Manchester’s Center hat jedoch exzellent recherchiert, kann extremes Wetter und die Kälte des Nordmeers ebenso gut beschreiben wie das rohe und gewalttätige Handwerk des Walfangs. Die Untiefen der Spannungsliteratur meistert er meisterhaft – ohne Pastiche, Ironie oder Postmodernes zu produzieren. Ganz so, als ob man heute immer noch so über die See schreiben könnte wie die Meister. Erstaunlich. Was für ein Buch!
Ian McGuire: Nordwasser (The North Water, 2016). Aus dem Englischen von Joachim Körber. Gebunden, mit Lesebändchen, mareverlag, Hamburg 2018. 302 Seiten, 22 Euro.
 Die Katastrophe, noch einmal verhindert
Die Katastrophe, noch einmal verhindert
(JF) Je bedrohlicher die Situation, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einem Einzelnen gelingt, eine Katastrophe globalen Ausmaßes zu verhindern. Und zwar „ in letzter Minute“ (Zitat). Das ist der Stoff, aus dem unzählige Action-Thriller gemacht sind. Die Damaskus-Connection, das Genre-Debüt des britischen Krimiautors und Journalisten Matt Rees, ist da keine Ausnahme. Sein Held heißt Dominic Verrazzano. Der ehemalige Elitesoldat arbeitet als Agent für die New Yorker Einwanderungs- und Zollbehörde. Was harmlos bürokratisch klingt, ist, wie Wikipedia weiß, die „größte und wichtigste“ Vollzugseinrichtung des Ministeriums für innere Sicherheit der USA. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegründet, hat sie unter anderem die Aufgabe, potentielle Gefährdungen der öffentlichen Infrastruktur zu identifizieren und zu eliminieren. In diesem Fall ist die Bedrohung ganz real: Auf das UN-Gebäude soll ein Giftgasanschlag verübt werden. Doch das muss Verrazzano erst einmal herausfinden, während der Leser relativ schnell mitbekommt, dass es sich hier um das üble Spiel eines privaten Sicherheitsunternehmens handelt, dessen Geschäftsinteressen durch einen möglichen Waffenstillstand im Nahen Osten beeinträchtigt würden. Mastermind der skrupellosen Aktion ist, wie zu erwarten, jemand, den Verrazzano aus seinem früheren Leben gut kennt. Das Böse braucht ein Gesicht. Und am besten eines, das dem Helden sehr vertraut ist.
Matt Rees variiert bekannte Erzählmuster auf unterhaltsame Weise. Ein buntes, aber überschaubares Figurenensemble verleiht dem in seiner Grundstruktur eher eindimensionalen Plot den Anschein von Komplexität, während kurze Kapitel und häufige Schauplatzwechsel das Lesetempo beschleunigen, bis man am Ende des Romans beruhigt aufatmet. Oder, wie es der Autor formuliert, „erleichtert Luft“ ablässt. Die Katastrophe konnte noch einmal abgewendet werden, ein Schurke wird verhaftet und alte Freunde finden wieder zusammen. Nur der Oberbösewicht bleibt auf freiem Fuß. Aber das ist auch gut so. Schließlich wartet der nächste Einsatz für Federal Agent Dominic Verrazzano schon auf seine Übersetzung ins Deutsche.
Matt Rees: Die Damaskus-Connection (The Damascus Threat, 2016). Thriller. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Verlag C.H. Beck, München 2018. 363 Seiten, 16,95 Euro.
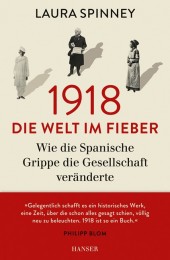 Aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht
Aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht
(AM) Kafka infizierte sich damit am 14.10.1918 in Prag – und überlebte, auch Ezra Pound hatte Glück. Guillaume Apollinaire starb daran. Donald Trump wäre ohne sie nicht der, den wir nun ertragen müssen. Großvater Friedrich erlag mit 49 der „Spanischen Grippe“, sein Sohn Fred erbte jung und begründete so ein Immobilienimperium. Das Leben eines fast jeden heutigen Erdenbewohners ist von dieser Pandemie beeinflusst (zwei Brüder meiner Großmutter zum Beispiel starben), unser kollektives Gedächtnis aber weiß so gut wie nichts mehr davon. Schon gar nicht vom Ausmaß.
1918, das ist für uns das Jahr, in dem der Erste Weltkrieg zu Ende ging. Es war aber auch das Jahr mit dem größten Massaker der Menschheitsgeschichte. Die Spanische Grippe infizierte jeden dritten Erdling: 500 Millionen Menschen. In drei Wellen schwappte sie um die Welt. Zwischen dem ersten gemeldeten Krankheitsfall am 4. März 1918 und dem letzten zwei Jahre später tötete der Grippevirus 50 bis 100 Millionen Menschen, also 2,5 bis 5 Prozent der Weltbevölkerung. Das stellt die Toten des Ersten (17 Mio) und des Zweiten Weltkriegs (60 Mio) zusammen deutlich in den Schatten. Die USA verloren mehr Soldaten an die Grippe als auf den Schlachtfeldern, an der Westfront infizierten sich drei Viertel der französischen Truppen und 900.000 deutsche Soldaten.
Gut 80.000 Bücher gibt es über WW I, ganze 400 bisher nur über die weltumspannende Fieberepidemie. Ein mehr als seltsamer kollektiver Gedächtnisverlust, dem die britische Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney mit 1918. Die Welt im Fieber nun endlich mit einer Vielfalt von Instrumenten zu Leibe rückt. Ihr Buch ist ein Glücksfall: klug und anschaulich, weiblicher Blick, interdisziplinär, weltoffen, abgeklärt, sinnlich und rasend spannend. Eine weltumspannende Detektivgeschichte. (Wie überhaupt dieser Stoff ein gewaltiges Feld für Kriminalliteratur wäre.)
Linney hat die politischen und kulturellen Verwerfungen mit im Blick: den gesellschaftlichen Aufstieg von Egoismus & Kaltherzigkeit – Mitleid konnte schließlich tödlich sein – ebenso wie die neue Liebe zum Frischluftsport und die geradezu obsessive Beschäftigung der Künstler des 20. Jahrhunderts mit den vielfältigen Arten, auf die der menschliche Körper versagen kann. Möglicherweise, das müsste eine weitere Tiefenbohrung prüfen, hat unsere kollektive, Einschaltquoten und Bestseller gehärtete, unleugbare Krimilust an Tod & nur temporärem Mitleid ja hier eine ihrer Wurzeln. Linneys letztes Kapitel geht nicht umsonst übers Erinnern. Philipp Bloom ist beizupflichten: Tatsächlich ein historisches Werk, dem es gelingt, eine Zeit, über die schon alles gesagt schien, neu zu beleuchten.
Laura Spinney: 1918. Die Welt im Fieber. Wie die Spanische Grippe die Gesellschaft veränderte (Pale Rider. The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World, 2017). Aus dem Englischen von Sabine Hübner. Carl Hanser Verlag, München 2018. 378 Seiten, 26 Euro. Verlagsinformationen.
 Leise und exzellent
Leise und exzellent
(TW) Alle Zutaten für einen „noir“ hat Gravesend von William Boyle. Ein Typ, der aus dem Knast kommt, wo er wegen eines Hate Crime eingesessen hat, und der bald auf den Bruder seines Opfers treffen wird. Angesiedelt in einem fast aus der Zeit gefallenen Eckchen in Brooklyn, eben in Gravesend, wo man Cop wird oder zur Mafia geht oder schon morgens über dem Bier in der Bar hockt, ein bisschen so, wie in Robert De Niro „A Bronx Tale“, oder wohin in Hollywood gescheiterte Schönheiten reumütig und gedemütigt zurückkehren und sich als local vamp versuchen. Alle diese typischen Noir-Parameter fährt Boyle auf – und lässt sie fallen, beziehungsweise desinteressiert links liegen. Gravesend ist, wenn überhaupt, ein Anti-Noir, aber selbst das stimmt nicht. Der Ex-Knacki ist sich seiner Schuld bewusst (normalerweise werden Schuldgefühle eher gescheiterten Cops zugeordnet), der potentielle Rächer will sich nicht rächen und mit dem Vamp läuft es auch eher un-vampig. Dennoch ist dieses Buch kein „meta“-Roman, keine Dekonstruktion des Noir, einfach, weil es die „Gesetze“ des Noir nicht anerkennt, und schlichtweg aus seinen Figuren eine völlig eigenständige und sehr originelle Geschichte entwickelt, die keine Genre-Figurationen braucht. Leise, aber exzellent, zurückhaltend und packend gleichzeitig. Großer Wurf.
William Boyle: Gravesend. Roman. Übersetzt von Andrea Stumpf. Polar Verlag, Hamburg 2018. 280 Seiten, 18 Euro.
 Ein in Stücke geschnittener Steinpilz als Warnung
Ein in Stücke geschnittener Steinpilz als Warnung
(AM) Dass ein Kriminalroman meine Lachfältchen erreicht, das kommt eher selten vor. Die letzten Meter bis zum Friedhof haben es getan. Lakonisch und birkholztrocken, wie wir den finnischen Humor aus den Filmen von Aki Kaurismäki kennen (der auch geblurbt hat), zieht Antti Tuomainen seine Geschichte durch. Finn Noir statt Film Noir. „D.O.A. (Dead on Arrival; deutscher Titel „Opfer der Unterwelt“) hieß der 84minütige Reißer von Rudolph Maté aus dem Jahr 1950 mit einer der innovativsten Eröffnungssequenzen der Filmgeschichte: Die Kamera folgt einem Mann (Edmond O’Brien als Frank Bigelow) durch den Flur einer Polizeistation, der gleich seine eigene Ermordung zur Anzeige bringen wird. Seltsamerweise scheinen die Polizisten ihn schon zu erwarten und zu wissen, wer er ist…
Antti Tuomainen variiert beeindruckend. Auch seine Eröffnung weiß zu packen. Gut, dass der Ich-Erzähler eine Urinprobe abgeben hat, sagt ihm der Arzt. Nach 40 Zeilen wissen wir: Diese Werte könnten selbst ein Nilpferd niederstrecken. Jakoo Mikael Kaunismaa weist eine ausgeprägte Vergiftungssymptomatik auf, er hat noch Tage, höchstens Wochen zu Leben. Und auch er fährt zur Polizei. Aber was soll er da? Soll er sagen: „Ich bin ein toter Mann, egal was kommt. Ich bin vergiftet worden. Ich sterbe. Nein, beweisen kann ich es nicht…“? Und hinzufügen, dass er eben vorher, vom Arzt zurück, seine Frau ertappt hat, wie sie gerade den Techniker ihrer gemeinsamen Pilz-Firma ritt? Es also ziemlich klar sei, wer ihn da aus dem Wege haben will?
Nun, die Polizei ist auch wieder zugegen, wenn es nach 300 Seiten zum entscheidenden Showdown und zu einem etwas anderen Ende kommt. Dazwischen haben wir viel über die finnische Pilzindustrie und den japanischen Appetit auf Matsutake, auf Kieferduftritterlinge gelernt, sind einem Samuaraischwert und dem Bentley unter den Spaltäxten begegnet, haben mit einem lakonischen Erzähler über die letzten Dinge des Lebens und den Slapstick im Kreisverkehr philosophiert. Haben erfahren, dass eine Begegnung mit einem anderen Menschen in einem einsamen finnischen Wald sich anfühlt wie eine Szene aus der Steinzeit.
Und wohl nicht so schnell wieder geht mir eine Szene aus der organisierten Pilz-Kriminalität aus dem Kopf, dem „Paten“ nachempfunden: nämlich ein auf dem Bett liegender, in Stücke geschnittener Steinpilz als Warnung. Prädikat für dieses Buch: absolut eßbar.
Antti Tuomainen: Die letzten Meter bis zum Friedhof (Mies joka kuoli, 2016). Aus dem Finnischen von Niina Katariina Wagner und Jan Costin Wagner. Rowohlt Hundert Augen, Hamburg 2018. 317 Seiten, 19,95 Euro.
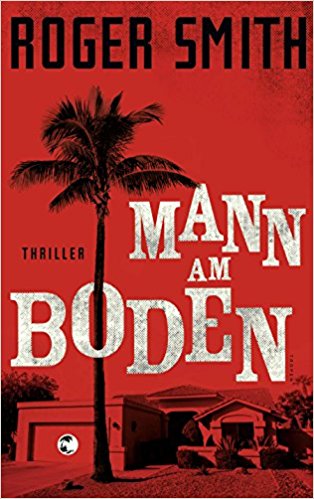 Heroisch und „wertkonservativ“
Heroisch und „wertkonservativ“
(TW) Der Südafrikaner Roger Smith hat seit einiger Zeit Südafrika als Schauplatz seiner Thriller verlassen (auch die, die er unter dem Pseudonym Max Black schreibt). Dennoch hat Mann am Boden südafrikanische Wurzeln. John Turner hat sich in Johannesburg von dem bad cop Bekker zu einem schrecklichen Verbrechen überreden lassen, um seine Schulden bei einem bösen Schwarzen, der später steile politische Karriere machen wird (was aber keine Rolle spielt), bezahlen zu können. Eine Menschenrechtsanwältin zieht ihn aus dem Dreck, um den Preis, dass er sie heiratet und mit ihr eine Familie gründet, mit der er nun in Tucson, Arizona lebt und mit einem Swimming-Pool-Reinigungsgerät namens „Poolshark“ zu einigem Wohlstand gekommen ist. Aber Turner ist frustriert – seine Gattin liebt ihn nicht, auch das gemeinsame Kind Lucy geht ihr auf die Nerven. Sie ist hager, hässlich und übelriechend, verpasst aber gerne fremden Männern einen Blowjob (warum?), hat aber, im Gegensatz zu Turners Geliebten (grossbrüstig, breithüftig und langbeinig) eine eher geringe Fickability. Als plötzlich Bekker in Arizona auftaucht (warum eigentlich?), macht Turner einen Deal: Bekker und seine Kumpane (ekelhafte Monster-Karikaturen) sollen die Gattin umbringen, dafür den Inhalt seines Safes einstreichen und Turner selbst als nur angemackeltes Opfer übriglassen. Aber natürlich geht das alles schief. Mann am Boden ist ein völlig pervertiertes Rewriting von Joseph Hayes´ Klassiker „An einem Tag wieder jeder andere“ („The desperate hours“, 1955), in dem ein anscheinendes Familienidyll von drei ins Haus eingedrungenen Gangstern zerstört wird. Bei Smith gerät diese Ausgangssituation zu einer Schritt für Schritt voraussagbaren sadistischen Metzelorgie mit Säge, Geflügelschere, Gekröse und allen möglichen Körperflüssigkeiten – eine wollüstig ausgebreitete Nummernrevue des Ekligen, die aber nie mit dem Prinzip der „Übererfüllung“ arbeitet (wie das etwa Tom Franklins „Smonk“ tut), sondern sich „realistisch“ gibt. Und zu allem Überfluss ist das ganze Elend dann auch noch stramm „wertkonservativ“. Was passiert mit der ehebrecherischen Schlampe (also die mit der hohen Fickability): Kopf ab, Strafe muss sein. Und wer bleibt, ganz unradikal, stockkonventionell und gähnend öde übrig? Der tapfere Daddy (mit leichten Körperverlusten) und das liebe, tapfere Kindelein. Manchmal spoilere ich sogar richtig gerne. Nicht besser wird das Buch durch eine scheinheiliges Narrativ über „Schuld“, die bezahlt werden muss, mindestens gedeckt durch ein Seneca-Zitat. Turner purgatiert sich, in dem er am Ende heroisch wird. Und dann sitzen Vater und Kind da und blicken in die Sonne. Meine Güte.
Roger Smith: Mann am Boden. Roman. Tropen 2018, Übers.: Ulrike Wasel, Klaus Timmermann, 319 Seiten, 14,95 Euro.
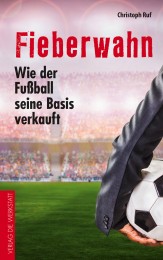 Ist Geld eigentlich rund?
Ist Geld eigentlich rund?
(AM) Es ist, das finde ich schon lange, auch eine Form des Verbrechens, wie das Geld und seine Agenten den Fußball unterwandern und zu einem fiesen Geschäft machen. Mehr als symbolisch war da, dass der mächtigste Mann des reichsten Clubs der Republik jahrelang so nebenher per Handy mit Unsummen an der Börse zockte und darüber das Steuerzahlen „vergaß“. Der Vollblut-Fußballjournalist Christoph Ruf ist durch das Land gereist, hat den Fieberwahn gründlich recherchiert, hat Fans, Funktionäre, Investoren, Kollegen und Trainer interviewt. Entstanden ist ein Buch, das die Verwerfungen der Kommerzialisierung aufzeigt. Bizarre Ablösesummen und Frisuren, Tätowierungen wie im Knast und obszöne Gehälter, dumpfe Jubelrituale, Finanzhaie, die Traditionsklubs aufkaufen, ja sogar ein kleiner Bombenleger, der auf einen Börsenabsturz zielt. Unglaublich viel Geld und der schier unaufhaltsame Weg in eine Forbes-Liga, mit Helene Fischer als Halbzeitfolter und gleichzeitig einer fortschreitenden Kriminalisierung und Marginalisierung der Fans. Das ist der aktuelle Fußball.
Am großen Rad der Kommerzialisierung drehen viele. Funktionäre, TV-Abonnenten, Journalisten, selbst die Ultras. Hier eine zehnprozentige Erhöhung der Ticketpreise, dort ein wenig mehr Gängelung, hier ein Montagsspiel mehr, dort eine Werbedurchsage. All das wird geschluckt. Mit dem Fußballfans nämlich ist es, findet Christoph Ruf, wie beim Frosch-Paradoxon: Wirft man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser, hüpft er entsetzt wieder heraus. Setzt man ihn in kaltes und erhöht die Temperatur Stück für Stück, bleibt er letztlich im kochenden Wasser sitzen, bis er völlig abgekocht und tot ist.
Ruf, dessen Buch „Ist doch ein geiler Verein“ über „Reisen in die Fußballprovinz“ 2008 zum Fußballbuch des Jahres gewählt wurde, sieht den modernen Fußball drauf und dran, seine Basis zu verprellen. Sieht Fans, die nach Jahrzehnten ihre Dauerkarten abgeben, sieht Groundhopper, die sich nicht mehr wie Verbrecher behandeln lassen wollen. Sieht Journalisten, die nach echten Geschichten in der Oberliga suchen statt im Mikrofonwald vor Manuel Neuer oder anderen Stars. Er weckt auch Hoffnung, vor allem aber schreibt er kritisch. Also besser mal ein gutes Buch wie dieses lesen als sich bei einem schlechten Spiel zu langweilen.
Christoph Ruf: Fieberwahn. Wie der Fußball seine Basis verkauft. Werkstatt Verlag, Göttingen 2017. 190 Seiten, 14,90 Euro.
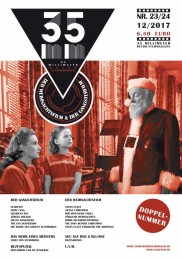 Filmkunst zum Träumen
Filmkunst zum Träumen
(AM) Michelangelo Antonioni hatte lange Zeit ein verschwörerisches Abkommen mit seinen Kameramännern. Wenn eine Einstellung abgedreht war, rief er zwar „Cut!“, aber seine Kameraleute wussten, dass die Kamera weiterlaufen sollte. Das Ergebnis waren kurze Momente fragender, zweifelnder, manchmal trauriger, leerer Blicke der Schauspieler, die Antonioni später an passenden Stellen einschnitt und die oft zu seinen schönsten Einstellungen gehörten.
Die Kamera weiter laufen lassen als die Normalansicht es tut und damit die schönsten Ergebnisse produzieren, das ereignet sich in nun schon 24 Heften in der Zeitschrift 35 Millimeter aus Saarbrücken. Sie nennt sich „Das Retro-Film-Magazin“, hat im Regelfall 60 Seiten, ist mit 4 Euro sehr erschwinglich; die Doppelnummer im Dezember 2017 kam auf 74 Seiten und kostete 6,50 Euro. Dies mit liebevollem Layout, sorgfältiger Bildauswahl und -Begleitung und kenntnisreichen Texten. Die Lesbarkeit in typografischer wie inhaltlicher Hinsicht verdient ein Extra-Prädikät.
Der Schwerpunkt der Weihnachtsnummer galt dem Gangsterfilm – mit dabei: Porträts von Fritz Lang, Nicholas Ray und Jürgen Roland, Tourneurs Gangster und The Gay Desperado. Großartig. Und als Zugabe Josef von Sternberg, eine kleine Werkschau des Weihnachtsfilms und Serien zu Buñuel und Antonioni.
Bestandteil eines jeden Heftes sind Rezensionen von DVDs und Blu-Rays. Diese Zeitschrift pflegt die Filmkunst auf gloriose Weise, Dominik Graf war jüngst ganz von den Socken: „Erstmal denkt man, man träumt…“
35 Millimeter. Das Retro-Film-Magazin. Herausgegeben von Jörg Mathieu, Saarbrücken. Erscheinungsweise zweimonatlich, 6 Ausgaben pro Kalenderjahr. Das Jahresabo kostet passgenaue 35 Euro. Homepage und Bezug: www.35mm-retrofilmmagazin.de
 Detektivarbeit vom Feinsten
Detektivarbeit vom Feinsten
(AM) „Lieber Leser, weißt du, was das Wort Greenhorn bedeutet?“ So lockt Karl May zum Erzählauftakt von Winnetou I in den Roman hinein. Es ist eine seiner beliebten Wissensproben, gerne gibt es sie auch gestaffelt oder imaginiert: „Sollte mich jemand fragen…“ Sie sind ein Auftakttopos, erlauben das Erzählen von Geschichten (funktioniert auch gegenseitig) und das Einstreuen von Hintergrundinformationen, sie transportieren die Leser schnell in andere Welten. Darin war er Meister. Der Karl-May-Forscher Rudi Schweikert hat ihm in einem produktiven Forscherleben (die Liste seiner Karl-May-Veröffentlichungen hier) immer genauer auf die Finger gesehen.
„Durch eegenes Ingenium zusammengesetzt“ ist eine bewundernswerte Sammlung dieser Detektivarbeit. So möchte man auch andere Autoren erforscht und verknüpft sehen: Quellenforschung, unterirdische Verbindungen, direkte Übernahmen, Nachempfindungen, Collagen, Osmosen, Flugbestäubung, Plagiate, dreister Klau. Gewusst haben wir es schon immer, nun ist es – exemplarisch – bis ins hübscheste Detail nachzuvollziehen. Copy & Paste vor zu Guttenberg: Ob Geheimbünde oder mythische Figuren, Landeskunde, exotische Schauplätze auf allen Kontinenten, unnützes Wissen aller Art oder farbigste Details, Karl May setzte sich das alles höchst freihändig und kreativ zusammen, erschuf sich seine Welten nach eignem Willen, Vorstellung & Bibliothek, nachgeholfen durch allerlei schnell angelesenes und oft nur ungenau kopiertes „Zusammensetzingenium“. Freihändig eben. Und virtuos.
Rudi Schweikerts Das gewandelte Lexikon hatte bereits 2002 Karl Mays und Arno Schmidts produktiven Umgang mit Nachschlagewerken untersucht und in „Ihr kennt meinen Namen, Sir?“ der Namengebung bei Karl May nachgespürt. Jetzt können wir – großzügig illustriert, oft zwei- oder gar dreispaltig gesetzt und damit die Quelltexte neben Mays Endprodukt – nachvollziehen, wie er auf die Mescaleros als Hauptstamm der Apachen kam, aus dem ja immerhin Winnetou stammt. Fährtenleser Schweikert führt uns in „Pierer’s Universallexikon“ an die Quelle. Wir können nachverfolgen, wie der der Schwarze Gérard zu seiner „mit Gold ausgegossen und mit Blein überzogenen“ Büchse kam (in „Rächerjagd rund um die Erde“), können sehen, wie W.F.A. Zimmermanns Roman Californien und das Goldfieber auf Balduin Möllhausens authentischen Aufzeichnungen aus dem Wilden Westen beruht und wie das in Mays Erzählung „Deadly Dust. Ein Abenteuer aus dem nordamerikanischen Westen“ gelangt, die später in den ersten vier Kapiteln von Winnetou III Verwendung finden. Die Erinnerungen des Zauberers Houdini verwandeln sich in Kara Ben Nemsis Kugelfestigkeits-Tricks in Durch das Land der Skipetaren, Details aus Fouqués Ritterroman Der Zauberring tauchen Im Reiche des silbernen Löwen auf, ein Geheimbundmotiv bei Alexandre Dumas dem Älteren gelangt nach Ardistan und Dschinnistan, Alan Pinkertons „Canada Bill“-Schilderung und der Zusammenbau aus J. Retcliffs historischem Roman Abraham Lincoln sprudeln als Quellen für Karl Mays „Ein Self-man“. Und auf seiner Verfolgung des Schut nimmt Kara Ben Nemsi Anleihen beim Tapferen Schneiderlein. All das sehen wir bis hin zu Anstrichen und Notizen etwa aus den Lexikas in Mays Schreibstube in Radebeul, zum Beispiel bei „Neue Wahrnehmungen und Anecdoten über arabische Pferde“ im „Atlas zur Kunde fremder Welttheile“. Und weißt du noch, lieber Leser, wie die edlen Pferde meiner Helden hießen?
Arno Schmidt hätte es nicht schöner sagen können: „Nachloofen thue ich keenem Geschichtsschreiber, der doch ooch weiter nichts nur als das schreibt, was er in Büchern und Urkunden gefunden hat. Das kann jeder! Ich aber setze mir die rhetorisch lexikale Weltgeschichte durch eegenes Ingenium zusammen …“ So spricht Hobble-Frank in Der Geist der Llano estakata, und so setzt es Rudi Schweikert seinen fulminanten Studien voran.
Rudi Schweikert: „Durch eegenes Ingenium zusammengesetzt“: Studien zur Arbeitsweise Karl Mays aus fünfundzwanzig Jahren. Materialien zum Werk Karl Mays, Band 8. Hansa Verlag, Husum 2017. 400 Seiten, 19 Euro.












