Bücher, kurz serviert
Kurzbesprechungen von fiction und non fiction. Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW) über …
Carlo Bonini: ACAB – All Cops Are Bastards
Richard Brewer & Gary Phillips (Hg.): Culprits. The Heist Was Just the Beginning
Duncan Falconer: Stratton. Die Geisel
Gunnar Kaiser: Unter der Haut
Michaela Kastel: So dunkel der Wald
Jason Matthews: Red Sparrow
Fuminori Nakamura: Die Maske
Wallace Stroby: Fast ein guter Plan
Max Freiherr von Oppenheim: Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde
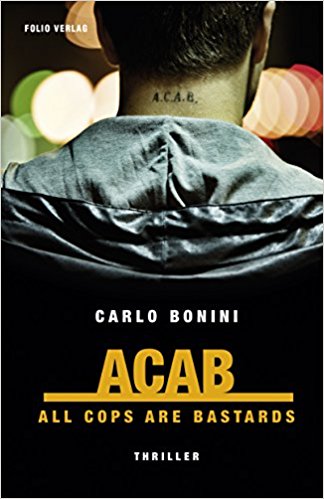 Fronten statt Konsens auf Italienisch
Fronten statt Konsens auf Italienisch
(TW) Dicht an der Realität siedelt Carlo Boninis ACAB – All Cops Are Bastards. Der Roman folgt keiner gängigen Suspense-Formel. Ausgehend von Pier Paolo Pasolinis berühmten Artikel „Die KPI an die Jugend!!“ von 1968, der in ketzerische-paradoxer Absicht die Klassenunterschiede zwischen Polizisten und linken Demonstranten (Proletarierkinder vs Bürgerkinder) thematisierte, schaut sich auch Bonini die Konfliktlinien zwischen der italienischen Bereitschaftspolizei und den Ultras, bzw. Nazi-Skins genauer an. Hintergrund ist zunächst die zögerliche Aufarbeitung der explodierten Polizeigewalt beim G8 in Genua im Juli 2001. Da schienen die Fronten noch klar zu sein – eine besinnungslos prügelnde faschistoide Polizei gegen Globalisierungsgegner. Aber was, wenn Polizei und ihre Widersacher schon fast bürgerkriegsmäßig aneinandergeraten und dennoch gemeinsame ideologische und soziologische Wurzeln haben? Vertreter des „starken“ Staates à la Mussolini gegen Rechts-„Anarchisten“. Hass und krasse Gewalt prägen das öffentliche Leben, denn auch Migranten sind oft Opfer beider ansonsten bis aufs Blut verfeindeter, sozial abgehängter junger Männer und deren Gewaltkultur. Und weil Carlo Bonini auch noch den mafia-induzierten Müllstreik im Hintergrund präsent hält, zeigt er Italien als ein Land, dem zivilgesellschaftlicher Konsens längst abhandengekommen ist. Aus verschiedenen Perspektiven und Textsorten montiert Bonini eine schier ausweglose Gewaltspirale. Das ist spannend.
Carlo Bonini: ACAB – All Cops Are Bastards. Aus dem Italienischen von Karin Fleischanderl. Folio Verlag, Wien 2018. 224 Seiten, 18 Euro. Carlo Bonini bei CrimeMag hier.
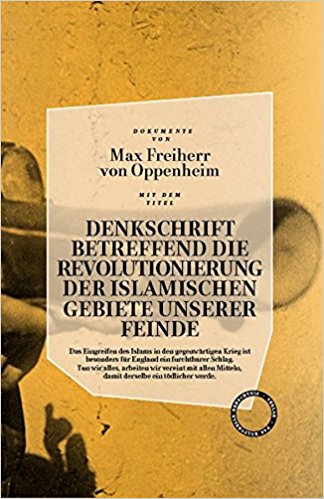 Deutsche Tradition
Deutsche Tradition
(AM) Sebastian Fitzek wird wegen seines neuen Romans deutscher Innenminister? Puuh. John Buchan, dem Paris-Korrespondenten der „London Times“, widerfuhr genau das in Großbritannien vor hundert Jahren, nachdem er 1916 mit seinem Thriller „Grünmantel“ einen Bestseller gelandet hatte. Vor dem deutschen Islamismus hatte er darin gewarnt, vor einem „Dschihad Made in Germany“. Es war weit weniger aus der Luft gegriffen, als man hätte meinen könnte. Bei den ausgiebigen Recherchen für seinen 2015 erschienenen Roman „Risiko“ stieß der Romancier Steffen Kopetzky auf den sogenannten Oppenheimer-Plan – den niemand kennt, weil nichts aus ihm geworden ist. Trotzdem lässt das Dokument heute noch frösteln, beschreibt der im Ersten Weltkrieg entwickelte Plan doch etwas, dessen Folgen bis heute wirken: nämlich die Mobilisierung arabischer, persischer und afghanischer Muslime zum Heiligen Krieg. Terror als Waffe und als strategisches Element der Geopolitik.
Das Deutsche Reich wollte damit seine Kriegsgegner schwächen und sie vom Nachschub aus den Kolonien abschneiden. Entwickelt wurde der „Dschihad-Plan“ von einem der besten Orientalisten der Zeit: vom Bankierssohn Max von Oppenheim (1860–1946). Seine Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde, enthält konkrete Handlungsanweisungen für den Waffenschmuggel, für Brandanschläge und den Einsatz von Propaganda, liest sich wie ein Handbuch des Terrors, ist ein Dokument intellektueller Skrupellosigkeit. Der Verlag Das kulturelle Gedächtnis zeigt hier beeindruckend, wie weit gefasst er sein Programm definiert, dies ist fürwahr ein bewahrenswertes Dokument der Zeitgeschichte, sehr solide editiert. Die aktuelle WDR 5-Hörspiel-Serie „Sofias Krieg“ (siehe das Interview mit Ulrich Noller in dieser CrimeMag-Ausgabe) erscheint nach dieser Lektüre noch weit weniger hergeholt. Bei der Instrumentalisierung des Islams gibt es eine verdammt deutsche Tradition.
Max Freiherr von Oppenheim: Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde, herausgegeben von Steffen Kopetzky. Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin 2018. 112 Seiten, gebunden, Kopffarbschnitt, Lesebändchen, 18 Euro.
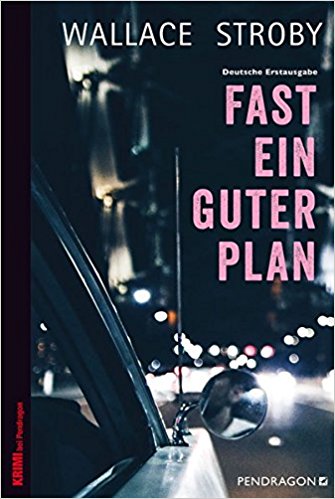 Gerade & topisch
Gerade & topisch
(TW) Suspense und Action, geradlinig wie ein Strich ist das Prinzip von Wallace Stroby. Auch der dritte Roman um seine Profigangsterin Crissa Stone, Fast ein guter Plan, lebt nach diesem eher unterkomplex anmutenden Strickmuster. Topisch – ein Coup geht schief, die Partner geraten sich in die Haare, die bestohlene Partei schickt ein üblen Fixer aus, die Leichen stapeln sich und Crissa tut nebenbei noch Gutes. Alles voraussehbar, alles nach Schema, und dass Stroby eine Heldin hat, statt des an dieser Stelle üblichen Helden ist inzwischen nicht weiter bemerkenswert. Bemerkenswert ist eher, dass der Pendragon Verlag den schönen Originaltitel „Shoot the Woman First“ (in Anspielung auf Anti-Terrorhandbücher) nicht verwenden wollte. Anyway – und das ist das Wunder: Es funktioniert prächtig. Reduktion als Kunstform, Schlichtheit als Purismus, irgendwie aus der Zeit gefallen, aber höchst vergnüglich. Und garantiert „diskursfrei“. Auch das ist eine Qualität, die man durchaus schätzen darf.
Wallace Stroby: Fast ein guter Plan (Shoot the Woman First, 2014). Aus dem Amerikanischen von Alf Mayer. Pendragon Verlag, Bielefeld 2018. 312 Seiten, 17 Euro.
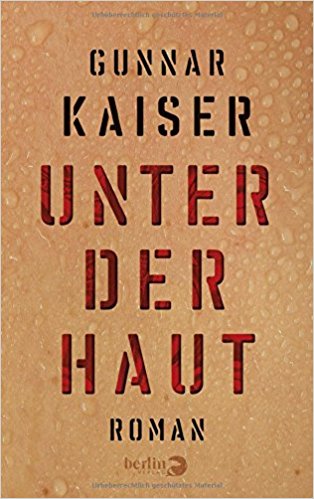 Ein Bildungsroman, fürwahr
Ein Bildungsroman, fürwahr
(JF) Der Mörder aus Büchersucht ist keine Erfindung. Der sächsische Pfarrer Johann Georg Tinius soll einer gewesen sein. Um seine mehr als 50.000 Bände umfassende Bibliothek zu finanzieren, war ihm, so meinte zumindest die Justiz, jedes Mittel recht. 1813 wurde er in einem Indizienprozess zu einer Zuchthausstrafe verurteilt, gestanden hat er nie. Der Autor Klaas Huizing hat ihm vor mehr als zwanzig Jahren einen Roman gewidmet. Warum nun allerdings Gunnar Kaiser einen Serienmörder, der die Haut seiner Opfer zu Bucheinbänden verarbeitet, zu einer maßgeblichen Figur seines Debütromans machen musste, wirkt dennoch befremdlich. Lässt sich die Verwendung eines der abgeschmacktesten Motive populärer Thriller als Reminiszenz an jene Art von Gebrauchsliteratur erklären, die in diesem von der außergewöhnlichen Belesenheit seines Autors zeugenden Roman kaum eine Rolle spielt? Oder handelt es sich schlicht um eine Konzession an den Publikumsgeschmack? Was bliebe von Unter der Haut, ließe man diesen Teil des Plots einfach weg? Wahrscheinlich ein Bildungsroman im wahrsten Sinne des Wortes.
Gunnar Kaiser erzählt von dem Literaturstudenten Jonathan Rosen, der seine Lehrjahre im New York des Jahres 1969 absolviert. Sieben Bücher nennt er sein eigen – Jules Verne, Jack London, Erich Kästner und Dumas der Ältere sind Erinnerungen an die Kindheit, während Nietzsche, Henry Miller und Philip Roth zeigen, wo die Reise hingehen soll. Kein Wunder, dass ihn die mehr als 5.000 Bände umfassende Bibliothek des mysteriösen Josef Eisenstein fasziniert – zumal es sich um erlesene Ausgaben handelt, wie Jonathan als naturbegabter Bibliophiler rasch erkennt. Dass die Beziehung der beiden auch eine erotisch-voyeuristische Komponente besitzt, überrascht nicht, denn wir befinden uns in einem Roman, der aus Literatur gemacht ist. Wenn Eisenstein seinem Schüler, den jungen Peter Handke zitierend, vorwirft, er leide an „Beschreibungsimpotenz“, weil er über ein sexuelles Erlebnis nicht berichten kann, ist er in hohem Maße ungerecht. Schließlich weiß Rosen eine ungeheuerliche Geschichte zu erzählen, die allerdings von Eisensteins eigener Biografie, in der sich die Schrecken des 20. Jahrhunderts spiegeln, noch übertroffen wird. Und hinter all dem steckt der talentierte Herr Kaiser, der es nicht lassen konnte, ein, wenn auch nicht für Jonathan, leicht zu lüftendes „furchtbares Geheimnis“ (Klappentext) als zentrales Strukturelement zu verwenden. Eine Entscheidung, die von schriftstellerischer Souveränität zeugt. Respekt!
Gunnar Kaiser: Unter der Haut. Roman. Berlin Verlag, München 2018. 518 Seiten, 22 Euro.
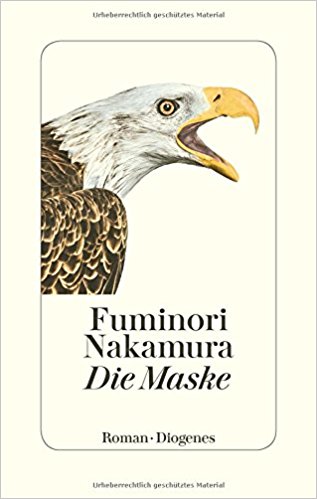 Radikaler, düsterer Nihilismus
Radikaler, düsterer Nihilismus
(TW) Shōzō Kiku ist der Chef eines mächtigen japanischen Oligarchen-Clans, der sein Geld mit allem verdient, was schmutzig und widerwärtig ist: Waffenhandel, Destabilisierung von Regierungen in Afrika zur Rohstoffgewinnung und so weiter. Eng verbandelt natürlich mit den Yakuza und politisch deutlich erwünscht. Eine besonders abwegige Familientradition besteht darin, einen Sohn (meistens der letzte) zu zeugen, in der Absicht, ein „Geschwür“ auf die Menschheit loszulassen, das nichts wie Unglück, Tod und Verderben bringen soll. Ausgerechnet der sensible Fumihiro soll so zum Monster gemacht werden. Zum Training im Leute-Ruinieren wird ein Waisenkind in die Familie aufgenommen, die schöne Kaori. Fumihiro verliebt sich und tötet lieber seinen Vater, als seiner „Geschwür“-Funktion gerecht zu werden. Entsetzt muss er feststellen, dass er sich nach diesem Mord physiognomisch immer mehr seinem Vater angleicht – er wird hässlich und abstoßend. Deswegen unterzieht er sich, volljährig geworden, einer Gesichtsoperation und stiehlt die Identität eines gewissen Kōichi Shintani. Der aber war selbst ein schlimmer Finger, hinter dem die Polizei her ist. Und der Clan der Kuki knackt auch alsbald Fuhimiros neue Identität und will abermals Kaori als Opfer in die Klauen bekommen. Fuhimiro muss also eine Art Zwei-Fronten-Krieg führen, wobei im Hintergrund noch eine nihilistische Terrorgruppe mitmischt, auch die aus dem Geiste der „Geschwür“-Theorie. Man sieht: Ein abgedrehter Plot, dessen Plausibilität Fuminori Nakamura in seinem Roman Die Maske einfach setzt. Das ist – legitimerweise – extrem artifiziell, und dient auch weniger dem Antrieb der Handlung, sondern ist der Untergrund für allerlei philosophische Spekulationen und Diskurse, die im Laufe des Buches immer dominanter werden. Todessehnsucht, Menschenverachtung, Identitätsauflösung, Zersetzung von Wertesystemen – das ganze nihilistische Programm seit Turgenjew, nur noch radikaler, noch düsterer eingefärbt. Diskurs-Noir, sozusagen. Das oszilliert zwischen spannend und bleischwer. Originell ist das auf jeden Fall und bleibt Nakamuras Prinzip treu, Philosopheme und zeitgeistige Themen (wie schon in „Der Dieb“, wo es um die Yakuza und den Marquis de Sade gleichzeitig ging, CrimeMag-Besprechung hier) verblüffend miteinander zu verbinden. Seltsam ist allerdings bei aller intellektuellen Brillanz, die man bestaunen kann, dass dieses Staunen nicht zündet, sondern auf der Ebene der Zeichenoperationen bleibt. Interessant, aber nicht weiter erkenntnisfördernd.
Fuminori Nakamura: Die Maske. Übersetzt von Thomas Eggenberg. Diogenes Verlag, Zürich 2018. 352 Seiten, 24 Euro.
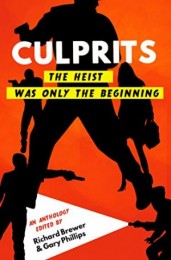 Der Überfall ist erst der Anfang
Der Überfall ist erst der Anfang
(AM) Er ist ein Klassiker der Kriminalliteratur – der Raubüberfall, auf Englisch „the heist“. Richard Stark (aka Donald E. Westlake) schickte seinen hartgesottenen Parker auf insgesamt 24 solcher Überfälle. Selten ist solch eine Aktion komplett bücher- oder filmzeitfüllend, viele von Starks Romanen beschäftigten sich vor allem mit dem Danach. Das gilt auch für die Wyatt-Bücher von Garry Disher und für Wallace Strobys Räuberin Crissa Stone. Filme wie „Ocean’s Eleven“ entwickeln viel Spaß am Davor, solche wie „The Italien Job“ schauen eher auf das Danach. Überfälle enden in Tragik oder Triumph, meistens jedoch im Chaos. „The heist always goes wrong“ heißt eine zehnteilige Serie von Andrew Nette, der mit „Gunshine State“ selbst einen formidablen Heist-Thriller vorgelegt hat.
Richard Brewer & Gary Phillips haben sich für ihren Sammelband Culprits. The Heist Was Just the Beginning eine Crew von Missetätern (Culprits) zusammengestellt, einen Überfall geschrieben, dann sieben Autorinnen und Autoren angeheuert – ebenso viele wie ihre Charaktere –, und haben ihnen die Frage gestellt: Was passiert jetzt? Jeder konnte sich eine der Figuren aussuchen und die Geschichte dann aus derem Blickwinkel weitererzählen. „Come and see what happens next“, laden sie nun in den Storyband.
Das Schöne ist, Brett Battles, Gar Anthony Haywood, Zoë Sharp, Manuel Ramos, Jessica Kaye, Joe Clifford und David Corbett sind ebensolche Profis wie man das von ihren Räuberfiguren erwartet. Sie alle tun, was sie am besten können, ziehen ihr Ding durch. Manuel Ramos erweckt in „Snake Farm“ den Geist von Jim Thompson zum Leben, Joe Cliffords Geschichte „Eel Estevez“ macht zappenduster, Zoë Sharp verbiegt die Zeit in „The Wife“, Jessica Kaye lädt zum „Last Dance“, David Corbett kümmert sich um „The Financier“. Mit dem Überfall gehen die Geschichten erst richtig los, das ist hier Programm.
Richard Brewer & Gary Phillips (Hg.): Culprits. The Heist Was Just the Beginning. An Anthology. With stories by Brewer/ Phillips, Brett Battles, Gar Anthony Haywood, Zoë Sharp, Manuel Ramos, Jessica Kaye, Joe Clifford and David Corbett. Polis Books, Hoboken, New Jersey 2018. 266 Seiten, $ 16.00.
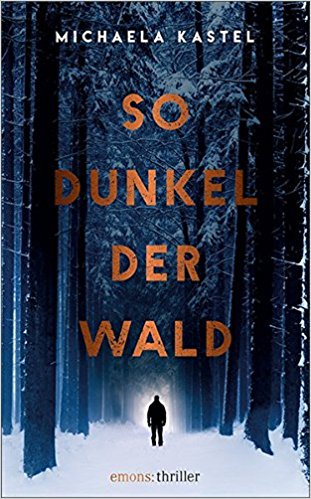 Andeutungen reichen
Andeutungen reichen
(JF) Er ist Jäger und wohnt mit seinen fünf Kindern, zwei Jungen und drei Mädchen, weit draußen im Wald. Das ist alles, was ein früherer Nachbar berichten kann. Wüsste er mehr, wäre es mit seiner Ruhe vorbei. Und er würde auch nicht behaupten, dass es sich „um ganz liebe Menschen“ handle. Denn die Kinder, von denen sich der Mann im Wald „Paps“ nennen lässt, sind nicht seine eigenen. Er hat sie entführt, um sich an ihnen zu vergehen, so lange sie klein sind. Werden sie älter, erlischt sein Interesse. Manche haben das nicht überlebt. Nur Ronja, Jannik und Nika durften zu Teenagern und jungen Erwachsenen werden. Er braucht sie als Arbeitskräfte. Und er macht sie zu Komplizen, ein Umstand, der sich als fatal erweist, als Jannik sich wehrt und zum Messer greift. Denn der Tod des Tyrannen bedeutet noch keine Freiheit.
Mit So dunkel der Wald ist der 1987 geborenen österreichischen Autorin Michaela Kastel ein fulminanter Thriller gelungen, dessen Handlung – im Unterschied zu all den wilden Fantasieprodukten, von denen es im Genre wimmelt – beunruhigende Parallelen zu tatsächlichen Kriminalfällen aufweist. Kastel ist eine subtile Erzählerin, die auf die Vorstellungskraft ihrer Leserinnen und Leser setzt, und man ist dankbar dafür. Andeutungen reichen, um die Lektüre des Romans zu einer beklemmenden Angelegenheit werden zu lassen, auch wenn sich am Ende ein Hoffnungsschimmer zeigt. Während nämlich Jannik seinem Peiniger über dessen Tod hinaus ausgeliefert zu sein scheint, erweist sich Ronja, die über weite Strecken auch als Ich-Erzählerin fungiert, als starke Persönlichkeit, die ihre Vergangenheit hinter sich lassen kann. Und das möchten man gerne glauben.
Michaela Kastel: So dunkel der Wald. Thriller. Emons Verlag, Köln 2018. 303 Seiten, 18 Euro.
Das Buch war besser …
(AM) In Österreich verdrängte Red Sparrow sogar den „Black Panther“ vom Spitzenplatz der Kino-Hitliste. Jennifer Lawrence als russische Spionin Dominika Egorowa in der Hauptrolle und eine geschickte Film-PR lassen den Film besser erscheinen als er tatsächlich ist: nämlich flach wie ein Bierdeckel, emotional öde und unangenehm unnötig und widerwärtig brutal, Kinolegenden wie Charlotte Rampling und Jeremy Irons sind darin kaum von der Tapete unterscheidbar. An Geld und Zeit lag es nicht, mit 141 Filminuten und einem fetten Budget hätte man weit Besseres anfangen können. Aber die Surrogatindustrie braucht vermutlich genau solche Zäpfchen.
Im Vergleich dazu ist der in USA bereits 2013 erschienene Roman eine Erholung, eine Offenbarung aber nicht. Autor Jason Matthews arbeitete über 30 Jahre in der Operationsleitung der CIA, war auf Informationsgewinnung in Sperrgebieten und auf verdeckte Einsätze spezialisiert. Fiktion von ehemaligen CIA-Offizieren jedoch – das ist leider fast schon ein Axiom – kommt so gut wie immer vom Bügel- oder Reissbrett und aus dem Genehmigungsbüro, hohe Sprünge machen hier weder Poesie noch Subversion. Ein Autor wie David Stone (The Echelon Vendetta und drei weitere) ist halt schon eine Weile her. Anders als im Film, wo das zum Haupt-Suspense wird, kennt man im Buch den russischen Maulwurf an hoher Stelle schon im ersten Kapitel, auch entwickelt sich die Romanze zwischen der zur Hure umgeschulten Ballett-Tänzerin Dominika Egorowa und dem CIA-Agenten Nash weit glaubhafter. Mittlerweile hat sich diese Affäre zu einem Roman-Dreiteiler ausgewachsen, Brian Freemantle hat das aber bereits vor fast 20 Jahren mit seinem britischen Spion Charlie Muffin und dessen KGB-Ehefrau Natascha weit witziger und respektloser vorexerziert (Comrade Charlie, 1989, etliche Folgende, wirklich ein Spaß). Weit deutlicher im Buch herausgearbeitet sind der russische Hintergrund und die auch verqueren Formen von Patriotismus. Im Film hat Jennifer Lawrence halt eine kranke Mutter, für die sie all die Torturen auf sich nimmt, im Buch gibt es zudem einen Vater, einen Geschichtsprofessor – sowie wahnsinnig viel Tradecraft, am Ende jeden Kapitels ein Rezept, und frivole Details wie das geheime Leben einer Haarbrüste.
Jason Matthews: Red Sparrow (USA 2013). Thriller. Aus dem Amerikanischen von Michael Benthack. Goldmann Taschenbuch, München 2018, Sonderausgabe als „Buch zum Film“, erstmals 2015. 671 Seiten, 9,99 Euro.
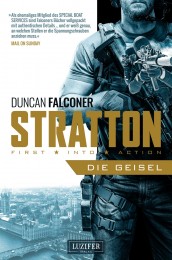 … sagen die Ziegen hier wieder
… sagen die Ziegen hier wieder
(AM) Auch hier passt der Witz von Len Deighton, der in „Close Up“ (1972) zwei hungrige Ziegen eine Filmdose finden und die eine sogleich das Zelluloid begierig futtern lässt. Enttäuscht rülpst sie nach ein paar Bissen: „Das Buch war besser.“
Regisseur Dominic West kam eigentlich mit genügend Expertise zu „Stratton„, hatte vor zwei Jahrzehnten bereits „Con Air“, dann „Lara Croft: Tomb Raider“ mit Angelina Jolie, 2011 Jason Statham in „The Mechanic“ und die „Expendables 2“ gemacht. Für seinen aktuellen „Stratton“ jedoch meldet „Rotten Tomatoes“ ein Approval-Rating von 0%, basierend auf 32 Besprechungen und als Durchschnittswert 3.1 von 10 Punkten. „Die Action-Thriller-Ambitionen werden rundherum verzwergt von einer zweitrangigen Erzählung, von Fehlbesetzungen, Low-Budget-Look und uninteressanten Schauplätzen.“ In Großbritannien startete der Film am 5. Januar dieses Jahres, er hat noch keine 200.000 Pfund eingespielt. In Deutschland wird er wohl kein Kino sehen. Gut, dass er nur eine Stunde 34 Minuten dauert, vermutlich tut das DVD-Format ihm gut. Vermutlich hat der Luzifer-Verlag – von dem wir kürzlich das hier nochmals dringlich empfohlene „Run“ von Douglas E. Winter vorstellen konnten – auf einen gewissen Kino-Schub gehofft, jetzt aber muss Stratton. Die Geisel, solide als Klappenbroschur ausgestattet, es alleine auf sicheres Gebiet schaffen.
Duncan Falconer ist das Pseudonym eines früheren Specials Forces Soldaten, er diente beim Special Boat Service, der britischen Entsprechung der US Navy Seals, war danach bei privaten Sicherheitsfirmen aktiv, kennt die Krisen- und Kriegsgebiete der Welt aus erster Hand. Vor ihm hatten bereits die einstmaligen Soldaten Andy McNab und Chris Ryan den Sprung in die Fiktion getan. Nach einem ersten – erfolgreichen – Sachbuch, „First into Action“ (1998) begann Falconer eine Serie mit dem SBS-Agenten Stratton. Die Geisel ist der erste seiner mit viel Fach- und Insiderwissen ausgestatteten bisher acht Söldner&Soldaten-Romane, sie entstanden zwischen 2003 und 2013, die Copyrightzahl 2010 im Impressum ist ein wenig Camouflage. Duncan Falconer gehört zu den eher angenehmeren Vertretern des military thrillers, sein Erstling spielt zwischen Irland, England und Paris, zeigt bereits Qualitäten. Stratton erkennt am Ende: „Er lebte nur dann richtig auf, wenn es hoch herging. Je näher er dem Tod war, desto lebendiger fühlte er sich. Es war wie eine Droge; das High hielt nur so lange an, wie der Kampf dauerte.“ — Also bricht er auf nach Osten, dorthin wo die Konflikte sind. Wie gesagt, 2003. Da lag er ja nicht so falsch.
Duncan Falconer: Stratton. Die Geisel (The Hostage, 2003). Thriller. Übersetzt von Sebastian Gruner. Luzifer Verlag, Drensteinfurt 2018. Klappenbroschur, 612 Seiten, 14,95 Euro.













