 Ein Autor, trotz Fluchtauto, dingfest gemacht
Ein Autor, trotz Fluchtauto, dingfest gemacht
„The Getaway Car“ versammelt die Texte von Donald E. Westlake – von Alf Mayer.
Quasi unter der Ladentheke, jedenfalls deutlich unter ferner liefen, präsentierte die University Press of Chicago auf der Frankfurter Buchmesse von 2008 die ersten bei ihr wiederaufgelegten hardboiled-Romane von Richard Stark. Mittlerweile nehmen die je mit einem Vorwort ergänzten Romane um den Berufsverbrecher Parker eine tischplattengroße Ecke auf dem Buchmessenstand ein, 25 der insgesamt 28 Titel sind inzwischen neu editiert. Man wird nicht mehr mit leicht hochgezogenen Augenbrauen begrüßt, wenn man am Stand nach dem Fortgang der Neuedition fragt; es kann sogar sein, dass man an jemanden gerät, der einen Anfangssatz aus einem Parker-Roman zitiert.
Der Pulp-Autor und sein niemals lange fackelnder Held haben es zu einer achtbaren akademischen Karriere gebracht – wäre so etwas an einer deutschen Universität denkbar? Die Neuauflagen der einstigen Schmuddelbücher machen sich auch in der ökonomischen Bilanz des Universitätsverlages bemerkbar.
Dieses Jahr nun stand auch der Urheber des Ganzen selbst, nämlich der Schriftsteller Donald E. Westlake, mit einem Buch unter all den Parker-Titeln, die er unter dem Pseudonym Richard Stark verfasst hat.
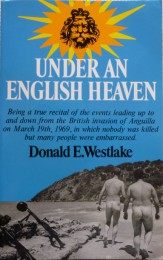 Nahezu unsichtbar als Kommentator
Nahezu unsichtbar als Kommentator
„The Getaway Car. A Donald Westlake Nonfiction Miscellany“, heißt das Werk und versammelt bislang unbekannte oder nur in entlegenen Einzeltexten zugängliche Beute – Westlakes Reden und Vorträge, Vorworte, Interviews, Briefe, zusammengetragen und herausgegeben von Levi Stahl, der die Parker-Romane einst dem Universitätsverlag schmackhaft machte und für die Neuausgaben verantwortlich zeichnet. In seinen Büchern war der Autor Westlake stets ein nahezu Unsichtbarer. Anders etwa als bei John MacDonald oder Raymond Chandler gibt es in seinen über 100 Romanen kaum Passagen oder Bemerkungen, die ihm direkt als eigene Meinung oder Weltsicht zugeschrieben werden könnten.
Westlake, das sind seine Figuren. Als Parker wissen wir von ihm, dass er harte Arbeit und Handwerk schätzt, Schlamperei verachtet; aus den Dortmunder-Büchern haben wir gelernt, dass er sich selbst nicht allzu ernst nimmt und jede Menge Scherze mag. Tucker Coe geht das Leid der Opfer an die Seele; der Cop Levine versucht, in der Megastadt New York bei aller gebotenen Härte menschlich zu bleiben. Westlake hat einen Sinn für die Komödien und schrägen Seiten des Lebens; als Parker hat er dessen Härten verinnerlicht und behauptet stoisch eine Unabhängigkeit, dies gegen jede Organisationsform, Verbrechersyndikate inbegriffen: The Last of the Independents. Aber das ist auch schon ziemlich alles. „The Getaway Car“ nun erlaubt, so Herausgeber Levi Stahl, den bisher nahesten Blick auf diesen Autor, was er denkt, wie er tickt. Westlake hat bis auf eine Ausnahme – die schräge Invasion der Briten auf der Karibikinsel Anguilla (Under an English Heaven, 1972, eine Art „Britain’s Bay of Piglets“) – keine Nonfiction geschrieben, erstaunlich eigentlich, wenn man an all seine Jahrzehnte an der Schreibmaschine denkt.
 Nicht ohne meine Schreibmaschine, die Super 5
Nicht ohne meine Schreibmaschine, die Super 5
Ein Herzinfarkt fällte den schlaksigen, 75 Jahre alten Westlake auf dem Weg zum Silvesterdinner des Jahres 2008 in Mexiko. Er war dort nicht nur des Urlaubs wegen, so erzählte es mir sein zeitweiliger Verleger Otto Penzler, er war stets auf der Jagd nach Ersatzteilen für seine geliebten Smith-Coronas, Mexiko war dafür das gelobte Land. Westlake besaß mehrere Exemplare der „Super 5“-Serie, die lange bei Autoren wie Typistinnen als die beste Reiseschreibmaschine schlechthin galt. Gebaut wurde sie zwischen 1949 und 1960. Werksreparaturen blieben bis 1994 möglich, dann verlagerte Smith-Corona die geschrumpfte Fabrik nach Mexiko, ein damals weithin kommentiertes Ergebnis der verfehlten Busch’schen Industriepolitik, ehe das Unternehmen kurz danach in Konkurs ging und die Maschinenteile in alle Winde zerstoben.
Westlake schrieb seit er elf war, hauptberuflich seit 1959. Sieben Tage in der Woche. Über 100 Bücher wurden es, mehr als eine Handvoll Pseudonyme, fast ein Dutzend Drehbücher, darunter eine Oscar-Nominierung für die Jim Thompson-Adaption „The Grifters“ und drei Anläufe mit Hammetts „Blutige Ernte“ für Volker Schlöndorff. Seinen Computer benutzte Westlake für E-Mails, die Romane und Scripts entstanden alle auf einer Smith Corona. In seiner Arbeitsdisziplin berief Westlake sich auf den Violinisten Yehudi Menuhin, den er einmal fragte, ob er denn jeden Tag übe. Ja, antwortete Menuhin, wenn ich einen Tag aussetze, merke ich es sofort. Wenn ich zwei Tage Pause mache, merkt es der Dirigent, und wenn es drei Tage sind, dann merkt es das Publikum.
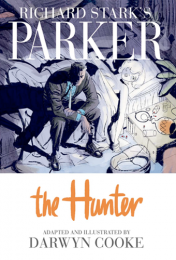 28 Romane als Richard Stark
28 Romane als Richard Stark
Hätte Westlake nur seine ersten fünf hartgesottenen Romane geschrieben, wäre ihm eine Fangemeinde sicher, auch für die fast 20 Bücher mit dem schussligen Dieb John Dortmunder. Mit seinem Gesamtwerk aber gilt er als Großmeister, gewann drei Mal den „Edgar“. Der irische Booker-Preisträger John Banville hält ihn für „einen der größten Autoren des 20. Jahrhunderts“. Niemals ein schlechter Satz, kein Firlefanz, trockener Witz, emotionale Distanz, unprätentiöse Recherche, Realismus und ein scharfes Auge für Details, das kennzeichnet den Autor Westlake.
Im Jahr 1962, in einem Pulp-Taschenbuch zum Preis von 25 Cent, hatte Westlakes berühmteste Gestalt den ersten Auftritt. Der wortkarge Profiverbrecher Parker erschien nach „The Hunter“ (1968 bei Ullstein auf Deutsch als „Jetzt sind wir quitt“) in bis heute insgesamt 28 Romanen, alle unter dem Autorenpseudonym Richard Stark. Auf den Namen war er noch als Kurzgeschichtenschreiber gekommen, weil manchmal mehrere seiner Geschichten gleichzeitig in einer Magazinausgabe erschienen. Der Name war eine Art Gedächtnisstütze. Westlake dazu: „Richard für Richard Widmark und Stark für das englische Wort für rein sachlich, damit ich diese Schreibhaltung nicht vergesse.“ So sind dann auch die Parker-Romane: staubtrocken und knallhart, kein Wort zu viel. Musterbeispiele schlankester Prosa. Eine Schule für inzwischen Generationen von Autoren. „Wer auf schöne Adjektive wartet, wird hier verhungern“, sagt Westlake über Stark.
Nur in einem einzigen Buch, im toughsten von allen, 1966 am Ende von „The Seventh“,lacht Parker. Sonst ist der Mann ohne Vornamen knochenernst, immer auf der Hut. Er ist ein Räuber und Dieb, der sich auch von der Mafia nicht organisieren lässt und keine Prozente abdrückt. In einer Welt der Angestellten ist er der ultimative Freiberufler, ein Handwerker des Verbrechens, ein Pirat, eine Provokation. Auch Godard versuchte sich mit „Made in U.S.A.“ und Anna Karina als Parker an einer filmischen Adaption (1966, nach „The Jugger“), am bekanntesten ist John Boormans Verfilmung von „The Hunter“ als „Point Blank“ mit Lee Marvin von 1967. Den besten Parker gab Robert Duvall in John Flynns „The Outfit“ (1973), den mickrigsten Mel Gibson in „Payback“ (1999), selbst von Jason Stratham in „Parker“ (2013) an die Wand gespielt. Westlake selbst hätte Jack Palance als Parker besetzt, „weil der niemals Faxen macht“. Von 1974 bis 1997 blieb Parker verschollen, Westlake gab seiner coolsten Figur 23 Jahre Pause. Bis 2008 erschienen acht weitere Parker-Romane. In Deutschland war ihre Edition zwar hochwertig, aber kurios und durcheinandergewirbelt.
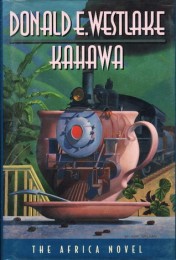 Idi Amis Kaffeeernte – geklaut, samt Güterzug
Idi Amis Kaffeeernte – geklaut, samt Güterzug
Dürfte ich wählen unter den 100 Romanen, nähme ich für eine Westlake-Prunkedition den Kapitalismusthriller „Kahawa“ von 1982. Westlake selbst sah diese unglaubliche Schwarte als sein bestes Werk, „weil es meine lustigen und meinen harten Seiten zusammenbringt“. Idi Amins mit menschlichen Körperteilen gefüllter Kühlschrank, Grausamkeiten und Ironie, Spaß und Entsetzen, brutale Lektionen und große Gefühle, witzige Dialoge und akribische Recherche, ausgetüftelte Feinmechanik und jede Menge Realismus machen diesen viel zu kurzen Wälzer zu einem der besten und intelligentesten Abenteuerromane, den ich je gelesen habe. Eine bunte Bande von Freiberuflern lässt im Reich des blutrünstigen Diktators Idi Amin einen Riesengüterzug verschwinden, Ugandas komplette Kaffee-Ernte. An den (Kaffee-)Börsen ist der Teufel los …
Das Titelblatt der Westlake-Texte ziert eine Illustration von Darwyn Cooke, der mittlerweile vier Parker-Romane kongenial als Graphic Novel umgesetzt hat. Der Titel des Buches stammt von Westlakes Witwe, der Begriff Fluchtwagen hat nichts mit dem Parker-Roman „The Man with the Getaway Face“ zu tun. Das als Motto vorangestellte Epitaph von Abby Adams Westlake lautet: „No matter where he was headed/ Don always drove like he was/ behind the wheel of the getaway car.“ Auch sein Freund Larry Block bestätigt das im Vorwort: „Wenn Don sich hinters Steuer setzte, wurde er zu Stan Murch, dem erstklassigen Fluchtfahrzeugfahrer der Dortmunder-Gang. Sein ideales Auto war eines, das ihn von Punkt A nach B in null Sekunden brachte.“ Müßig zu erwähnen, dass das viele Strafzettel kostete und einmal auch den Führerschein. „Westlakean“ nennt Larry die kleine Geschichte, dass Don von seiner Autoversicherung Bonuspunkte bekam, weil er drei Jahre unfallfrei gefahren war.
Humor war definitiv ein Element bei Westlake, die trockenste Form fand er bei Parker. Im voluminösen „Butcher’s Moon“ (Blutiger Mond, 1974), der die Serie 1974 für 23 Jahre abschloss und die dann auch nie wieder zu ihrer alten, beinharten Form fand, jammert ein Ganove: „Aber ich bringe doch nur eine Nachricht.“ Parker antwortet: „Jetzt bist du die Nachricht“, und erschießt ihn. Westlake selbst war für harte Witze gern zu haben, rief einmal einen Totgesagten auf folgende Weise an: „Ich habe gehört, du bist gestorben“, meldete er sich bei Ed Gorman. „Nein, das stimmt nicht“, antwortete der. „Dann ist es ja gut“, meinte Westlake. Und legte auf.
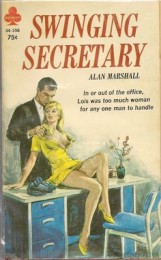 „Living with a Mystery Writer”
„Living with a Mystery Writer”
Levi Stahl hat ein äußerst kurzweiliges Buch mit immensem Spaßfaktor zusammengestellt – auch wenn er richtig anmerkt, dass dies alles wohl eine Angelegenheit für Fans sei. Sein wie ein großes Schlemmermenü angelegter Band beginnt mit einer autobiografischen Skizze, führt über Westlakes Pseudonyme zu dessen Texten über das Genre – darunter ein 20 Seiten umfassender kluger Vortrag im Smithsonian über den „hardboiled dick“ –, nennt die zehn ihm liebsten Kriminalromane (siehe ganz unten), bringt einige eigene Vorworte, hat zwei Kochrezepte von Dortmunder, gibt Auskunft über Vorlieben, Vorbilder und über einige Kollegen, enthält zwei Interviews, einige Nebenjobs, ein Dutzend Briefe und Dons Vorstellung vom Himmel. Ein informatives Vorwort steuert sein alter Freund Lawrence „Larry“ Block bei, mit dem er viel unternahm und auch einige (halbpornografische) Bücher verfasste, etwa „Swinging Secretary“ unter dem gemeinsamen Pseudonym Alan Marshall. Auf dem sinnlichen Cover heißt es: „Boss, I’ll lend you a book! In or out of the office, Lois was too much woman …“
Einer der schönsten Texte stammt von Abby Adams und heißt „Living with a Mystery Writer“. Mit einem Mann zu leben (sie war Westlakes dritte Frau), sei gewiss schon schwer genug, das mit einer ganzen Gruppe zu müssen, könne nervenaufreibend sein. „Ich lebe nun seit fünf Jahren mit diesem Konsortium, das sich Donald Westlake nennt, immer noch kann ich mir beim Aufwachen nicht sicher sein, mit wem von der Meute ich heute beim Frühstück Kaffee trinken werde. Mit dem melancholischen Tucker Coe, dem Gelegenheitsjobber Timothy Culver, dem mürrischen und peniblen Richard Stark oder mit Westlake selbst, bescheiden, unprätentiös und humorvoll.“
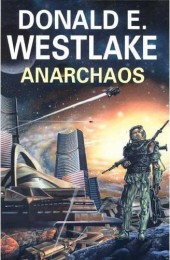 Von dieser Vielgestaltigkeit gibt auch der witzige Text „Hearing Voices in My Head“ unterhaltsam Auskunft, der 1977 in der Anthologie „Murder Ink“ erschien. Westlake lässt darin himself & seine Pseudonyme zu einer Talkshow antreten. Seine Figuren geben munter allerlei literarische Urteile und Vorlieben preis, streiten und brüsten sich, bis Parker am Ende alle Teilnehmer ausraubt. („No book published since 1974. How do you think I live? Give me everything you’ve got.“)
Von dieser Vielgestaltigkeit gibt auch der witzige Text „Hearing Voices in My Head“ unterhaltsam Auskunft, der 1977 in der Anthologie „Murder Ink“ erschien. Westlake lässt darin himself & seine Pseudonyme zu einer Talkshow antreten. Seine Figuren geben munter allerlei literarische Urteile und Vorlieben preis, streiten und brüsten sich, bis Parker am Ende alle Teilnehmer ausraubt. („No book published since 1974. How do you think I live? Give me everything you’ve got.“)
In seinem bemerkenswerten Vortrag „The Hard-Boiled Dicks“ führt Westlake durch die Evolution des Detektivromans. Verbrechen meint er darin, sei elementar für einen Geschichtenerzähler. „Mit der Gesellschaft, dem Individuum und einem Verbrechen hat man all die vielzähligen Möglichkeiten des Dramas und zudem all die vielen Wege des freien Willens – also des ganzen Lebens.“
Als einer der allerbesten Autoren galt ihm Charles Willeford, für eine Neuausgabe von „The Way We Die Now“ schrieb er das Vorwort. Mit John MacDonald machte er eine Ozeanreise, Peter Rabe schrieb er einen Brief voller Hochachtung und Dankbarkeit. Dem im Gefängnis einsitzenden literaturinteressierten Bankräuber Al Nussbaum gewährte er ein langes Interview, und wir erfahren auch, dass Westlake ein halbes Jahr bei der U.S.-Airforce in Ramstein verbrachte. Recherche hasste er, geriet dann aber an die Idee, Idi Amins Kaffee-Ernte stehlen zu lassen, samt dem Güterzug, der die Ernte quer durch Afrika zum Seehafen bringt. Dafür las er nicht nur das 1200-Seiten-Werk „The Permanent Way“ über den Eisenbahnbau in Zentralafrika (tolles Buch, übrigens), sprach mit allerlei Experten, er reiste auch nach Kenia, sah sich um, und bemerkt trocken: „Trips to Uganda were mostly one way, so I skipped that.“
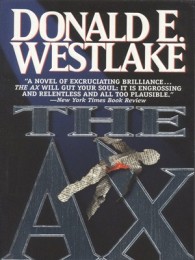 Parker und seine Spießgesellen
Parker und seine Spießgesellen
Insgesamt spiegelt der Sammelband, was vermutlich unser aller Wahrnehmung von Westlake prägt: dass er zwar ungeheuer viele und vielgestaltige Komödien und caper novels schrieb, sein hauptsächlicher Impakt aber die hartgesottenen Parker-Romane waren. Garry Dishers australischer Outlaw Wyatt steht in seinen Fußstapfen, vorbildlich betreut von Frank Nowatzki und Pulp Master. Nächstes Jahr wird mit „Kalter Schuss ins Herz“ Wallace Strobys Berufsverbrecherin Crissa Stone als toughe weibliche Nachfolgerin nach Deutschland kommen. Der bekennende Melville- und Parker-Fan Stroby hat gerade den vierten Crissa-Stone-Roman bei seinem US-Verleger abgeliefert.
Ende der 1960er Jahre wurde Richard Stark besser bezahlt als Donald Westlake oder eines der anderen Pseudonyme. Bevor Westlakes erste Krimikomödie „The Fugitive Pigeon“ erschien, waren bereits sechs Parker-Bretter auf dem Markt. In einem Text über Stephen Frears, der Jim Thompsons „The Grifters“ mit der großartigen Angelica Huston verfilmte, erinnert Westlake sich amüsiert daran, wie er sich vor Arbeitsaufnahme mit dem britischen Regisseur über den zu erwartenden Stil der Adaption unterhielt. Der wollte den seit zwei Jahrzehnten verstummten Parker als Autor, kein Gramm Romanze im Film, keinen Westlake, bestand sogar darauf, dass „Richard Stark“ den Vertrag unterschrieb. Am Ende führte das zu einer Oscar-Nominierung für die beste Drehbuch-Adaption und Westlake ließ tatsächlich seine Figur Parker wiederkehren, auch wenn die nie ganz wieder die Härte und Lakonie der ersten 20 Bücher erreichten.
Eigentlich war Parker nie auf Serie angelegt, in der ersten Fassung von „The Hunter“ sollte er am Ende sterben, ein Lektor verhinderte das und Westlake bekam Lust darauf, diesen Kerl in immer wieder neue Situationen zu stecken. In „Breakout“ etwa ließ er den noch nie Erwischten ins Gefängnis geraten, einfach um selbst zu sehen, wie Parker damit fertig würde. „Wenn der Autor nicht weiß, was mit seiner Figur als Nächstes passiert, wird das auch kaum ein Leser erraten, also haben wir alle unseren Spaß und unsere Spannung“, bemerkte er dazu.
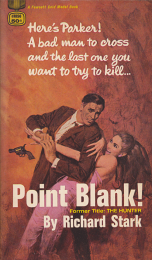 Westlake, der Spaßvogel, lugt auf vielen Seiten des Bandes um die Ecke. Zum Ende gibt es eine dreiseitige Liste nicht verwendeter Buchtitel. Einige führe ich hier auf:
Westlake, der Spaßvogel, lugt auf vielen Seiten des Bandes um die Ecke. Zum Ende gibt es eine dreiseitige Liste nicht verwendeter Buchtitel. Einige führe ich hier auf:
All Fools in a Circle / Died in the Wool / Man Here Says He Has A Gun / Never Say Die / Publish and be Damned / Ready Money / Seven Men and a Bank / Worse than a Crime.
Und dann noch als Titel: Read Me.
Ab also, in Westlakes Fluchtauto. Und viel Vergnügen!
PS: 1995 beantwortete Westlake die Frage nach den zehn besten Kriminalromanen, indem er neun nannte, darunter zwei Serien, dies in alphabetischer Folge, „following my own alphabet“:
Die Hoke Mosely Serie von Charles Willeford
„The Red Right Hand“ von Joel Townsley Rogers
„Kill the Boss Goodbye“ von Peter Rabe
Die Gravedigger/ Coffin Ed-Serie von Chester Himes
„The Maltese Falcon“ von Dashiell Hammett
„Interface“ von Joe Gores
„The Eight Circle“ von Stanley Ellin
„Sleep and His Brother“ von Peter Dickinson
„The Light of Day“ von Eric Ambler
Alf Mayer
Levis Stahl (Hg.): The Getaway Car. A Donald Westlake Nonfiction Miscellany. With a Foreword by Lawrence Block. Mit Namens- und Titelregister. The University of Chicago Press, Chicago und London, 2014. Trade Paperback, 224 Seiten. $ 18.00. Infos zum Buch. Das Inhaltsverzeichnis des Bandes findet sich hier.
Offizielle Webpräsenz von Donald Westlake. Schöner Text und Übersicht über Westlakes Bücher. Ein Blog mit Besprechungen aller Bücher.
Infos und Grafik zu Fifty Years of Parker hier und hier.











