Strafe, für was auch immer
Die mörderisch triviale Gebrauchsliteratur des Ferdinand von Schirach – Von Thomas Fischer.
Schon mit seinen ersten Kurzgeschichten über angeblich authentische Kriminalfälle wurde Ferdinand von Schirach vom Feuilleton zur Star ausgerufen. „Strafe“ ist sein siebtes Buch, auch hier türmt sich das Lob – wir sind da skeptischer und haben Bundesrichter a. D. Thomas Fischer zu Rate gezogen.
Ferdinand von Schirach hat ein neues Buch veröffentlicht: „Strafe“. Es wird als Meilenstein empathischer Strafrechtskunde allgemein sehr gelobt, ist kurz davor, den Ehrenpreis des deutschen Existenzialistenverbandes zu erhalten, und enthält zwölf (Zufall?) lustige Geschichten darüber, wie das Leben so spielt. Nichts Menschliches ist dem Dichter fremd, und dem Anwalt erst recht nicht. Es gab vor langer Zeit einmal eine tolle Sammlung von originellen Todesarten aus der BILD-Zeitung, im Stil von: „Oma von Kokosnuss erschlagen“, oder „Dackel stürzt Rentner vom Eiffelturm“, usw. So ähnlich darf man sich das vorstellen.
Ein Ostermärchen
Meine Lieblingsgeschichte ist die vom Taucher: Eine sehr fromme Dame findet bei der Rückkehr vom Karfreitags-Beten ihren unter Föhneinwirkung leider sexuell deviant gewordenen Gatten im Taucheranzug, vollgeklebt mit Käse-Scheibletten, ein Seil zwecks Orgasmussteigerung um den Hals, in kritischem Zustand; etwas später ist er tot. Sie verschleiert die peinliche Sache, kommt wegen Mordverdachts in U-Haft, dann aber wieder raus, weil sich am Ostersonntag der Taucheranzug findet und die Sache mit den Scheibletten aufklärt. Schirach lässt einen Sachverständigen auftreten, der dem Leser den Zusammenhang von Frischhaltefolie und Orgasmus erklärt. Da weiß der Richter auch nicht weiter und wünscht der Witwe „schöne Feiertage“. Sie geht nachhause und sitzt am Ostermontag wieder in der Kirche. Im letzten Satz erfahren wir, dass sie den geburtstraumatisierten Fetischisten doch getötet hat. Aber das bleibt unter Schirach und uns.
Ich finde, das ist eine anrührende Geschichte aus dem Leben von wem auch immer. Ich könnte sie mir sehr gut verfilmt als Lena-Odenthal-„Tatort“ vorstellen, mit Axel Milberg als Taucher; Lisa Wagner als Gattin, Jan Liefers als Priester und Udo Samel als Ermittlungsrichter mit Cordjacke. Man müsste allerdings, damit es nicht allzu langweilig wird, noch eine SM-Beziehung zwischen der Kommissarin und dem Priester einbauen.
Kleine Rechtssprechungsübersicht
Andere Fälle kommen einem seltsam bekannt vor. Beim Blättern im Jahrgang 2012 der Neuen Zeitschrift für Strafrecht zum Beispiel stößt man auf den Beschluss 3 StR 109/12 (S. 709 f.). Da hatte ein Täter 300 Gramm Marihuana zwecks Handeltreibens aus einem Versteck im Wald geholt und im Auto transportiert; hierbei führte er ein Messer mit sich und hatte eine BAK von 1,43 Promille. Wegen der Trunkenheitsfahrt kriegte er einen Strafbefehl, der rechtskräftig wurde. Dann verurteilte ihn das LG Düsseldorf wegen bewaffneten Handeltreibens mit BtM in nicht geringer Menge zu zwei Jahren sechs Monaten Freiheitsstrafe. Der BGH hob das Urteil auf, weil das Handeltreiben und die Trunkenheitsfahrt eine Tat waren (§ 264 StPO) und daher mit dem Strafbefehl Strafklageverbrauch für alles vorlag: Ne bis in idem.
 Man findet das im StPO-Kommentar von Meyer-Goßner in Randnummer 2a zu § 264 StPO. Wenn man daraus einen Bestseller machen will, muss man sich als Dichter natürlich was einfallen lassen. Bei Schirach heißt das Drama „Ein kleiner Mann“ und geht so: Strelitz – Schirach nennt die Figuren gern schlicht beim Familiennamen; das hat etwas Brechtisches und vermittelt eine Stimmung des existenziell Dahingeworfenseins – ist ein „kleiner Mann“, daher sammelt er Biografien von Mussolini, Einstein und Prince (Goebbels fehlt) und hat kein Glück bei Frauen. Beim Türken gegenüber (Strelitz wohnt in Kreuzberg) beobachtet er zwei tätowierte Rauschgifthändler die, wie es der Zufall will, alsbald eine Sporttasche im Keller des von S. bewohnten Hauses verstecken. Strelitz erkennt sogleich: ein „Bunker“. Flugs stellt er die Tasche sicher; die 6 kg Kokain erkennt er durch die geschlossene Verpackung. Schlau wie er ist, geht er gleich wieder zum Türken gegenüber und bietet ihm die sechs Kilo an. Kein Problem, sagt der Türke, er kenne da einen Interessenten. Man ahnt es schon: Der Interessent ist der Tätowierte vom letzten Mal. Verfolgungsjagd; Strelitz baut mit Kokain, Pfefferspray und BAK über 1,1 Promille einen Unfall; es folgen Bewusstlosigkeit, Krankenhaus, U-Haft. Der kleine Held lebt auf, weil er jetzt eine große Nummer im Knast ist (Achtung: Psychologie!). Den ihm offenbar dort zugestellten Strafbefehl wegen der Trunkenheitsfahrt nimmt er hin; dann kommt eine Anklage wegen bewaffneten Handeltreibens mit BtM in nicht geringer Menge (Mindeststrafe: Fünf Jahre). Im Hauptverhandlungstermin beim Landgericht sitzen die Richter ohne Robe herum und erklären ihm und dem Leser, was ne bis in idem ist. Dann stellen sie das Verfahren nach § 206a StPO ein, weil „das Amtsgericht einen Fehler gemacht hat“. Der große Herr Strelitz darf nach Hause und ist wieder klein.
Man findet das im StPO-Kommentar von Meyer-Goßner in Randnummer 2a zu § 264 StPO. Wenn man daraus einen Bestseller machen will, muss man sich als Dichter natürlich was einfallen lassen. Bei Schirach heißt das Drama „Ein kleiner Mann“ und geht so: Strelitz – Schirach nennt die Figuren gern schlicht beim Familiennamen; das hat etwas Brechtisches und vermittelt eine Stimmung des existenziell Dahingeworfenseins – ist ein „kleiner Mann“, daher sammelt er Biografien von Mussolini, Einstein und Prince (Goebbels fehlt) und hat kein Glück bei Frauen. Beim Türken gegenüber (Strelitz wohnt in Kreuzberg) beobachtet er zwei tätowierte Rauschgifthändler die, wie es der Zufall will, alsbald eine Sporttasche im Keller des von S. bewohnten Hauses verstecken. Strelitz erkennt sogleich: ein „Bunker“. Flugs stellt er die Tasche sicher; die 6 kg Kokain erkennt er durch die geschlossene Verpackung. Schlau wie er ist, geht er gleich wieder zum Türken gegenüber und bietet ihm die sechs Kilo an. Kein Problem, sagt der Türke, er kenne da einen Interessenten. Man ahnt es schon: Der Interessent ist der Tätowierte vom letzten Mal. Verfolgungsjagd; Strelitz baut mit Kokain, Pfefferspray und BAK über 1,1 Promille einen Unfall; es folgen Bewusstlosigkeit, Krankenhaus, U-Haft. Der kleine Held lebt auf, weil er jetzt eine große Nummer im Knast ist (Achtung: Psychologie!). Den ihm offenbar dort zugestellten Strafbefehl wegen der Trunkenheitsfahrt nimmt er hin; dann kommt eine Anklage wegen bewaffneten Handeltreibens mit BtM in nicht geringer Menge (Mindeststrafe: Fünf Jahre). Im Hauptverhandlungstermin beim Landgericht sitzen die Richter ohne Robe herum und erklären ihm und dem Leser, was ne bis in idem ist. Dann stellen sie das Verfahren nach § 206a StPO ein, weil „das Amtsgericht einen Fehler gemacht hat“. Der große Herr Strelitz darf nach Hause und ist wieder klein.
Mein lieber Schwan! Das ist aber mal ein Kriminalfall! Es geht dem Dichter hier um die schonungslose Darlegung menschlicher Traumata. Strelitz zum Beispiel trägt „spezielle Schuhe“ mit 50 mm-Absatz. Die BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2012 in der Bearbeitung durch Schirach ist somit unbedingt für den Grundkurs Deutsch („Interpretation“, Klasse 9) zu empfehlen.
„Zur Strafe“, schreibt Florian Illies als Werbebotschaft auf dem rückwärtigen Schutzumschlag, werde man „süchtig“ nach der unwiderstehlichen Prosa von Schirach. Und zwar „weil wir alle einsam sind“ und Schirach davon erzähle, „wohin das führen kann“. Das ist ein kongenialer Einstieg ins Schirachsche Welttheater, in dem „wir alle“ verloren unter dem Himmel stehen und immerzu passiert, was irgendwie passieren muss, oder auch nicht, oder vielleicht. Denn so ist es nun mal: Der Ball ist rund, und wohin das führen kann, steht jeden Tag in der BILD.
Zum Glück gibt es den BGH. Er nimmt die Fälle, wie sie kommen, und schreibt pro Jahr 300 kurz gefasste Feststellungen in Entscheidungen, die in Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Das entlastet den Dichter ein wenig vom Dichten und gibt ihm Raum, sich aufs Schicksalhaft-Lapidare zu konzentrieren.
Es ist also nicht ganz so, wie Andreas Zielcke am 8. März 2018 in der Süddeutschen jubilierte: Eine „Orientierung an echten Fällen“, die Schirach „wegen des Anwaltsgeheimnisses“ ein wenig habe abwandeln müssen. Von „Anwaltsgeheimnis“ keine Spur. Das ist auch gut so, denn würde Schirach echte Mandanten derart verraten, wäre er die längste Zeit Mitglied der Anwaltskammer gewesen. Das eigentlich Interessante ist vielmehr, dass der Autor ständig damit kokettiert, vorgeblich „eigene“ Fälle zu beschreiben, und dass ihm dies von ahnungslos Begeisterten offenbar tatsächlich geglaubt wird.
Der Mensch
Wie schon in den früheren Sammlungen Schirachs begegnen wir auch in „Strafe“ dem Menschen, wie er nach dem Bilde des Vorabendprogramms wirklich ist: Vollkommen gewöhnlich in seiner Ungewöhnlichkeit, und gleich nochmal umgekehrt. Ein Thema, das literarisch unerschlossen war! Die Rezensenten sind tief beeindruckt von Figuren und Schicksalen.
Rechtsanwalt Schlesinger zum Beispiel („Die falsche Seite“) ist ein Mensch wie Du und ich, eine Rolle, deren Verkörperung durch Heiner Lauterbach geradezu ruft: Geschiedener Alkoholiker, körperlich und psychisch depraviert, verschuldet bei gnadenlosen Chinesen aus einem finsteren Spielhöllen-Hinterzimmer, die ihm erst die Zehen und dann den Fuß abschneiden lassen wollen. Die Bestellung zum Pflichtverteidiger einer wegen Gattenmords angeklagten Dame aus besseren Kreisen und das Auftauchen eines knallharten Killers und Geldeintreibers treffen glücklich zusammen. Die Dame ist übrigens 43 Jahre alt und trägt ein grünes Kleid. Der Profi-Zehenabschneider kommt vermutlich gerade vom Casting für einen Clint-Eastwood-Film der mittleren Ära. Er schlägt Herrn Schlesinger daher sehr cool und durchaus freundlich mit einer Baseballkeule zusammen: Somebody has to do it. Während der verlotterte Pflichtverteidiger bewusstlos ist, nimmt sich sein neuer Freund die auf dem Schreibtisch liegende Akte vor und löst, da er nicht lesen kann, den Mordfall durch Betrachten eines Fotos.
Schlesinger wacht auf, wäscht sich und schreitet gestärkt zum Schwurgericht. Dort befragt er unerbittlich einen Waffensachverständigen so lange, bis der zugibt, dass halbautomatische Pistolen an der Seite eine Öffnung zum Auswurf von Patronenhülsen haben. Jetzt erfahren wird noch, wie man sich von hinten erschießt, und schwupps!, schon ist der Suizid bewiesen und die unschuldige Witwe nicht nur frei, sondern auch um 800.000 Euro Lebensversicherung reicher – jedenfalls wenn Herr Schirach die Sache nicht an die Versicherungsgesellschaft verrät, die dann vermutlich den zwei Wochen vor Suizidierung geschlossenen Lebensversicherungsvertrag bemäkelt. Der Leser bleibt etwas ratlos mit der Frage zurück, warum der lebensmüde, aber liebende Suizident eigentlich vorgetäuscht hat, von seiner Witwe in spe ermordet worden zu sein? O.k., für kleinliche Versicherungsfragen ist Schirach nicht zuständig; er berichtet ja nur, wohin es führen kann. Vielleicht will er auch nur den Fall Andreas Baader aufklären, ist aber wegen des Anwaltsgeheimnisses gehindert zu erklären, dass er dabei war.
Noch einer gefällig? Brinkmann ist Witwer und einsam. Frau Antonia, 30 Jahre jünger, liegt im Nachbargarten nackt am Pool und ist auch sonst recht nett. Der Ehemann von Antonia schraubt unter dem alten Jaguar, wie man es halt so macht am Samstagnachmittag, selbstverständlich an der Elbchaussee. Brinkmann tritt den Wagenheber weg; Ehemann tot. Brinkmann glücklich mit Antonia. Nur „seinem Anwalt“ erzählt er, wie es war. Aber der sagt es nicht weiter: Nur uns, im Vertrauen. Wahnsinn, wohin die Liebe führen kann!
Das Dichten
So geht es dahin. Zwölf Fälle auf 189 sehr großgedruckten Seiten mit viel Luft; da bleibt nicht viel Zeit pro Einsamkeitsschicksal. „Auf knappstem Raum“, so urteilt Michael Hanecke (ebenfalls auf dem Schutzumschlag), entwerfe Schirach „den großen emotionalen Raum“, so dass der begeisterte Kritiker „immer wieder zu Tränen bewegt“ sei. Das geht mir anders, und Haneckes Tränen scheinen mir fast das Wundersamste an der Sache.
Nichts gegen „lakonischen Stil“, aber ein bisschen weniger bemühter Holzschnitt dürfte es schon sein. Die extrem schlichten, gekünstelten Dialoge Schirachs tun oft wirklich weh. Und schmerzhaft ist auch der ewig gleiche Trick, mit dem er den Sound herstellt, von dem die Laudatoren schwärmen: Er besteht aus Präsens, Plusquamperfekt und einem Irrealis des Futurs. Wenn man das ein halbes Stündchen geübt hat, geht es locker von der Hand, ist allerdings auch ziemlich langweilig im ewigen Geplätscher von Subjekt – Prädikat – Objekt. Für den Dichter hat der Stil durchaus Vorteile: Er ist produktiv, und man kann notfalls nebenbei fernsehen.
So geht das: „Schirach stellt die Tasse auf den Tisch. Ein Sonnenstrahl bricht sich in der staubigen Scheibe. Der Staub wirbelt im Lichtkegel. Schirach kaut, Brotkrümel fallen auf das Wachstuch. Schirach wischt sie auf den Boden. Er hatte wieder in seinem Auto gesessen und die Staatsanwältin beobachtet, aber sie hatte ihn nicht angesehen. Sein Messer gleitet leicht durch den Käse. Sein Kopf dröhnt. Er würde wieder hingehen. Sie würde wieder an ihm vorbeisehen. Er würde den Mantel tragen, den er bei einem englischen Herrenschneider gekauft hat. Der Verkäufer trägt eine grüne Krawatte. Schirachs Vater hatte eine grüne Krawatte getragen an dem Tag, als seine Schwester starb. Ihr Haar war so blond wie das der Staatsanwältin. Er würde das Messer aus der Manteltasche ziehen. Es hat einen hellen Holzgriff. Seine Tante hatte es ihm geschenkt, als er sechzehn war. Schirach hatte ihre weißen Schenkel gesehen, als sie schlief. Er schüttet den Rest des Kaffees in den Ausguss. Später, beim Richter, wird er sagen: Es war ein Morgen wie jeder andere auch.“
Diese kleine Geschichte darüber, wohin ein Käsemesser führen kann, war nicht von Schirach, sondern ein Auszug aus der Sammlung von Kriminalgeschichten, die ich demnächst unter dem Titel „Buße“ veröffentlichen werde.
 Das Recht
Das Recht
Jetzt noch mal was ganz anderes. Das Buch heißt „Strafe“, und bisher wissen wir noch nicht so recht, warum: Es könnte auch „Wetter“ heißen oder „Autoreifen“. Denn alles hat ja mit allem zu tun, und dass das Leben eine Strafe für das Leben sein kann, weiß der durchschnittliche „Rosenheim-Cops“-Gucker und Thomas-Mann-Leser ja schon länger. Wir kommen also zu dem, was Zielcke in seiner Eloge „Kurzvorlesungen“ nennt.
Zwecks Kurzvorlesung hauen wir nochmal eine schöne Geschichte („Das Seehaus“) heraus, die wir mit „großer Diskretion“ (Zielcke) aus einer Entscheidung des BGH vom 10.8.2005 abgeschrieben haben (Aktenzeichen 1 StR 140/05, veröffentlicht u.a. in der amtlichen Sammlung BGHSt Band 50, 206):
Ascher, der demnächst ein Mörder sein wird, entfaltet auf einigen Seiten zunächst eine wirre Lebensgeschichte, in der rote Punkte auf dem Bauch, ein Großvater der „Heidi“-Kategorie, tragische elterliche Todesfälle und ähnliches vorkommen, was aber alles keinerlei Bedeutung hat. Der Opa stirbt auch; Ascher renoviert sein Haus und widmet sich fortan dem Schweigen; dann wird er von neu zugezogenen Nachbarn genervt. Er schnappt sich eines der zahlreichen Gewehre des Verblichenen, zieht sich „rosa Spülhandschuhe“ an, denn „er hat lange genug in der Schadenabteilung einer Versicherung gearbeitet, er kennt die Fehler, die alle Verbrecher machen“. Sodann massakriert er eine Nachbarin, weil sie ihn beim Ausblick und beim Nachdenken stört.
Jetzt wird es spannend. Ascher ist verdächtig, aber wegen seiner teuflischen Schlauheit mit den rosa Spülhandschuhen kann man ihm nichts beweisen. Sein Weg führt ihn auf die Kellertreppe, die er prompt hinunterstürzt. Ab ins Krankenhaus. Dort führt er Selbstgespräche, in denen er die Tat gesteht. Zum Glück hat die Polizei alles abgehört. Der Ermittlungsrichter hebt aber den Haftbefehl trotzdem auf, weil das Selbstgespräch wegen Menschenrechtsverletzung nicht verwertet werden darf. Der Staatsanwalt ist sauer, legt aber noch nicht einmal Beschwerde ein. Ascher geht nachhause. Später stirbt er, wie wir alle.
 Ein sehr schöner Fall. Welche anwaltliche Schweigepflicht Schirach beflügelt haben könnte, erschließt sich nicht. Der Sachverhalt des diskret nachempfundenen Falles BGHSt 50, 206 liest sich eigentlich auch schön, hat allerdings nicht so viele sinnfrei bedeutungsvolle Schnörkel. Das Rechtsproblem kennt jeder Rechtsreferendar, aber nicht die Jubel-Rezensenten aus den Feuilletons.
Ein sehr schöner Fall. Welche anwaltliche Schweigepflicht Schirach beflügelt haben könnte, erschließt sich nicht. Der Sachverhalt des diskret nachempfundenen Falles BGHSt 50, 206 liest sich eigentlich auch schön, hat allerdings nicht so viele sinnfrei bedeutungsvolle Schnörkel. Das Rechtsproblem kennt jeder Rechtsreferendar, aber nicht die Jubel-Rezensenten aus den Feuilletons.
Der ebenfalls tolle Fall „Mord ohne Leiche“ des 2. Strafsenats vom 22.12.2011 (Az. 2 StR 509/10 = BGHSt 57, 71), bei dem es um ein Selbstgespräch im Auto ging, kommt dann sicher im nächsten Schirach-Buch; ich bin schon gespannt, wohin er uns führt. Dem Rezensenten Andreas Zielcke ist zu empfehlen, die Sachverhalte der BGH-Entscheidungen einmal nachzulesen. Es könnte sein, dass er dann mit anderen Augen auf seine Beurteilung blickt: „Schirachs Darstellungsstrategie besteht darin, das Drama so gut wie möglich zu entdramatisieren.“ Damit wurde, so meine ich, die Strategie einer um bloßer Effekte willen dramatisierten Nachdichtung recht eklatant verkannt.
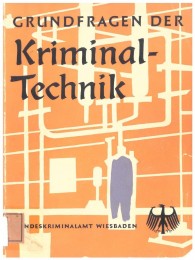 Das Schicksal
Das Schicksal
Und ein letzter Super-Fall („Subotnik“): Erstes (!) Mandat von Seyma, einer türkisch-stämmigen Rechtsanwalts-Anfängerin in der Kanzlei eines väterlich-gütigen Seniors, den wir uns als eine Art Gandalf vorstellen dürfen, also wie einen berühmten, empathischen Berliner Strafverteidiger, dessen Name von Herren Schirach in großer Diskretion nicht genannt wird.
Tatvorwurf: Menschenhandel usw. – das volle Programm. Das mutmaßliche Opfer wurde durch Gruppenvergewaltigung von gleich fünf stinkenden Bauarbeitern auf Befehl des russischen Bosses sowie durch das Ausstechen eines Auges (!) ins Elend der Zwangsprostitution gezwungen. Das wird von Schirach schön beschrieben, damit es sich die Leser auch vorstellen können. Seyma muss vor Erschütterung über die Taten ihres Mandanten (der russische Boss) Drogen nehmen und unter ultraviolettem Licht in Trance tanzen (Achtung „Tatort“-Redaktionen: Wäre das nichts für Frau Furtwängler?).
Seyma will natürlich das Mandat niederlegen; darf nicht, wg. Strafverteidiger-Ehre. Der Angeklagte wird dank Aussage der Opferzeugin verurteilt. Seyma muss Revision begründen und findet natürlich gleich einen hanebüchenen Verfahrensfehler, was zur Aufhebung des Urteils durch den BGH führt. Zweiter Durchgang am Landgericht: Die Zeugin ist verschwunden, da sie inzwischen wegen ihrer ersten Aussage „getötet und auf den Müll geworfen“ wurde. Daher wird das russische Untier nun freigesprochen. Schluss: Seyma im Park mit Gandalf. Kinder lachen, der Himmel ist blau, die Vögel zwitschern.
Ein klarer Fall von Drehbuch-Bewerbung. Dreißig Seiten „Subotnik“, um dem Leser zu erklären, dass Strafverteidiger manchmal Menschen verteidigen, die erstens schuldig und zweitens Arschlöcher sind. Man hätte natürlich auch einen Steuerhinterzieher vom Prenzlauer Berg nehmen können oder einen Unfallflüchtigen aus Potsdam. Aber unter einem Mord aus der finstersten Wallander-Abteilung macht es Schirach nun mal nicht, und die Leser können die kleinen und großen Sorgen des Lebens und des diskreten Anwalts gewiss nur verstehen, wenn der Verdächtige ein Kannibale ist, dessen Mutter eine sexuelle Beziehung mit einem japanischen Geiger hatte, während der impotente Vater der Nachbarin, angetan nur mit Gummistiefeln und Nachtsichtbrille, durch den Winterwald schlich…
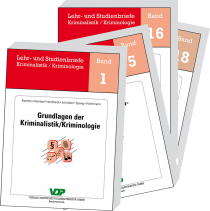 Der Neid
Der Neid
Schirach, so verrät uns der Umschlag, ist „millionenfach verkauft“. Das ist sehr beachtlich und (für ihn) erfreulich, aber es erzeugt natürlich auch Neid: Von Rechtsanwälten und anderen Rechtskundigen, denen er als Strafverteidiger nicht weiter aufgefallen ist und die seine (angeblichen) Fälle allenfalls aus Bruchstücken veröffentlichter Urteile kennen; von Schriftstellern, die meinen, den ziemlich nervigen Sound vorgeblicher Ermattung an der Welt besser hinzukriegen. Das kann Schirach egal sein und ist es wohl auch; sonst würde er diesen den müden Bullen nicht weiterreiten. Er will nach Hollywood, und er kommt nach Hollywood, und wenn es auf den Knien eines SWR-Tatorts und den Beschlussentwürfen aus dem Papierkorb des Bundesverfassungsgerichts ist.
Es ist aber weder schlimm noch traurig, dass Schirach diese Bücher schreibt und dass sie viel gelesen werden. Es muss nicht nur große Literatur produziert werden. Wer aus alten Operationsberichten, ein paar blonden Oberschwestern und einem Maserati Quattroporte erfolgreiche Arztromane zusammenzimmert, macht seinen Job wie jeder Handwerker und kann sich freuen. Man muss ihm nicht mit ständig gerümpftem Näschen nachschauen. Andere Anwälte machen Gold aus schlimmeren Sachen.
Traurig ist vielmehr, finde ich, dass die professionelle Kritik ernsthaft annimmt und behauptet, hier werde etwas substanziell Neues und „Wahres“ gesagt. Die Elogen, die über den unvergleichlich „präzisen“, „lakonischen“, „empathischen“ Stil Schirachs verbreitet werden, sind Hymnen auf des Kaisers neue Kleider: Da ist nichts. Schirach ist weit weg von der Kunst, die ihm angedichtet wird. Er kann das (wohl) nicht, will es (wohl) nicht und muss es (sicher) auch nicht. Er schreibt triviale Gebrauchsliteratur: bierernste, bemüht konstruierte Geschichtchen, die von fantasielosen Menschen als Enthüllung verborgener Wahrheiten aufgeblasen werden (sollen).
Daher bleiben die vorgeblichen Wahrheiten auch genau da, wo sie hinkonstruiert werden: Weit weg, bei den Mördern, Verrückten und Schattengestalten, die Schirach vorführt mit der Behauptung, sie sagten den „normalen“ Menschen etwas über sich selbst. Das ist ein Irrtum, und es ist erstaunlich, dass die professionellen Kritiker es den Käufern/Lesern einzureden versuchen. Schirach-Leser lernen weder etwas über Gerechtigkeit noch über Justiz noch über Strafe, erst recht nichts Neues über sich selbst. Sie erfahren, dass Mörder auch nur Menschen sind. Das freut sie, denn sie haben es sich schon gedacht. Deshalb gucken sie ja jeden Sonntag den „Tatort“ und kaufen gewiss auch das nächste Buch mit lustigen Mördergeschichten.
Thomas Fischer
Dieser Text erschienen zuerst in: „Strafverteidiger“, Heft 06/2018, S. 393-396, dann auf mediaa. Wir finden ihn auch für CrimeMag von Interesse – und begrüßen bei dieser Gelegenheit herzlichen einen meinungsfreudigen Autor.
Ferdinand von Schirach: Strafe. Stories. Luchterhand Literaturverlag, München 2018. 192 Seiten, 18 Euro.
Über den Autor: Thomas Fischer war Vorsitzender Richter des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe und ist viel gelesener Publizist (u.a. “Fischer im Recht”).
Persönliche Webpräsenz.
Seine Kolumnen bei der „Zeit“.
Seine Texte bei Meedia, darunter auch die letzten Kontroversen.
Von Schirach bei CrimeMag:
Thomas Wörtche, September 2011: Grisham im Westentaschenformat
Alf Mayer, Dezember 2013: Sensation! Goyas nackte Maya im Spermabad!
















