
Bloody Chops ‒ kurz, grausam und gerecht – heute führen das Beil Alf Mayer, AM, („Tabu“ von Ferdinand von Schirach), Stefan Linster, SL (Michèle Minelli: „Wassergrab“) und Joachim Feldmann, JF (Ragnar Jónasson: „Todesnacht“).
 Sensation! Goyas nackte Maya im Spermabad!
Sensation! Goyas nackte Maya im Spermabad!
(AM) Hut ab vor Matthias Brandt, der es geschafft hat, diesen Roman, ohne ins Lachen auszubrechen, als Hörbuch einzusprechen. Keine andere Lektüre des Jahres 2013 ließ mich öfter an Karl Krausens Diktum denken: „Manches erledigt sich durch lautes Lesen.“ Oft, zu oft, riecht es in „Tabu“ nach Dichterschweiß und krachlederner Bedeutungsseligkeit. Goyas nackte „Maya“ im Spermabad, ein aufgeschnittenes Reh, mit Kreuzen übersäte Wände, eine krude Videoinstallation (im Gericht vorgeführt und „zeitgleich ins Internet gestellt“, kicher) als ästhetische Schocks, da war der ZDF-Intendant aber entzückt-entsetzt über diese Zuführung zur Sonntagabendschiene. Etwas Altbackenes, fand ich, hatte von Schirach immer schon. Sozusagen Wondratschek für Akademiker. Großdichtertum, das Sätze produziert wie: „Jeden Morgen stehen wir auf, wir leben unser Leben, all die Kleinigkeiten, das Arbeiten, die Hoffnung, der Sex.“ Oder: „Die Wahrheit ist hässlich, sie riecht nach Blut und Kot.“ Schon 30 Seiten zuvor hatte es nach einem Programmkinobesuch (zu schnell geschnittener Film, der Handlung war nicht zu folgen) an einer Baustelle „nach Abwasser und Kot“ gerochen, was einen anders über Arbeit denken lässt. Ja, und die gute alte Schuldfrage, immer wieder: „Schuld, dachte er, Schuld – das ist der Mensch.“
Sätze aus einer Zeit, als der Tag noch mit einer Schusswunde begann, auch Hans Henny Jahnns „Nacht aus Blei“ lässt sehr vage grüßen. In „Tabu“ tritt uns solch Sinnieren in Gestalt des Strafverteidigers Konrad Biegler vollends altmännerhaft an. Der beschwert sich verstiegen über Gepflogenheiten im Flieger, über die moderne Technik („Dieses Internet taugt nichts.“) und allerlei sonst. Hoffentlich ist er kein Alter Ego des Autors. Die andere Hauptfigur ist Künstler, Schirach hat zu viel Respekt davor, auch wenn nur um die Abteilung Kunstgewerbe geht, mit der er uns in Gestalt seines Protagonisten Sebastian von Eschenburg anraunt. Dessen halbschlimme Kindheit führt in eine Fotografenlaufbahn, die alsbald künstlerisch verschwimmt und im Irgendwo zwischen Arbeit für einen „französischen Energiekonzern“ und Galerien mit Besucherschlangen davor oszilliert. Frauen erliegen ihm, wollen nackt fotografiert werden. Ach, wie kommt man als schreibender Rechtsanwalt doch an die geilen Details der unvorstellbaren Wirklichkeit. Aber doch: „Die Ereignisse in diesem Buch beruhen auf wahren Begebenheiten“, heißt es extra in „Tabu“.
Mag ja sein – und ist so. Mindestens bei der geschmacklosen Hinzuziehung eines Falls von „Rettungsfolter“, bei der „ein erfahrener“ Kriminalpolizist dem des Mordes (ohne Leiche) verdächtigen Künstler mit unsagbaren Schmerzen droht, wie es sich bei der Suche nach dem entführten Jakob von Metzler tatsächlich ereignet hat. Doch zu welchem Behufe wagt von Schirach diese Spiegelung? Geht es um ein „Tabu“? Nein, nur um einen schnell verbrauchten Effekt, der leider tief in die Erzählmechaniken von Schirachs blicken lässt. Da tut sich ein Abgrund auf.
Ein anderes Tabu ist mir die ganzen 254 Seiten lang nicht begegnet. Immerhin erklärt von Schirach auf groteske Weise (Träumen Strafverteidiger von Schachautomaten des 18. Jahrhunderts?) die Herkunft des Begriffs „getürkt“, liefert selbst ein Anschauungsbeispiel. Wie ganz anders schreibt ein Frank Göhre doch über Wirklichkeit. Bei allem Spaß, den man bei ihm hat.
Ferdinand von Schirach: Tabu. Roman. München: Piper 2013. 256 Seiten. 17,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Mehr zum Autor.

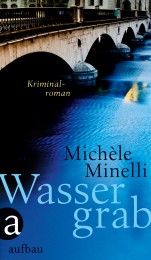 Unterirdisch
Unterirdisch
(SL) Warum nur werfen sich unsere Autor(in)en in letzter Zeit derart ins Geschirr, möglichst schräge, ja wunderliche Kreaturen auszutüfteln, dass darüber ihre Plots kranken, bestenfalls in den Hintergrund rücken? Zumindest war dies bei einigen der kürzlich besprochenen Titel [siehe hier] festzustellen, und auch diesmal, im Roman „Wassergrab“ der Schweizerin Minelli. Allein mit den Namen fängt es schon an. So treffen wir darin auf einen gewissen Leandro Scheu (heißt nicht nur so), seines Zeichens Kriminalkommissar, dessen über die Maßen toughe Mitstreiterin Imogen Kant (heißt auch nicht nur so) und viele lustige mehr (der Schweizer Patronymschatz bietet da beinahe unerschöpfliche Ressourcen). Nun macht besagter Scheu durch Neurosen (etwa einer narzisstischen) beeinträchtigt, vergrübelt und selbstzweiflerisch bis zur Selbstzerfleischung, seinem Nomen nicht nur alle Ehre, sondern ist dazu auch noch ein Jenischer, der obendrein als Kleinkind seinen Eltern entrissen und durch das unrühmliche Fürsorge des „Hilfswerks der Kinder der Landstraße“ der Zwangsadoption zugeführt worden war. Da darf man sich zu Recht fragen, wieso nicht auch ein Holzbein oder ein Glasauge?
Meist paart sich derlei eifriges Bemühen um irgend originelle Gesetzeshüter, alternativ Gesetzesbrecher, noch mit einem Hang zu besonderer Bildhaftigkeit, Sprachkunst und Wortschöpfung, wie ebenso im „Wassergrab“ der Fall – da „zapfen“ Wassertropfen an Haares Spitzen, nimmt „Grabesstille […] Platz wie ein Wächter“, ist ein Kopf „wie ein umgestülptes Ei“ oder „grinslächelt“ man schon mal. Es wundert nicht weiter, wenn bei der Erzählung an sich nicht mehr genug Puste bleibt und dafür nur viel herumgefahren, herumgegrübelt, in Kloaken herumgestapft, endlos viel besprochen und sich noch mehr verrannt wird …
Ach ja, die Story: Mitten im properen Zürcher Abwassersystem wird horribile dictu die völlig unkenntliche Kanalleiche einer erschlagenen Frau aufgefunden, während zur gleichen Zeit eine mysteriöse Lettin, gleichfalls bei Adoptiveltern aufgewachsen, unseren gebeutelten leitenden Kommissar Scheu mit allen erdenklichen Mittel dazu bringt, nach dem Verbleib ihrer dermalen als Sechzehnjährige (sic) verschwundenen Mutter zu fahnden. Natürlich hängt dann alles irgendwie zusammen und stellt sich der Leser schließlich, aller Zweifel in puncto Plausibilität und des Ärgers über den ständig falschen Gebrauch von Zeitadverbien ungeachtet, die Frage, welchen Roman die Autorin eigentlich hatte schreiben wollen? Den über die nie endende Identitätssuche von Entwurzelten jedweder Art und im Besonderen von Heimatlosen, von Adoptierten, ihre ewige Zerrissenheit? Oder einen über die diversen Ober-, Unter- und Nebenwelten Zürichs, die Verkommenheiten der einen, die beklemmenden Geheimnisse und Gefahren der anderen? Wie auch immer, gelungen wären beide nicht, ob nun aus Mangel an Tiefe oder einem Zuviel an Behäbigkeit.
Michèle Minelli: Wassergrab. Roman. Berlin: Aufbau 2013. 285 Seiten. 16,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Mehr zur Autorin. Zur Homepage von Stefan Linster.

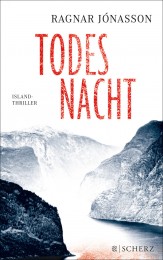 Tod eines Scheusals
Tod eines Scheusals
(JF) Es ist ein schöner Junimorgen im nördlichen Island, als ein Tourist aus Schottland die Leiche findet, deren Zustand keinen Zweifel daran lässt, dass hier ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Tatmotive gibt es reichlich, denn der Tote war kein sonderlich beliebter Zeitgenosse. Dennoch verlaufen die polizeilichen Ermittlungen schleppend. Sie stehen allerdings auch nicht im Mittelpunkt von Ragnar Jónassons Thriller „Todesnacht“. Schließlich lässt sich noch von vielen anderen Dingen, die die Menschen auf der krisengeschüttelten Vulkaninsel nahe des Polarkreises bewegen, erzählen. Da wäre der Polizist, dem anonyme Mails schlaflose Nächte bereiten. Ein schlechtes Gewissen plagt ihn sowieso, schließlich hat er vor vielen Jahren große Schuld auf sich geladen. Seine Kollegen haben ebenfalls ihre Sorgen. Der eine bekommt kein gescheites Essen mehr, seit seine Frau zum Studium in die Hauptstadt gezogen ist, der andere leidet unter einer gescheiterten Liebesbeziehung. Dann ist da noch die Fernsehjournalistin, die nicht nur in die Provinz gereist ist, um über den Kriminalfall zu berichten. Oder der alkoholkranke ehemalige Arzt, dessen Karriere nach einem Behandlungsfehlern mit tödlichen Folgen ein jähes Ende genommen hat. Und, und, und.
Es ist schon ein kleines Kunststück, wie es Jónasson gelingt, all diese Schicksale und die mit ihnen verbundenen Handlungsfäden zusammenzuhalten. Dass er sich dabei einer nüchtern-sachlichen Sprache bedient, gefällt ebenfalls. Weniger überzeugend hingegen ist die narrative Strategie. Erzählt wird durchgängig aus der Perspektive der einzelnen Figuren, allerdings in einem deutlich auktorialen Duktus. Deshalb wirkt es ziemlich konstruiert, wenn uns beispielsweise das eigentliche Motiv der Journalistin bis zum letzten Drittel des Romans vorenthalten wird. Die Rätselqueen Agatha Christie, deren Bücher Jónasson ins Isländische übersetzt hat, ging da geschickter vor. Aber wahrscheinlich ging es dem Autor nur am Rande um die Frage, wer letztendlich für den Tod eines offensichtlichen Scheusals verantwortlich ist. Denn frei von Schuld, daran lässt dieser Roman keinen Zweifel, sind die wenigsten.
Ragnar Jónasson: Todesnacht (Myrknaetti. 2011). Aus dem Isländischen von Tina Flecken. 329 Seiten. Frankfurt am Main: Scherz Verlag 2013. 14,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Mehr zum Autor.











