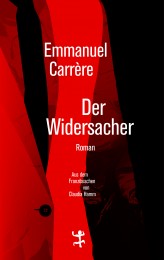 Ein Nudelholz und die Banalität des Bösen
Ein Nudelholz und die Banalität des Bösen
von Christiane Nitsche
Die ersten drei Sätze setzen den Ton. Sie entscheiden darüber, ob ich lese oder nicht. Der vierte Satz in „Der Widersacher“ lautet: „Nie wird er den Anblick der grauen, versiegelten Plastiksäcke vergessen, in die man die Kinder gesteckt hatte.“ Der Impuls, der instinktiv sagt: Schluss. Stopp. Tote Kinder. Ich will das nicht; der Impuls, er kommt zu spät.
Ich bin da bereits gefangen in einer der monströsesten Kriminalgeschichten des ausgehenden 20. Jahrhunderts – einer wahren Geschichte, wohlgemerkt. Ihr Protagonist: Jean-Claude Romand, Vater von Antoine und Caroline, den beiden Kindern, deren Schicksal lange vor Erscheinen dieses Buches besiegelt war. Jean-Claude Romand war ein angesehener Arzt, er hat seine Kinder geliebt. Er hat auch Florence geliebt, seine Frau. Er hat sie ermordet. Zuerst Florence, dann die Kinder – nicht im Affekt, nicht aus Versehen. Er war vorbereitet, hatte eingekauft: Schalldämpfer, Benzinkanister. In der Nacht vom 9. auf den 10. Januar 1993 erschlug er seine Frau im Schlaf mit einem Nudelholz, die Kinder erschoss er in der folgenden Nacht, nachdem er mit ihnen ferngesehen und sie anschließend ins Bett gebracht hatte. Dazwischen fuhr er zu seinen Eltern, die er ebenfalls erschoss, ging spazieren, kaufte eine Zeitung, ging zurück nach Hause und legte dort Feuer. Was zunächst aussieht wie ein erweiterter Selbstmord, entpuppt sich später als eine fast noch wahnsinnigere Tat. Offenbar hat Romand es darauf angelegt, zu überleben. Sterben sollten nur die, die sein Leben teilten. Er hat sie ermordet, weil dieses Leben von einer Lüge genährt wurde, der die Luft auszugehen drohte.
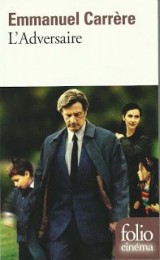 Wie wahr ist die Wahrheit? Und was ist das Böse?
Wie wahr ist die Wahrheit? Und was ist das Böse?
Die Geschichte ist so unglaublich, dass ihr Autor weiß: „Hätte ich meinem Verleger den Widersacher als fiktionales Buch vorgelegt, hätte er mir gesagt: Naja, das ist eine interessante Grundidee, aber versuch mal, das ein bisschen glaubwürdiger zu gestalten, denn so hat es weder Hand noch Fuß.“
Es geht viel darum, was wahr ist, in dieser Geschichte, um das, was Wahrheit sein kann und darf und warum ihr Verlust am Ende in die totale Katastrophe führt. Es geht aber auch um das Verhältnis von Autor und Protagonist. Carrère nahm mit Romand im Gefängnis Kontakt auf, führte mit ihm Korrespondenz, verfolgte den Prozess, sprach mit Freunden der Familie und besuchte ihn schließlich sogar. Dass er das tat und warum, sind Fragen, die er sich selbst und uns als Leser stellt. Warum fasziniert uns das Böse so sehr – besonders, wenn es so bourgeois und banal daherkommt wie in der Gestalt eines mittelalten, mittelsympathischen, mittelansehnlichen Mannes wie Romand? Carrère hat über der Arbeit an diesem Buch seine eigene Antwort darauf gefunden: „Die Kluft von dem idealen und dem eher erbärmlichen Ich, das wir alle sind – Romand hat die Kluft mit der Lüge überbrückt und die Lüge zur Krankheit gemacht. Ich hatte das Glück, Bücher daraus machen zu können.“
Carrère hat mit „Der Widersacher“, 1999 in Frankreich und nun von Claudia Hamm übersetzt bei Matthes & Seitz erschienen, ein Genre entwickelt, den Tatsachen-Roman mit dem Autor als Ich-Erzähler. Noch bevor es überhaupt losgeht, stellt Carrère klar, was der eine mit dem anderen zu tun hat: „Während Jean-Claude Romand seine Frau und seine Kinder tötete, saß ich mit meinen in einer Versammlung der Schule unseres ältesten Sohnes. Gabriel war fünf Jahre alt, genauso alt wie Antoine Romand. Danach gingen wir zu meinen Eltern Mittagessen und Romand ging zu seinen und brachte sie nach dem Essen um.“ Offen bleibt, warum er auch den Hund der Eltern erschoss, den er ebenfalls sehr liebte.
„Der Widersacher“ ist ein Buch der Fragen. Fragen wie die, warum Romand überhaupt gelogen hat, als er seinerzeit im Studium eine Semesterprüfung versäumte. Warum er nicht versuchte, sie zu wiederholen, wo er doch eigentlich ein exzellenter Schüler und Student war. Warum er auf dieser einen Lüge nach und nach ein Gebäude errichtete, das der Chronologie des echten Lebens folgte. Wie er es schaffte, sich weiter einzuschreiben und woher das Geld kam, mit dem er dann den Lebensstil eines gut dotierten wissenschaftlichen Mitarbeiters der WHO finanzieren konnte. Zur Wahrheit, der Carrère schmerzhaft langsam nachspürt in „Der Widersacher“, gehören Carrères eigene Faszination, die mitunter aufkeimende Scham darüber und die Frage aller Fragen – ob es einen tieferen Sinn in einer solchen „Tragödie“ geben kann, wie Romand selbst seine Morde störrisch betitelt.
Hannah Arendts Word von der „Banalität des Bösen“ stellt sich immer wieder ein, verfolgt man gemeinsam mit Carrère so staunend wie kopfschüttelnd, wie Romand sich von Lüge zu Lüge hangelt, selbst als er längst komplett enttarnt und überführt ist. Erst als er einsehen muss, dass ihm niemand mehr glaubt, zeigt er sich reuevoll, erschüttert und religiös geläutert.
Nichts stimmt, da ist kein anderes Ich
Und womöglich gibt es noch einen weiteren Mord, auch wenn Romand bis zuletzt bestreitet, bei dem tödlichen Sturz seines Schwiegervaters nachgeholfen zu haben. Der starb nämlich gerade rechtzeitig, um Romand schon Jahre vor der Eskalation vor der Entdeckung zu bewahren. Auch dies eine Frage, die unbeantwortet bleibt.
18 Jahre lang lebt der Sohn einfacher Leute aus dem Jura ein bis ins Kleinste ausgearbeitetes Scheinleben. Kein Doppelleben, wie es sich der Mann in der Midlife-Crisis gerne gönnt. Das so bourgeoise wie banale Bild, das Romand für sein Schein-Ich zimmert, ist von Beginn an eine reine Erfindung. Nichts stimmt. Ein anderes Ich hat er nie gehabt, und das erklärt vielleicht ein Stück weit die Monstrosität, die sich bei der Lektüre entblättert. Der Betrug geht so weit, dass sogar Romands Affäre den Regeln dieser Lüge folgt. Mit viel Chuzpe und Glück gelingt es Romand, die Fassade wieder und wieder aufrecht zu erhalten. Weder seine Frau noch seine Eltern ahnen, dass er statt zur Arbeit in den Wald fährt, den Tag in Cafes oder im Auto verdöst oder in Bibliotheken das nachliest, was er wissen muss, um als Arzt durchzugehen. „Dienstreisen“ verbringt er im Hotel am Genfer Flughafen. Nie versäumt er es, seinem Patenkind anschließend ein passendes Mitbringsel zu überreichen. Alle vertrauen ihm – auch ihr Geld an. Bis zuletzt.
Dass es überhaupt so lange dauert, bis erste Bekannte unangenehme Fragen stellen und irgendwann auch keine Geldquellen mehr aufzutun sind, ist so unvorstellbar, dass das Ganze wie ein schlechtes Skript daherkommt.
So schlecht das Skript wäre, so gut ist dieses Buch. Oder um es mit Carrères Worten zu sagen: „Die Fiktion ist an Realität gebunden, die Wirklichkeit nicht.“
Mir muss jetzt nur noch jemand erklären, warum Romand seine Frau mit einem Nudelholz erschlug, statt sie wie alle anderen zu erschießen.
Christiane Nitzsche
Emmanuel Carrère: Der Widersacher (L’Adversaire, 2000). Aus dem Französischen von Claudia Hamm. Matthes & Seitz, Berlin 2018. 195 Seiten, gebunden, 22 Euro. Verlagsinformationen.











