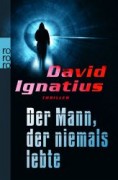 Das Leben, das es so nie gab
Das Leben, das es so nie gab
In dem ganzen Mediengetöse und -gehype um Film & Buch gehen die Perlen oft unter. Das ist nichts Neues, aber auf jeden Fall immer wieder ärgerlich. Im Fall von David Ignatius und einem Film von Ridley Scott möchte Matthias Penzel das so nicht hinnehmen …
In Tageszeitungen, ja selbst in Illustrierten, wie sie in den Arztwartezimmern der letzten Siedlungen unserer Westwelt monatelang herumliegen, überall liest man: Der Apple ist jetzt 25 Jahre alt, wer hätte das gedacht, herzlichen Glückwunsch undsoweiter. Gefeiert wird nicht Bill Gates (der Weltherrschaft wollte und bekam), sondern Steve Jobs, der sich nie für Mainstream interessiert hat. Yep, frühere Bekannte, nicht unbedingt Freunde von Jobs, weisen darauf hin: Ihm lag immer nur daran, so etwas wie Velvet Underground zu sein – Kult unter Kennern. Das liest man in den Tageszeitungen und Illustrierten nicht, obwohl genau das bei dieser seltsamen Geburtstagsfeier die Quintessenz des Staunens ist. Ja ja, okay, es gibt noch andere Gründe, Jobs als Marketing-Genie, die Produkte und ihr Design … und, wie man nur in den Festschriften der Kenner und frühen Mac-Junkies liest: Geschichte machte auch dieser Werbeclip, der den Personal-Computer von Apple Macintosh erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorführte (22. Januar 1984, im Rahmen von Super Bowl XVIII).
Der Clip kam von Ridley Scott. Der in Übersee arbeitende Brite ist inzwischen über 70, also in einem Alter, in dem man die Geburtstage, nicht ohne Erstaunen, eher im kleinen Kreise zelebriert. Er hat Ende 2007 einen Film gedreht, der vor einigen Monaten ins Kino kam … und hierzulande ziemlich spurlos untergegangen ist. Die Kritik reagierte ambivalent, Stars (Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong) sorgten dafür, dass er immer noch über $100 Millionen eingespielt hat, aber keiner ist je aufgestanden und hat laut verkündet: Das war einer der besten Filme des Jahres. Alle berufsmäßigen Kritiker fanden ihn irgendwie gut, aber … wussten nicht so recht.
Ein Sack voll Lügen …
„Body Of Lies“, der Titel quasi ein Crossover aus „body of work“ (=Gesamtwerk oder auch Lebenswerk) und „bag of lies“ (ein Sack voller, ein Haufen Lügen), basiert nicht auf einer Shortstory von F. Scott Fitzgerald, „Body Of Lies“ kam, lief … und wurde bei den Oscar-Nominierungen übersehen. Vielleicht ist es kein Meisterwerk, und trotzdem ist der Film äußerst sehenswert.
Wie bei ein paar Filmen Scotts geht es in den Orient. Der Look ist so, dass man die Hitze spürt, den Dreck und Schweiß fast riecht. Schon in „Aliens“ hat der Regisseur damit Filmgeschichte geschrieben (endlich mal ein Raumschiff und eine Besatzung, die nicht wie geleckt, sondern wie in einem Maschinenraum aussehen), ebenso in „Blade Runner“, dem Crossover aus Film-noir und Sciene Fiction. Will sagen: „a mixed bag“. Wider Reinheitsgebot und passgenauem Genre. Mit Action und ein bisschen Boy-meets-Girl so wie Hollywood, mit einem Set und daraus resultierend einer Prämisse, von der sich ein Filmemacher lieber fernhält, wenn er bei den Massen ankommen will.
Vorlage war ein Roman des Washington Post-Redakteurs David Ignatius; also noch mal einer, der fremdgeht, ein die vermeintliche Wirklichkeit fiktionalisierender hard-news-Journalist. Wie so oft bei meisterhafter Kunst mag man den Film, der hier „Der Mann, der niemals lebte“ heißt, als ein Meisterwerk des Scheiterns betrachten. Des Scheitern der Außenpolitik, zynisch wie realistisch, ein Scheitern der Kritik, die verblüffend selten die Finger auf das Scheitern des Films selbst gelegt hat. Anders als „Syriana“ (Handlungsstränge verworrener als „Babel“, aber auch zwingender ineinander verzahnt) explodiert „Body of Lies“ mit seinen diversen Locations und Figuren nicht wie eine Schmutzige Bombe. Der Film scheint vielmehr ein zeitgemäßer Kompromiss zu sein, inhaltlich anspruchsvoll, aber auch mit genügend Action und Ballereien für die Kids an den Rändern. Der Haken ist … aber das muss nun nicht jeder lesen oder so finden, der Haken ist, dass der Mann – DiCaprio, unser Mann in Jordanien und Irak – sehr wohl lebte, dass er sogar, und das ist eben zu sehr Hollywood, zu weit weg von einer glaubwürdigen Wahrheit, sagen wir ruhig, Wahrhaftigkeit, dass er … liebte.
Immerhin kommt man dadurch, nach sicher zwei Drittel Weltklasse plus ein paar ambivalenten Wendungen, zu einem Ende, das wiederum hängen bleibt. Mit dem Anfang, sagte schon Spillane, verkaufst du deine Story, aber mit dem Ende deine nächste – und die letzte Szene ist so, dass man von Ridley Scott einfach noch viel, viel mehr sehen will. Ruhig auch noch einmal „Black Hawk Down“ (ein Film, der sich streng an Augenzeugenberichte hält, deshalb gelungener sein mag, künstlerisch aber auch weniger riskant war).
Wie auch immer, auch ohne Fitzgerald von seinem Sockel zu stoßen, Ridley Scott ist mit „Der Mann, der niemals lebte“ voll drinnen in dem, was man eines Tages als wichtigste kulturelle Strömung dieser Dekade sehen wird: dem, was u.a. der Cultural-Studies-Theoretiker Homi K. Bhabha als Hybrid bezeichnet, denn spätestens seit dem 11.9. wissen wir: Nichts war je schwarz oder weiß, Ost oder West. Nachrichtensender und Politik mögen es zwar gern so sehen und vereinfachen, doch die Kunst kann schon mal beginnen, ein paar Schritte weiterzugehen – und was einem heute so marginal erscheint wie Velvet Underground wird womöglich doch noch am Mainstream vorbeiziehen.
Matthias Penzel
Der Mann, der niemals lebte (Body of lies, 2007). R.: Ridley Scott, Buch: William Monahan, D: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, Ali Suliman u.a., nach dem Roman von David Ignatius. USA. 128 min.
David Ignatius: Der Mann, der niemals lebte (Body of lies, 2007). Roman. Deutsch von Tanja Handels und Thomas A. Merk. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Tb. 2008. 480 Seiten. 8,95 Euro.











