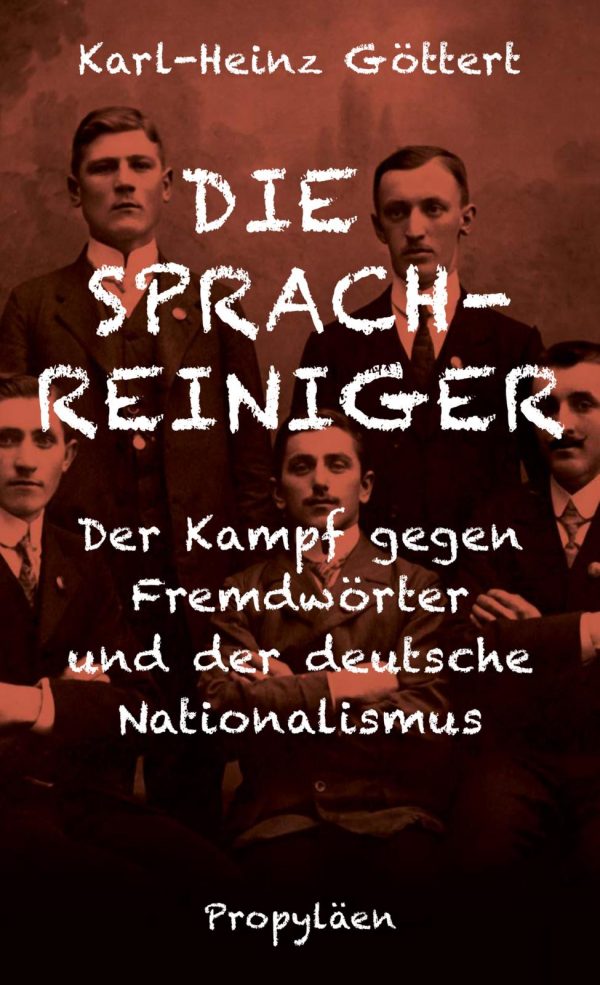
Hart an der Realsatire
Karl-Heinz Göttert hat ein kluges Buch über einen bizarr-komischen Kreuzzug gegen das Böse in der Sprache geschrieben. Thomas Wörtche hatte und hat schon immer mit solchen seltsamen Vögeln zu tun.
Eine kleine Anekdote: Als meine Eltern in den frühen 1960ern von der Stadt auf’s Land zogen (naja, eher in die Suburb) musste ich in der 3. Klasse Grundschule („Volksschule“ hieß das damals) auf dem Dorf erfahren, dass ich a) dumm bin und b) die deutsche Sprache verschandele. In der Stadt hatte ich nämlich gelernt, was ein Verb ist und was ein Substantiv, etc. Mit Tunwort und Dingwort konnte ich nichts anfangen. Also wurde ich von der Lehrerin (ein BDM-Trampel von echtem Schrot und Korn) in die Ecke gestellt und alle anderen Schüler mussten mich auslachen, wochenlang ging das so. Die fahle Erkenntnis war: Wer mehr weiß wird bestraft. Und wer Fremdwörter benutzt ist ein übler, arroganter und undeutscher Mensch, der sich nur wichtigmachen will. Was ich damals natürlich nicht wusste: Ich war in ein bizarr-komisches Kontinuum geraten, das allerspätestens im 19. Jahrhundert aufkam und heute wieder virulent zu werden scheint. Willkommen in der Welt der „Sprach-Reiniger“.
Der Germanist Karl-Heinz Göttert zeichnet in seiner materialreichen Studie „Die Sprach-Reiniger“ diesen absurden, hart an der Realsatire entlangschrammenden Kosmos nach, der deutlich mit dem aufkommenden Nationalismus im post-napoleonischen Deutschland aufkam, mit der Reichsgründung 1871 einen ersten Höhepunkt fand, in der Kriegsbegeisterung 1914 begeistert hyperventilierte und ab 1933 sich noch einmal so richtig austoben konnte, wobei die Töne nach 1945 keineswegs moderater wurden und heute (aber soweit geht Göttert nicht, er überlässt die Schlüsse dem Lesepublikum) subkutan als „Elitenkritik“ wiederkehren. Seine Hauptquelle ist der 1885 gegründete „Allgemeine Deutsche Sprachverein“ mit seiner Publikation „Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins“, später dann „Muttersprache“. Dort sollte die gute, deutsche Sprache von allen fremdem Einflüssen befreit werden, wobei das „Fremde“ zunächst in allem „Welschen“ verortet wurde, wozu sich recht bald alles Jüdische hinzugesellte, bevor man dann auch die diversen Anglizismen aufs Korn nahm. Ein Unternehmen, das Göttert zurecht als von „ideologischem Stumpfsinn“ und „sektiererischen Gesinnungsfanatismus“ geleitet beschreibt und dessen manchmal kreuzkomischen Kreationen (für „Sauce“ „Beiguss“ etc.) sich im Sprachgebrauch nur per ordre de mufti, also der Obrigkeit, lediglich ein paar Jahre halten konnten. Aber es ging natürlich nie nur um die deutsche Sprache, wie der Tübinger Linguist Gerd Simon (Zitat nach Göttert) richtig bemerkte: „Der Sprach-Pflege-Diskurs war immer ein Hucke-Pack-Diskurs, `der dem jeweils herrschenden nationalistischen Diskurs opportunistisch aufsitzt`“. Oder mit den Worten Peter von Polenz´: „Die Sprachreiniger glaubten – ähnlich wie noch heute viele Sprachkritiker -, die Sprache vor dem Sprachgebrauch der Sprachgemeinschaft schützen zu müssen, als ob die Sprache ein absolutes Wesen sei, dem die Sprecher zu dienen hätten.“
Das ließ nach 1945 nicht nach. Die 1947 gegründete Nachfolgeorganisation des „Sprachvereins“, die „Gesellschaft für deutsche Sprache“ übernahm auch „Muttersprache“, mit dem Zusatz „Zeitschrift zur Pflege und Erforschung der deutschen Sprache“ und ließ vor allem an der Kontinuität seit 1933 keinen Zweifel, zumindest was das Personal betraf. Allerdings mischte sich ab 1964 das „Institut für Deutsche Sprache“ ein, um einen sprachpflegerischen Neuansatz zu etablieren, auf eher professioneller Basis. Die „Fremdwortjagd“ übernahmen dann, vor allem wider die ubiquitären Anglizismen, der 1997 gegründete „Verein Deutsche Sprache“ mit seinem Organ „Sprachnachrichten“, worin, so Göttert, „kaum eine Metapher aus dem Reich des Überflutens und Versumpfens fehlt“.
Göttert vermutet allerdings, dass der aktuelle „Rassismus und Fremdenhass heute … kaum noch an Fremdwörter als Brandbeschleuniger anknüpft“ (sondern an Parametern wie „Aussehen“ oder Bekleidungsstücke wie Kippa und Kopftuch“), das ist richtig.
Aber als Element der „Elitenkritik“ („Herrschaftssprache“) und, vermittelt über die notorischen „Reinheitsfantasien“ (mein persönlicher Darling: „der saubere Plot“), ist der Sprachreinigungswahn subkutan ins „Volksempfinden“ abgesunken und bleibt dort, möglicherweise in aller Unschuld, virulent, wie man oft an Amateurrezension sehen kann (eine unerschöpfliche epistemologische Datenbank), in denen „gute Sprache“ gefordert wird, was fast immer „gutes Deutsch“ meint, was auch immer das sein soll, und von der Vorstellung einer Normativität ganz selbstverständlich ausgeht. Solche Phänomene muss man nicht größer machen, als sie de facto sind. Aber als Unterströmung der allgemeinen Diskursverschiebung bleibt die Erbschaft der Sprach-Reiniger schon etwas, das man auch nicht unterschätzen sollte.
Thomas Wörtche
- Karl-Heinz Göttert: Die Sprach-Reiniger. Der Kampf gegen Fremdwörter und der deutsche Nationalismus. Propyläen, Berlin 2019. 368 Seiten, 24 Euro.











