Rückschau auf die gepriesene Vergangenheit
Blick zurück auf den Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Venedig 2019
Man mag sich wundern über die Preisvergabe im Wettbewerb der 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in Venedig, wo in erster Linie Filme prämiert wurden, die nicht in der Gegenwart spielen und deren aktuelle Brisanz somit hinterfragt werden könnte.

Angefangen mit dem Goldenen Löwen des besten Films für Joker, der zwar in Batmans fiktiver Heimatstadt Gotham City angesiedelt ist, allem Anschein nach jedoch im New York der frühen Achtziger spielt. Ein vergleichbarer Film hätte beispielsweise auf der Berlinale niemals gewinnen können (und wäre wohl „außer Konkurrenz“ gelaufen, damit die unabhängige Jury auch ja nicht in Versuchung gerät): zu US-Amerikanisch, politisch nicht ausreichend gegenwartsbezogen. Doch obwohl der Film eben Batmans Erzfeind den Joker zur Hauptfigur nimmt, ist Joker weit entfernt von jenen Superhelden-Filmreihen, die nun schon seit Jahren die Kinoleinwände belagern. Tatsächlich handelt es sich seit Christopher Nolans Batman-Trilogie um den ersten ernstzunehmenden Film, der mit dem Comicgiganten DC assoziiert ist.
Psychologie über Mythos
Es kann kein einfaches Unterfangen gewesen sein, eine Figur neuzudenken, die wie keine andere bereits von derart vielen Schauspielgrößen verkörpert wurde: Von Jack Nicholson (1989 in Batman), über Heath Ledgers legendäre Darbietung (2008 in The Dark Knight) bis hin zu Jared Leto (2016 in Suicide Squad), ohne Mark Hamill zu vergessen, der seit Batman: The Animated Series in den frühen Neunzigern dem psychopathischen Clown in unzähligen Animationsformaten seine unvergessliche Stimme verleiht. Daher war die Herausforderung besonders für Joaquin Phoenix groß, der Figur treu zu bleiben und zeitgleich seine eigene Interpretation geltend zu machen. So wirft er sich mit Leib und Seele in jeden einzelnen Frame des Films, der durchwegs von seinem Schauspiel getragen wird. Er scheint stets den richtigen Ton zu treffen, wenn er die Verzweiflung seiner Figur über diverse Extremzustände artikuliert.
Phoenix hatte zuletzt 2017 für You Were Never Really Here viel Lob eingefahren, ein Film der (zu Unrecht) als „der Taxi Driver des 21. Jahrhunderts“ gefeiert wurde. Hier drängt sich jedoch der Vergleich mit einer anderen De-Niro-Scorsese-Kollaboration förmlich auf: The King of Comedy (treffenderweise 1982 erschienen). Beide Filme erzählen die Geschichte eines Außenseiters, der erwachsen noch bei Mutter lebt und sich nach nichts mehr sehnt, als ein angesehener Stand-up-Comedian zu werden, um bei der TV-Talkshow seines Lieblingskomikers aufzutreten. In beiden Fällen erhält der Antiheld jedoch erst die (mediatische) Anerkennung, die er sich so sehr wünscht, nachdem er eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen hat, von der es kein zurück gibt. Robert De Niros Anwesenheit in beiden Filmen, diesmal in der Rolle des TV-Ersatzvaters, verfestigt diese Parallele. Nur gestaltet sich Joker den heutigen Konventionen entsprechend lauter, gewalttätiger und psychologisierend.
Tatsächlich wird Arthur Fleck von vornherein und lange vor seiner Transformation zum Joker als Figur mit psychischen Problemen dargestellt, die unter Wahnvorstellungen leidet, Tabletten schlucken und zur Therapie gehen muss. Sein kennzeichnend krankhaftes Lachen ist hier nicht die Äußerung einer sadistischen Manie, sondern ein kompulsives Leiden, das er zu unterdrücken versucht und ihm seit seiner Kindheit anhaftet. Denn dort liegt natürlich die Wurzel allen Übels, im frühen Kindheitstrauma des abwesenden Vaters und der vernachlässigenden Mutter. Doch war die eigentliche Faszination mit dieser Figur nicht zuletzt im Mysterium um sie herum begründet: In den Comics war der Joker lange vergangenheitslos geblieben, quasi aus dem Nichts als Gegenstück, als Antwort auf Batman erschienen. Als seine Ursprungsgeschichte dann schließlich erzählt wurde (die kanonisierte Version, von der sich Joker stellenweise inspiriert, wäre Alan Moores Batman: The Killing Joke), war Batman selbst, wenn auch unbeabsichtigt, für die Geburt des Jokers verantwortlich. Was die Dienste von Batmans Heldengetue fundamental hinterfragte—da er somit an allen Übeltaten und Opfern des Jokers mitschuld war—wird in Joker umgedreht, indem letzterer (indirekt) für das spätere Aufkommen des Batmans verantwortlich gemacht wird. So erhält der Superheld wieder seine beruhigende Legitimität. Auch hat Phoenixs Joker wenig mit vorherigen Iterationen des Charakters zu tun. Im Gegensatz zu jenem als ‚Clown Prince of Crime‘ bekannten, kalkulierenden, manipulativen, psychopathischen Genie, hat dieser Joker keine Ahnung, wie er vorgehen soll: Zum Verbrechen gerät er per Zufall und stolpert erst durch eine überraschend positive Reaktion der Öffentlichkeit weiterhin diesen Pfad entlang.
Durch die Psychologisierung wird zwar der bestehende Mythos um die Joker-Figur untergraben, doch diese Distanzierung ermöglicht es Joker, als ernste Charakterstudie aufzutreten. Dabei hatte Regisseur Todd Phillips, bekannt für die Hangover-Trilogie, bis Dato ausschließlich Komödien gedreht. Hier versteht er es, nur dann das Publikum zum Lachen zu bringen, wenn es am wenigsten erwartet wird (in einer todernsten Situation). Auf diese Weise schwankt der Film ebenso wie Phoenixs Schauspiel zwischen verschiedenen Extremen und schneidet auf dem Weg zu viele Themen an, um ihnen wirklich gerecht zu werden. Vom Außenseiterdasein und Fragen psychischer Gesundheit, über die Vergötterung von Fernsehpersönlichkeiten und sensationalistische Verkennung durch Medien, bis hin zum allgemeinen Argwohn gegenüber der obersten Gesellschaftsschichten, dienen diese Themenkomplexe eher als Stufen zum schnellen Voranschreiten der Handlung hin zu ihrem finalen Höhenflug.
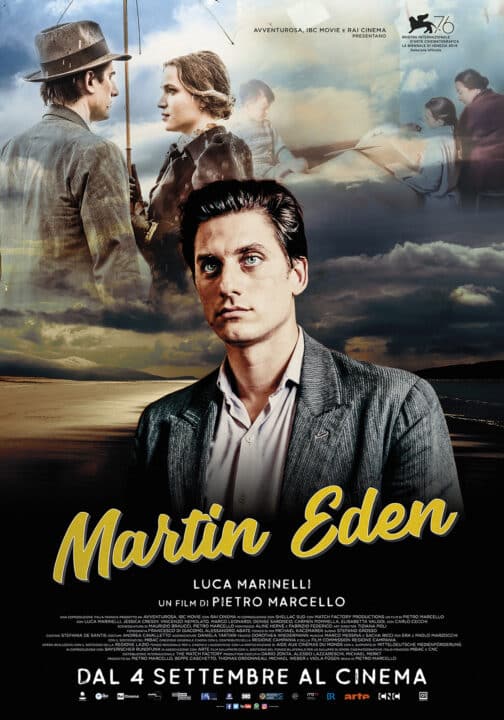
Edens Zeitlosigkeit
Folgedessen ist es ebenfalls verwunderlich, dass die Coppa Volpi für den besten Schauspieler nicht an Joaquin Phoenix ging, sondern an Luca Marinelli für seine Rolle als Martin Eden im gleichnamigen Film von Pietro Marcello. Marinelli spielt einen Autodidakt, der nach der Begegnung mit Elena (Jessica Cressy), der Tochter einer bildungsbürgerlichen Familie, danach strebt, vom Seemann zum Schriftsteller heranzuwachsen. Wir begleiten ihn bei seiner lesewütigen Selbstkultivierung und diversen Versuchen, als Schriftsteller den Durchbruch zu schaffen. Doch dieser gestaltet sich kompliziert für jemanden, der über die armen Verhältnisse schreibt, in denen er lebt und dessen Geschichten „zu traurig“ sind, um veröffentlicht zu werden. Er ließt Herbert Spencer und versteht sich als Individualist, glaubt ebensowenig an die Versprechen des Sozialismus wie an den heuchlicherischen Liberalismus der Familienoberhäupter seiner geliebten Elena. So erließt er sich sein Wissen zum harten Preis der Desillusion, eine Entwicklung die Marinelli mit Leidenschaft spielt und die auf Dauer in Martins Leidenschafts- und Lustlosigkeit am Leben selbst mündet. Dabei gelingt es dieser (lose auf dem gleichnamigen Roman von Jack London basierenden) Adaption passend zum Gegenstand eine eigene Poetik zu entwickeln, die dank eines gezielten Rückgriffs auf Archivmaterial entsteht. Diese stummen, dokumentarischen Aufnahmen unbekannten Ursprungs verleihen durch ihre historische Unbestimmtheit und Vielfalt dem Film als Ganzen eine Zeitlosigkeit. Durchkreuzt von diesen Dokumenten verläuft er lange ohne eindeutige zeitliche Zuordnung; erst zum Schluss wird mit dem angedeuteten Faschismus ein doch eher expliziter Anker gesetzt.

Männertheater
Andeutungen an den Faschismus enthält ebenfalls Roman Polanskis J’accuse (An Officer and a Spy), der allerdings historisch genau verortbar am 5. Januar 1895 in Paris mit der Degradierung des Kommandanten Alfred Dreyfus (Louis Garrel)—und somit dem Beginn der berühmten ‚Affaire Dreyfus’—einsetzt. Auch hier ist die Verleihung des silbernen Löwen für den großen Preis der Jury erstaunlich, da die Aufnahme von Polanskis Film in den Wettbewerb vor dem Festival—nicht zuletzt von Jury-Präsidentin Lucrecia Martel—angesichts der aktuellen MeToo-Debatte stark hinterfragt wurde. Letztlich prämierte man hier wohl eher der Gegenstand, also den unnachgiebigen Widerstand gegen ein antisemitsch motiviertes Unrecht, als die eher einfallslose Umsetzung. Die verschiedenen Wendungen der Dreyfus-Affäre werden extrem detailliert aus der doch etwas einseitigen Perspektive des Oberstleutnants Picquart (Jean Dujardin als aufrichtiger Franzose) wiedergegeben. Als einziges Mitglied des Militärapparats, das sich für die Aufklärung der Fakten einsetzte, spielte er eine Schlüsselrolle im Freispruch Dreyfus. So wird die Theatralik des Militärs und der Rechtsvorgänge ausgestellt, deren Korruptheit sich hinter verschlossenen Türen offenbart. Das resultierende laute, harte und farblich entsättigte Männertheater erinnert zeitweise an den Deutschen Historienfilm, ergänzt durch die zweifelhafte Qualität eines höheren production value. Außen vor bleibt die Spaltung der französischen Gesellschaft, welche die Dreyfus-Affäre seinerzeit hervorgekehrt hat und für die sie bis heute unvergessen bleibt. Stattdessen wird eine heroische Auflehnung einiger weniger ehrenhafter Männer geschildert, die nicht nur gegen den Militärapparat, sondern gegen die Meinung der Öffentlichkeit Widerstand leisten. Die Erscheinung von Emile Zolas J’accuse…!-Artikel wird effektiv emotionalisierend plaziert—und die Reaktion des Volks mit der Kristallnacht parallelgestellt, was dann doch eine Vereinfachung der Umstände darstellt—, während der eigentliche Freispruch bis zum Ende ausbleibt.
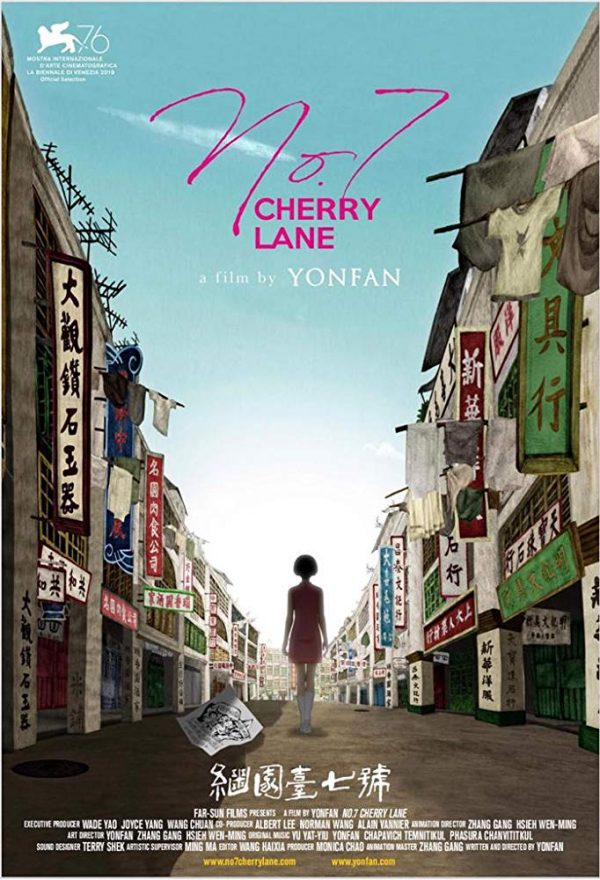
Intellektuelle Reden
Der Preis für das beste Drehbuch ging an Yonfan für Ji Yuan Tai Qi Hao (No. 7 Cherry Lane) aus Hong Kong SAR bzw. China. Auf dem Papier erscheint die Prämierung eines Drehbuchs voller Literaturreferenzen, die vor dem Hintergrund einer Liebesgeschichte im Hong Kong der Sechzigerjahre nach und nach mit der Handlung des Films verschmelzen, durchaus nachvollziehbar. Dafür wird der Animationsfilm in erster Linie von einer Off-Stimme erzählt, die sich gerne in endlosen Beschreibungen verliert und somit eben der literarischen Form deutlich näher bleibt, als der filmischen. Die wenigen, minimalistischen Dialoge werden in einer akustisch und schauspielerisch fragwürdigen Qualität eingespielt und leiden weiterhin an der extremen Langsamkeit, welche die Animationen ihnen aufbürden. Tatsächlich scheint sich jede Bewegung in Zeitlupe abzuspielen: Ob der Gang, die Gestik oder eben die Sprache, alles verläuft einschläfernd lethargisch, was vielleicht eine Form von Poesie hervorbringen soll. Hierbei wirken die Körper eigenartig gewichtslos und abgeschottet von ihrer Umwelt, computer-animiert in einem gezeichneten Setting, und erzeugen somit nicht die Illusion einer ontologischen Präsenz, die für überzeugendes Animationshandwerk vorrangig ist. Untermalt durch eine Streichorchestermusik, an deren Pathos lediglich Hollywood feel-good-movies der frühen Neunziger heranreichen, bleibt der Erzähltext wahrscheinlich das Einzige, was das Publikum in dieser intellektuellen Arbeit aufhorchen lässt.

Der größte Spion
Von den insgesamt acht im Concorso vergebenen Preisen ging dafür kein einziger an Olivier Assayas Wasp Network. In einem für ihn ungewöhnlichen Stil erzählt der französische Regisseur und Drehbuchautor von Spionage und Sabotage zwischen anti- und pro-kommunistischen Kubano-Amerikanischen Gruppierungen in den Neunzigerjahren. Der eher für unkonventionelle Erzählungen rund um selbstentfremdete Figuren bekannte Assayas inszeniert diese Geschichte über die realen „Cuban Five“ mit einer derartigen coolness, dass man meinen würde, er sei nach Hollywood übergesiedelt. Gerade die männlichen Hauptfiguren (gespielt von Edgar Ramírez und Wagner Moura), zeigen sich unentwegt selbstsicher und unbeirrt, obwohl die beiden Piloten gefährliche Flugeinsätze zwischen Miami und Havana pilotieren, an Waffen-, Drogentransporten und terroristischen Sabotageakten teilhaben und fleißig dem American way of life nacheifern. Mit der Gewandtheit eines Hollywood Suspense-Streifens gelingt dieser Koproduktion aus Frankreich, Spanien, Belgien und Brasilien dann eine 180° Kehrtwendung, die für einen US-Amerikanischen Film undenkbar wäre. Ungewöhnlich erfrischend ist hier auch die Perspektive der Ehefrauen auf beiden Seiten (jeweils Penélope Cruz und Ana Armas), die sämtliche Probleme mit Familie, Behörden und Presse schultern, weil die Männer meinen Held spielen zu müssen, ohne sie zuvor zu konsultieren. Letztlich lässt der Film ausreichend Perspektiven nebeneinander bestehen, um im Kubanischen Konflikt beiden Seiten Schuld zukommen zu lassen. Recht explizit ist er hingegen in seiner Kritik des US-Amerikanischen Vorgehens; denn das FBI wendet sich gnadenlos gegen jene, die ihnen zuvor ermöglicht haben terroristische Attacken zu verhindern. Der Film endet mit einem damaligen Fernsehinterview von Fidel Castro, der die USA als den größten Spion von allen anprangert. Durch seine schwer zu wiederlegende Aussage wird somit ein Bezug zur Gegenwart hergestellt, der bei anderen in der Vergangenheit angesiedelten Beiträgen im diesjährigen Wettbewerb ausblieb.
Dominique Ott
Seine Texte bei uns hier.











