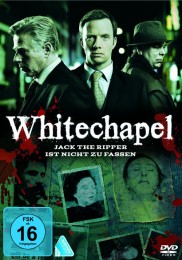 Wer ist Schuld?
Wer ist Schuld?
2009 strahlte ARTE die deutsche Fassung der ersten „Whitechapel“-Staffel aus. Anfang 2013 lief die dritte. Grund genug, sich noch einmal den Ursprung der britischen ITV-Serie anzusehen. Ein Klassiker-Check von Henrike Heiland.
Gerade in den letzten Monaten kam das Bashing deutscher Fernsehfilmproduktionen mal wieder so richtig in Fahrt. HBO-Serien werden als Krone der Schöpfung gefeiert, dänische Produktionen wie „Borgen“ lösen Ekstasen aus, BBCs „Doctor Who“ oder ITVs „Downton Abbey“ untermauern den Ruf, britische Serien seien einfach großartig. Nun ist natürlich das, was aus dem Ausland nach Deutschland kommt, ein Zerrbild des eigentlichen Produktionsspiegels. Den allergrößten Schrott kaufen die deutschen Sendeanstalten zum Glück nicht ein, und wenn, dann ist es nur ein kleiner Teil dessen, was anderswo wirklich alles ausgestrahlt wird. Wir kommen also recht sicher in den Genuss guter Verfilmungen. Und fragen uns zu Recht, wieso ein finanziell so gut ausgestattetes Pay-TV (also die öffentlich-rechtlichen Sender) auf weiten Strecken so unfassbar uninnovativ bleibt und uns Dinge wie „Heiter bis tödlich“ (ARD) oder „Heldt“ (ZDF) zumutet.
Auf Fernsehfilmempfängen ist es interessant zu beobachten, dass diese Frage von allen gestellt wird. Und jeder hat einen anderen Schuldigen. Die Kreativen sagen, es läge an den Senderredakteuren. Die Redakteure sagen, es läge am Publikum. Und wenn schon nicht am Publikum – weil selbiges ja vielleicht doch auch mal Qualität zu goutieren weiß – dann eben an den langweiligen Drehbuchautoren, die nichts Ordentliches anbieten. Letztens erst, da sagte ein Produzent zum anderen: „Ach, es gibt in Deutschland einfach niemanden, der gute Dialoge schreiben kann.“ Ha bloody ha.
Schaut man sich „Whitechapel“ vor diesem Hintergrund an und hält anschließend eine Folge von, sagen wir mal, „Soko Stuttgart“ oder „Ein Fall für Zwei“ daneben, sieht man schnell, dass gute Dialoge allein nicht den Karren aus dem Dreck ziehen würden. Die Dialoge bei „Whitechapel“ sind nämlich auch nicht nur brillant. Aber sie sind schon gut. Nur sind sie nicht das einzige, das sich deutlich abhebt.
 „Whitechapel“
„Whitechapel“
Erst einmal zum Inhalt der Serie: London, 2008, Jack the Ripper, der im Londoner Osten, genauer gesagt in Whitechapel, vor 120 Jahren die Serienkillerei erfand, hat einen getreuen Nachahmer gefunden. Der junge Detective Inspector Chandler, der herkunftsbedingt protegiert wird und auf der Karriereüberholspur ist, soll vorübergehend die Mordkommission leiten, um auch diesen Karriereschritt schnell abgehakt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt ist das mit dem Ripper-Nachahmer noch nicht ganz klar. Als immer deutlicher wird, womit es Chandler hier zu tun hat, rücken die Obersten von ihm ab, aus Angst vor seinem Scheitern. Außerdem ist die Polizistentruppe, die es zu domptieren gilt, ein recht unzivilisierter Haufen. Es braucht Zeit, bis sich alle aneinander gewöhnen.
Das alte Spiel: Oben die bösen Schreibtischhengste, denen es nur um Politik, gute Presse und schnelle Resultate geht. Unten die, die wirkliche Arbeit leisten und eben echte Polizisten sind. Der Serienkiller, an den anfangs natürlich niemand glaubt, weshalb weitere Unschuldige sterben müssen, bis wirklich alle an einem Strang ziehen. Über drei Folgen wird der neue Jack the Ripper gejagt, und am Ende – nun, da mag uns der wenn auch dämlich klingende deutsche Titel ein wenig zu viel zu verraten. Oder auch nicht.
Humor
Wie gesagt, dramaturgisch ist es im großen Bogen das alte Spiel. Und wie bereits angedeutet, sind die Dialoge beispielsweise nicht durchgehend brillant. Da wird schon mal das ein- oder andere etwas pathetisch überdeutlich ausgesprochen. Doch insgesamt fehlt es nicht an Humor. Besonders schwarzem Humor. Was die Klischees in den Figuren betrifft – DI Chandler mag im Maßanzug herumlaufen, Sushi statt fettigen Pommes essen und sich ein wenig zu sehr in seinen Lehrbüchern verlieren, aber wie er und sein Team sich näherkommen, das ist schon wunderbar erzählt. Unvergesslich die Szene, in der er akkurate Kleidung (samt Krawatte), gesunde Ernährung und vor allem ein Überdenken der täglichen Körperhygiene fordert: „Disziplin, Respekt, Deodorant!“, ruft er da, und wird dafür noch eine Weile von der Truppe verhöhnt, bis sich stillschweigend doch die meisten in die neuen Regeln einfinden und tatsächlich alles recht gut läuft. Nicht zu gut. Chandler bleibt irgendwie fremd und anders, weil Chandler eben der ist, der er ist. Die Figuren bleiben sich treu. Mit und ohne Krawatte. Sie haben Tiefe, die nicht in Dialogen zerredet, sondern in Mimik und Gestik, in Details nebenher erzählt wird.

Detective Sergeant Miles (Phil Davis), Detective Inspector Chandler (Rupert Penry-Jones) und Buchan (Steve Pemberton)
Narration
Das ist einem glücklichen Zusammenspiel von Drehbuch, Schauspielern und Regie zuzuschreiben, aber auch grundsätzlich einer Erzählweise, die in Deutschland noch nicht überall angekommen zu sein scheint. Während hier Sendeminuten damit vergeudet werden, dass man den Darstellern dabei zusieht, wie sie Treppen runterlaufen, Kaffeemaschinen nicht bedienen können oder einen Telefonhörer in die Hand nehmen, ist bei „Whitechapel“ jede Einstellung zugleich Erzählung. Da wird jede Sekunde dramaturgisch genutzt. Wenn schon jemand eine Treppe hinuntergeht, wird dabei noch etwas anderes miterzählt, nicht nur „Protagonist geht die Treppe runter“. Sondern „Protagonist geht die Treppe runter und macht dabei mit den drei anderen, die mitkommen, eine wichtige Einsatzbesprechung.“ Das ist jetzt nicht so schwer.
Weiter fällt das Tempo der Dialoge auf. Da nicht wenig Humor in dieser grundsätzlich eigentlich düsteren Serie zu finden ist, lässt sich hier auch gleich noch ein weiteres deutsches Problem ansprechen: deutsche Komödien. Was man lernen kann, ist das Timing. Rasant, ohne zu viel Zeit zum Nachdenken. Überraschend, aus dem Hinterhalt. Auch mal nebenher, statt mit Großaufnahme und dreiminütiger Vorlaufzeit. Das geht. Das geht sogar sehr gut. Und kommt beim Publikum an. Trocken erzählen, statt Hahaichkenndanenwitzichsacheuchichlachjetzschontränen.
Kameraführung und Schnitt – sehr schön, sehr gut eingesetzt. Tolle Bilder, die mehr erzählen als so mancher Dialog, und die vor allem Atmosphäre schaffen. Die Musik ist ebenfalls nicht nur gut und passend komponiert, sondern sitzt auch auf den richtigen Stellen, und auch an Maske, Kostüm, Setdesign, Beleuchtung etc. gibt es wenig bis nichts zu meckern. Das ist es, was diese britische Serie ausmacht: solides Handwerk, auf den Punkt gebracht. Und zwar von allen im Produktionsteam. Dazu muss nichts neu erfunden werden, dazu braucht man nichts rückwärts oder seitwärts oder sonstwie erzählen. Letztlich kann man „Whitechapel“ eigentlich konventionell in Anlage und Struktur nennen. Aber warum nicht bewährten Erzähltraditionen folgen und trotzdem eine sehr gute Produktion daraus machen statt lieblos erzählten, gähnend langweiligen Unfug?
Qualitätsstandard
Nein, „Whitechapel“ erfüllt die Erwartungen des Freitag- bis Sonntagabend-Fernsehzuschauers, ohne zu überfordern, und übertrifft sie schlicht durch einen hohen Qualitätsstandard, den man ansonsten leider kaum hierzulande zu sehen bekommt.
P.S. zur deutschen Fassung: Was immer ein Wehrmutstropfen ist – die Synchronisation. An einigen Stellen wurde nicht ganz so aufmerksam produziert – da spricht jemand von deutschen Touristen, die nur Sekunden vorher noch einen französischen Akzent (anders als im Original, da sollen es wirklich Deutsche sein) verpasst bekommen haben. Und was niemals transportiert werden kann, sind die unterschiedlichen Akzente und Dialekte, die so viel über Herkunft und Bildung der Figuren sagen. Ein unlösbares Problem leider. Die hervorragenden Originalschauspieler (die drei Hauptrollen bei den Ermittlern sind besetzt mit Rupert Penry-Jones als DI Chandler, Steve Pemberton als beratender Ripperologe Edward Buchan und Philip Davis als DS Ray Miles) kommen mit den deutschen Stimmen lange nicht so virtuos und vielschichtig an, aber auch das ein Problem, das sich nicht wirklich anders lösen lässt. Insgesamt ist die deutsche Fassung weitgehend in Ordnung.
Henrike Heiland
Whitechapel – Jack the Ripper ist nicht zu fassen
(DVD). Großbritannien 2009. Regie: S.J. Clarkson. Drehbuch: Ben Court, Caroline Ip. Kamera: Balazs Bolygo. Laufzeit: 135 Minuten. Produzent: Marcus Wilson, Sally Woodward Gentle. Schnitt: Liana Del Giudice. Darsteller: Rupert Penry-Jones, Philip Davis, Alex Jennings, Johnny Harris, Steve Pembert und weitere. FSK: 16. 9,99 Euro. Bei arte. Szenenbilder © polyband Medien GmbH.












