 Nüchtern betrachtet
Nüchtern betrachtet
Der Kriminalroman als Gesellschaftsroman – Hideo Yokoyamas breitwandbreites Panorama „64“ ist ein gewichtiges Werk. Thomas Wörtche und Frank Göhre lesen es unterschiedlich.
Ein 760-Seiten Epos über Machtkämpfe in einer Behörde zu schreiben, ist zumindest ehrgeizig. Weil diese Behörde in Hideo Yokoyamas Roman „64“ die Polizei einer mittleren Großstadt namens „D.“ irgendwo in Japan ist – „580000 Haushalte, 1820000 Bürger“ – und diese Behörde neben dem Alltagsgeschäft gerade mit einem nicht gelösten, 14 Jahre alten Entführungsfall beschäftigt ist, zu dem sich ein neuer, ähnlich gelagerter Fall hinzugesellt, scheinen zunächst einmal alle Voraussetzungen vorhanden, um von einem Kriminalroman zu sprechen. Hauptfigur ist Yoshinobu Mikami, der Pressedirektor der örtlichen Polizei, also ein Mann der Verwaltung. Früher war Mikami Ermittler bei der operativen Abteilung und damals mit dem Fall 64, wenn auch nicht in führender Position, beteiligt. Zwischen der Verwaltung und den operativen Abteilungen herrscht ein erbittertes Machtgerangel, das sich vor allem auf das Verhältnis zur Tokioter Zentrale und damit um politischen Einfluss dreht.
Fall 64 ist der Codename für die Entführung und Ermordung eines kleinen Mädchens, der aufgrund böser Pannen nie aufgeklärt wurde. Wie sich herausstellt, wurden diese Ermittlungspannen unter den Teppich gekehrt, um Image-Schaden von der sich als omnipotent denkenden Ordnungsmacht abzuwenden. Jetzt steht der Fall kurz vor der Verjährung, was für den Generalinspekteur der Nationalen Polizeibehörde aus Tokio Anlass für eine Imagekampagne ist: Die japanische Polizei gibt nie auf. Deswegen will er mit dem hinterbliebenen Vater des Opfers öffentlichkeitswirksam reden. Ein angekündigter Besuch, der die Polizei von D. in Panik und Entsetzen stürzt. Gleichzeitig drohen rigorose „Spielregeln“ für die Presse, die von der Führung kommen, für Unmut und offene Opposition der Medien. Mikami muss einen Mehrfrontenkrieg führen – er soll die Presse befrieden, er soll den Vater des Entführungsopfers zur Kooperation überreden, er soll seine neue Loyalität gegenüber der Verwaltung beweisen, von der er als potentieller Gegner, weil von der Ermittlerseite kommend, gesehen wird und er soll seine kriminalistischen Standards nicht verraten, die den Pfusch bei „64“ nicht ignorieren können, und sich also gegen seine Kollegen wenden. Erschwerend hinzu kommt, dass seine eigene Tochter vermutlich weggelaufen, auf jeden Fall spurlos verschwunden ist und seine Ehe daran zu zerbrechen droht. Als alle diese Problemfelder sich zu einer hyperkomplexen, hochexplosiven Gemengelage aufgeschaukelt haben, geschieht wieder eine Entführung, als deren Blaupause Fall 64 deutlich zu erkennen ist.
Alle diese Stränge dröselt Yokoyama einlässlich auf – fast in Zeitlupe. Wir sind ganz nahe bei Mikami, wir folgen seinen akribisch zergliederten Gedanken, seinen Zweifeln, seinen Nöten, seiner Panik, seiner fachlichen Kompetenz, seinen Irrtümern, seinem Ehrgeiz, seinen Niederlagen und seinen Siegen. Die ersten zwei Drittel des Romans befassen sich hauptsächlich mit den Intrigen und Gegenintrigen im Polizeiapparat und mit den Recherchen Mikamis, der das Versagen von damals für viele Beteiligte schmerzhaft rekonstruiert. Erst als der aktuelle Entführungsfall aufkommt, nimmt der Roman narrativen Drive auf. Und den hatte man lange vermisst. „64“ bewegt sich lange sehr zähflüssig, was man vielleicht als wider „Gerne-Konventionen“ gerichtet verstehen kann. Man kann es aber auch, ist der Algorithmus erstmal und relativ schnell erkannt, als bedeutungsschwangeres Aufpumpen topischer Elemente lesen: Konkurrierende Polizei-Fraktionen, Vertuschung, private Probleme, Loyalitätskonflikte, Skrupel und Zweifel, politische Implikationen der Polizeiarbeit, Vergeltungsaktionen, Impact der Medien, kleinteilige Ermittlungsarbeit, der human factor– da steckt im Grunde wenig Überraschendes oder Originelles drin. Und die Perspektive des anständigen Polizisten und der Prozess seiner Selbstfindung (der literarisch und geistesgeschichtlich im europäischem 18. und 19. Jahrhundert wurzelt oder zumindest analog konstruiert ist) generieren hohe Sympathie- und Identifikationswerte, man soll und muss Mikami mögen. Aber der bedeutungsheischende Gestus und der große Aufwand für nicht allzu Gewaltiges erzeugt schon ein gewisses Unbehagen.
Thomas Wörtche
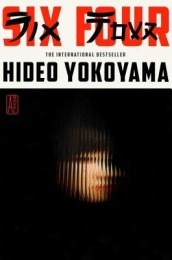 Weitaus mehr als ein „Thriller“
Weitaus mehr als ein „Thriller“
Wir müssen uns Mikami als einen japanischen Beamten mit einem grobschlächtigen Gesicht vorstellen, mit kantige Wangenknochen, einer dicken Nase und Schlitzaugen: „Er sah aus wie ein freiliegendes Stück Fels.“ Später wird er einmal als „Hackfresse“ beschimpft. Seine Frau Minako hingegen ist von natürlicher Schönheit, und es bleibt erst einmal ein Rätsel, wie die beiden zusammengefunden und schließlich geheiratet haben. Es ist nur eins von vielen Rätseln in diesem 768 Seiten-Roman über ein Japan zu Beginn des 21. Jahrhunderts und über Frauen und Männer, die sowohl ihr Gesicht bewahren, wie auch im traditionellen Sinn verlieren oder es gar unwiederbringlich abstreifen, es sich „abreißen“ wollen. Die spurlos verschwundene Tochter des Ehepaar zumindest hat die äußere Änlichkeit mit ihrem Vater haßerfüllt verflucht. Wohin aber ist sie abgetaucht und was ist ihr Ziel?
Mikami war lange Zeit beim KUA (Kriminaluntersuchungsamt), ein Ermittler, der jetzt Presseamtsleiter des gesamten Apparats ist. Er wird offiziell mit den Worten getröstet, „260.000 Freunde“ zu haben, die seiner Tochter nachforschen, sämtliche Polizisten des Landes also, vom Verkehrspolizisten bis zum Präsidenten. Dem ist natürlich nicht so. An Freunden gibt es nur einige wenige, an internen Gegnern wesentlich mehr. Denn Mikamis persönliches Schicksal als Vater wird konfliktreich gedoppelt mit der Wiederaufnahme eines Entführungsfalles, der nie gelöst wurde. Ein junges Mädchen wurde vierzehn Jahre zuvor entführt und ermordet, obwohl der Vater die 20 Millionen Yen Lösegeld gezahlt hatte. Der Entführer konnte nie ermittelt und gefasst werden, die 20 Millionen blieben verschwunden. Die jetzt neu verordneten Nachforschungen führen zu einer Erkenntnis, die eigentlich eine Binsenwahrheit ist, in ein staatliches System nämlich, in dem Nachlässigkeit, mangelnde Qualifikation und Intrigen den beruflichen Alltag bestimmen und Eigeninitiative ein bedrohlicher Störfaktor ist.
Zu einem solchen aber wird der Pressesprecher Mikami, der dann letztlich von einer Inszenierung der besonderen Art überrascht wird. Dieses Ende einer zwischen Tradition und Moderne etablierten Geschichte ist für den Leser ebenso verblüffend und zudem schlichtweg grandios. Mit „64“ liegt ein Roman vor, der weitaus mehr als „Thriller“ (Titelbezeichnung) oder Spannungsliteratur ist, vielmehr völlig frei von Genrebezeichnungen als große Literatur gewürdigt werden muss.
Frank Göhre
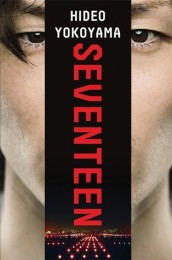 Hideo Yokoyama: 64 (Tokio, 2012). Thriller. Atrium Verlag, Zürich 2018. Aus dem Englischen von Sabine Roth und Nikolaus Stingl. 768 Seiten, 28 Euro.
Hideo Yokoyama: 64 (Tokio, 2012). Thriller. Atrium Verlag, Zürich 2018. Aus dem Englischen von Sabine Roth und Nikolaus Stingl. 768 Seiten, 28 Euro.
Siehe auch unseren exklusiven Textauszug im CrimeMag März 2018. Gerade in UK erschienen: Hideo Yokoyama: Seventeen. Riverrun, London 2018. 404 Seiten.
Und zu Japan: in dieser Ausgabe Peter Münders Besprechung von Hiroshige & Eisen „Die 69 Stationen des Kisokaido“.











