
„Der missversteht die Himmlischen …“
Kriminalliteratur hat immer mit den „letzten Dingen“ zu tun. Mit Gewalt, Verbrechen, Tod und Elend. Wie kann Gott so etwas zulassen? Oder: Wo steckt inmitten all des Chaos und der Kontigenz hinieden der Sinn des Lebens? Überall in der populären Kultur? Markus Pohlmeyer zur Theodizee.
Popkulturelle Spuren
Eine humorvolle, popkulturelle Annäherung an die Theodizee-Problematik könnte so lauten: „Ich glaube, dass Donald Duck ein Träumer ist, ein Poet – und deshalb ein Pechvogel.“[1] Donald ist ein Alltagsarchetyp, eine Ente, pardon, ein Mensch wie du und ich, in klassischer Verfremdung einer nie abschließbaren, immer weiter erzählbaren Tierfabel, die durch die Jahrzehnte der Moderne und Postmoderne wandert: ständig beanstandet von seiner Verlobten Daisy, getrieben von seinem geldgeilen Onkel Dagobert und Schulden, pädagogisch bis an die Grenze herausgefordert als alleinerziehender Onkel, träumt Donald in seiner Parallelexistenz als Superheld und Geheimagent sehr reale kompensatorische Träume – zum Wohle vieler, aber oft ungesehen, oft unterschätzt. Denn um seine Identität als Phantomias zu wahren, veranlasst er die Enten/Menschen in seiner Umgebung, nach getaner guter Tat Pillen des Vergessens zu nehmen. (mehr zu Phantomias auf CM)
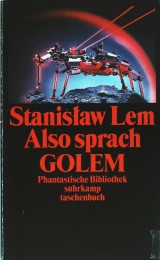 Der Roman Also sprach Golem von Stanisław Lem entwickelt eine literarische Anthropologie aus der Sicht des Supercomputers Golem; dieser mahnt fragend, dass in allen Religionen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der „[…] Körper zum Schauplatz der Schlacht um die zu erlangenden Ewigkeit gemacht wird? Diese nichtendende Schlacht hat dabei ihre Ursache nicht allein in der Angst vor dem Tode, sondern auch im Nichteinverständnis mit dem Diesseits, das ungeschönt so schwer zu akzeptieren ist.“[2] Das alles scheint nichts anderes zu sein als eine Variante der Theodizee-Problematik im Gewand von Science-Fiction aus der fiktiven Perspektive eines trans-humanen Wesens heraus, dieses so menschliche Leiden an der Kontingenz und einer schieren Sinnlosigkeit, wie schon von Voltaire in einem Gedicht als Reaktion auf das Erdbeben von Lissabon (1755) klassisch formuliert:
Der Roman Also sprach Golem von Stanisław Lem entwickelt eine literarische Anthropologie aus der Sicht des Supercomputers Golem; dieser mahnt fragend, dass in allen Religionen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der „[…] Körper zum Schauplatz der Schlacht um die zu erlangenden Ewigkeit gemacht wird? Diese nichtendende Schlacht hat dabei ihre Ursache nicht allein in der Angst vor dem Tode, sondern auch im Nichteinverständnis mit dem Diesseits, das ungeschönt so schwer zu akzeptieren ist.“[2] Das alles scheint nichts anderes zu sein als eine Variante der Theodizee-Problematik im Gewand von Science-Fiction aus der fiktiven Perspektive eines trans-humanen Wesens heraus, dieses so menschliche Leiden an der Kontingenz und einer schieren Sinnlosigkeit, wie schon von Voltaire in einem Gedicht als Reaktion auf das Erdbeben von Lissabon (1755) klassisch formuliert:
„O arme Sterbliche! O jämmerliche Erde!
O all der Sterblichen beklagenswerte Herde!
Du ewiges Geschehn nutzloser Katastrophen!
Ihr ruft: »Alles ist gut!« Getäuschte Philosophen,
kommt her und schaut euch an: entsetzliche Ruinen,
die Scherben und der Schutt, von Asche die Lawinen,
und Schicht auf Schicht gehäuft die Kinder und die Frauen,
[…]“[3]
Ein weiteres Beispiel jenseits von Naturkatastrophen, menschengemacht, nun aus der Welt der Krimiverfilmungen: Commissario Brunetti sitzt vor wunderschöner venezianischer Kulisse mit seiner Familie beim Abendessen.[4] Sein Sohn liest bestürzt aus einer Zeitung vor, wie der italienische Staat mittlerweile finanziell von der Mafia abhängig sei, einer kriminellen Institution!, und fügt hinzu, dass ja seine Eltern eben von diesem Staat bezahlt würden. Schweigen auf der Elternseite. Mutter zum Sohn: Der Staat sei ja die kriminelle Organisation! Und Brunetti selbst wird später bitter erfahren, dass durch die Geschäftspraktiken seines Schwiegervaters die kriminelle Organisation auch nicht vor seiner Familie halt macht, sodass er selbst zum Beobachtungsobjekt eines Mafiajägers wird. Man könnte hier noch humorvoll-ironisch hinzufügen – mit Blick auf die US-amerikanische Prohibitionszeit: „Das ‚Boardwalk Empire‘ von Kuehnle, Johnson oder Farley mag korrupt gewesen sein, aber zumindest kompetent. Das kann man von der heutigen Regierung nicht behaupten.“[5]
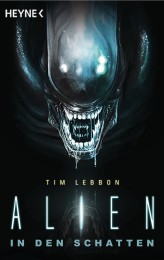 ALIEN und andere andere
ALIEN und andere andere
Der Roman von Tim Lebbon Alien. In den Schatten[6] zählt gewiss nicht zu den Meilensteinen dieser Gattung, aber er variiert diese Science Fiction-Saga (zwischen Alien und Aliens angesiedelt) äußerst geschickt und überaus spannungsreich. Von einem Raumschiff über eine Landefähre auf eine Planetenoberfläche, von dort in eine Mine, und dann hinab auf die tiefste Ebene. In einer riesigen Halle, gejagt von Aliens, finden die Protagonisten ein uraltes Schiff – und nun beginnt eine Odyssee durch die Gänge des Wracks (das Bergleute und seine tödliche Fracht fanden) mit immer neuem Horror und Schrecken. Das ist eine Höllenfahrt pur.
In der Reduktion auf Töten und Reproduktion avanciert das Alien zu einer Ikone des Bösen – aber paradoxerweise absichtslos. Denn wenn man der Interpretation Ridley Scotts in Prometheus folgen möchte, wären die Aliens nichts anderes als Biowaffen, konstruiert von einer außerirdischen Rasse. Wieder wird die Frage der Theodizee bzw. Verantwortung verschoben: von Gott weg auf jene anderen Schöpfer, die mit ihrem Geschöpfen unglaubliches Leid produzieren und ihnen ja auch selbst zum Opfer fallen. Auf der menschlichen Seite ist der Protagonist ein Konzern, der buchstäblich über Leichen geht, der die entsprechenden Schiffsbesatzungen und Minenarbeiter für entbehrlich einstuft und alle Wege der Manipulation nutzt, um ja nur an ein Exemplar – aus Profitgier oder aufgrund von militärischen Motivation? – dieses fremden Organismus zu gelangen. Ein kleiner Exkurs zum Stichwort Profitgier, der das ernste Potenzial hinter den popkultigen Aliens verdeutlichen mag:
„So lange der Krieg als eine Möglichkeit überhaupt in Betracht kommt, d. h. also, so lange es Berufszweige gibt, die auf die Möglichkeit eines Krieges gestellt sind, ferner so lange es auch nur einen Menschen gibt, der durch den Krieg seinen Reichtum vergrößern oder solchen erwerben kann und der zu gleicher Zeit die Macht hat oder den Einfluß, einen Krieg herbeizuführen, genau so lange wird es Kriege geben.“[7]
Die Alien-Reihe wird von zwei Konstanten bestimmt, die in beliebigen medialen Variation auftreten, was folgendes Zitat von der Rückseite eines (action-reichen) Comic-Bandes sehr gut illustriert, auch in einer religiös angehauchten Wortwahl mit negativen Konnotationen, wenn von Hybris oder Gnadenlosigkeit die Rede ist. Beide Akteure umkreisen sich in einem mörderischen Totentanz. Das Epitheton ewig für den Charakter des Aliens betont die Unausweichlichkeit, das Mechanische. Die Kreativität des Menschen in Verbindung mit seinem Hochmut, das ist sein scheinbar unausweichliches Wesen und letztlich seine Dummheit, ermöglicht eine noch größere Katastrophe.
„[…] man’s hubris and greed just as inevitably fuel the desire to try to unlock the secrets of the demonic beasts’ biology or bring the creatures under control as tools to build an even more monstrous future. In this landscape, two things must not be forgotten, must never be underestimated: the eternal, pitiless lethality of the Alien and the blind, monumental foolishness of Man.“[8]
Doch es gibt noch ein anderes Moment im Wesen des Menschen: das der Freiheit. In Lebbons Roman geben die fremdbestimmten Opfer ihren Überlebenswillen zugunsten einer selbstbestimmten Opferbereitschaft auf, um unter allen Umständen zu verhindern, dass ein Alien in die Hände des Konzerns gelangt. In der finalen Szene von Alien³ stürzt sich die Hauptfigur Ellen Ripley in Kreuzigungspose in einen Schmelzofen und reißt somit eine Alien-Königin in den Tod, eine Anspielung auf die christologische Formel: für uns gestorben.[9] Im dem angeführten Alien-Roman wird auch eine Himmelfahrt inszeniert: der Höllen-Planet wird verlassen; dann die Apokalypse: die Mine wird in einer nuklearen Explosion zerstört; dann eine Auferstehung: die schwer verwundete Ripley wird medizinisch wieder hergestellt – und dabei wird auf ihren Wunsch hin ihr Gedächtnis gelöscht.[10] Das Ungeheuer(e) scheint nur durch Vergessen erträglich.
Kosmische De(kon)struktion und tötende Abstraktionen
Soweit für uns beobachtbar, ist das Universum gekennzeichnet von unbeschreiblicher Gewalt: Supernovae, Quasare und Schwarze Löcher. Ein Kometeneinschlag als Markierung des Endes der Kreidezeit wirkt dagegen eher wie eine Randnotiz.[11] Die kosmische Gewalt trägt auch Momente des Schöpferischen in sich. Ohne den Untergang der (non-avialen) Dinosaurier kein Aufstieg der Säugetiere. Diese Formen kosmischer Gewalt wären aber eher als Prozesse zu beschreiben, die, aus den physikalischen Gesetzen resultierend, (makro- und mikrokosmisch), die Genese und Evolution von Galaxien, Sternen und Planeten und letztlich auch des Lebens und des Geistes bestimmen. Aus unserer menschlichen Perspektive werden sie mit den Attributen von Destruktion und Zerstörung versehen – und es kann immer nur unsere Perspektive sein, mit der wir die Welt beschreiben. Sich eines solchen Anthropomorphismus bewusst zu werden, impliziert aber auch, eine kritische Distanz innerhalb des feststehenden Rahmens zu etablieren, möge diese in verschiedenen Spielarten nun Metaphysik, transzendentale Analyse oder Ideologiekritik genannt werden. Durch die Immanenz unserer Hermeneutik qua Menschsein wird die Transzendenz (hier verstanden als alles, was nicht Mensch ist) menschlich beschrieben – und nur durch diese Zuschreibung erhalten die Kategorien von Gut und Böse ihren funktionalen, sozialen, ethischen Sinn (der ja schon innerhalb von menschlichen Gemeinschaften immens differieren kann). Naturwissenschaften und Naturgesetze haben eine destruktive Seite, deren zerstörerisches Potential, bis zu einem gewissen Grade Menschen durch Wirtschaft, Militär und eine alles lenkende Bürokratie verfügbar gemacht, globale Katastrophen evozieren kann.
„Der SS-Obersturmbannführer ADOLF EICHMANN subsumierte in seiner logistischen Arbeit unter die Zahl 10 000 die in den frühen 40er Jahren täglich in deutschen Konzentrationslagern zu ermordenden Juden. […] Bei der Anwendung auf den »industriellen« Völkermord an den Juden haben die mathematischen Gesetze funktioniert. Abstraktionsvermögen und Rationalität sind ethisch irrelevant.“[12]
Hannah Arendts Diagnose bleibt ungebrochen in ihrer erschütternden, ernüchternden Wucht: „Das größte begangene Böse ist das Böse, das von Niemanden getan wurde, das heißt, von menschlichen Wesen, die sich weigern, Personen zu sein […], die sich weigern, selbst darüber nachzudenken, was sie tun, und die sich auch im Nachhinein gegen das Denken wehren […].“[13] Im Grunde bedeutet dies nichts anderes als die Umkehrung der Kantischen Forderung, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen! Die Kunst des Alibis und der Projektion scheint eine menschliche Konstante:
„Der missversteht die Himmlischen, der sie
Blutgierig wähnt; er dichtet ihnen nur
Die eignen grausamen Begierden an.“[14]
 Mythologie kann auch der Versuch sein, narrativ diese schwere Welt zu deuten und zu beherrschen (in den Formen der Magie), ein Versuch, der sukzessive abgelöst worden ist durch Philosophie und Naturwissenschaft. Science Fiction kann in diesem Kontext – als Mythologie einer industrialisierten, medialisierten, globalisierten Moderne – der Versuch sein, narrativ (bzw. visuell-filmisch) einen Kosmos zu deuten, der sich uns durch Physik, Biologie und Astronomie erschlossen hat, aber uns auch in seinen trans-humanen Dimensionen zu marginalen Phänomen degradiert. Die Verlustgeschichte ist bekannt: erst verliert die Menschheit ihren Platz im Mittelpunkt des Universums, dann bewohnt sie einen Planeten in einem Seitenarm einer von Abermilliarden Galaxien, die zu einem Kosmos gehören, der auch nur einer von vielen sein mag. Fast möchte man hinzufügen: ad infinitum. Demgegenüber verschafft sich der Mensch quasi-göttliche Fähigkeiten – via Gentechnik, Medizin, Medien, Technik etc. bis hin zum apokalyptischen Potential in Gestalt von ökologischen, atomaren oder politischer Katastrophen.
Mythologie kann auch der Versuch sein, narrativ diese schwere Welt zu deuten und zu beherrschen (in den Formen der Magie), ein Versuch, der sukzessive abgelöst worden ist durch Philosophie und Naturwissenschaft. Science Fiction kann in diesem Kontext – als Mythologie einer industrialisierten, medialisierten, globalisierten Moderne – der Versuch sein, narrativ (bzw. visuell-filmisch) einen Kosmos zu deuten, der sich uns durch Physik, Biologie und Astronomie erschlossen hat, aber uns auch in seinen trans-humanen Dimensionen zu marginalen Phänomen degradiert. Die Verlustgeschichte ist bekannt: erst verliert die Menschheit ihren Platz im Mittelpunkt des Universums, dann bewohnt sie einen Planeten in einem Seitenarm einer von Abermilliarden Galaxien, die zu einem Kosmos gehören, der auch nur einer von vielen sein mag. Fast möchte man hinzufügen: ad infinitum. Demgegenüber verschafft sich der Mensch quasi-göttliche Fähigkeiten – via Gentechnik, Medizin, Medien, Technik etc. bis hin zum apokalyptischen Potential in Gestalt von ökologischen, atomaren oder politischer Katastrophen.
„Letztlich wird an den totalitären Ideologien die tödliche Gefahr offenbar, das Heilige als Mittel auf Weltliches anzuwenden. […] Damit aber das Innerweltliche, das zum endgültigen Heil erklärt wird, wirklich auch das Heil bringt, versucht man es mit aller Macht durchzusetzen. Das heißt: die Machtanwendung erhält die Totalität des Religiösen und führt, da keine Vertröstung mehr geduldet werden kann und stattdessen innerweltlicher Erfolg ausgewiesen werden muss, zu einer Übersteigerung noch der härtesten Diktatur, eben zum Totalitarismus.“[15]
Dem archaisch-zyklischen Denken fernöstlicher Religionen steht das die europäische und westliche Welt dominierende archaisch-lineare Denken des Judentums und Christentums (komplementär? konfrontativ?) gegenüber. Die säkularisierten Formen dieses Denkens behalten zwar seine telische Dynamik bei, eröffnen aber auch die Freisetzung des Menschen aus transzendenten Verwiesenheiten und kirchlich-institutionellen Bindungen. Die Architektur konstruierter Heilsmechanismen findet neue Gestalten: Kapitalismus, poltische Ideologien, Konsumismus oder noch umfassender formuliert: das Soziale.[16] Damit verlagert sich auch die Theodizee und der eschatologische Horizont: der Mensch wird radikal für sich selbst und seine Zukunft verantwortlich. Ob dies eine Überforderung, ob dies Hybris bedeutet oder ob sich darin ein ernst zu nehmendes Motiv christlicher Theologie artikuliert, dass ein Schöpfergott sein Geschöpf unbedingt frei wissen möchte – mit allen möglichen Konsequenzen und Risiken, auch dies muss hier unbedacht bleiben.[17]
Markus Pohlmeyer
Markus Pohlmeyer lehrt an der Universität Flensburg (Schwerpunkte: Religionsphilosophie; Theologie und Science Fiction).
[1] Im Gespräch mit Massimo Fecchi, in LTB ABO+, Nr. 4/2014, 18. Zum Weiterlesen empfohlen A. Platthaus: Die 101 wichtigsten Fragen. Comics und Manga, München 2008 und Ders.: Im Comic vereint – Eine Geschichte der Bildgeschichte, Frankfurt am Main – Leipzig 2000.
[2] S. Lem: Also sprach GOLEM, übers. v. F. Griese, Frankfurt am Main 2009, 97.
[3] Voltaire: Das Erdbeben von Lissabon, in: Was ist das Böse? Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, hg. v. C. Schäfer, Stuttgart 2014, 185.
[4] Donna Leon: Schöner Schein, © die Landesrundfunkanstalten der ARD und Universum Film GmbH.
[5] N. Johnson: Boardwalk Empire. Aufstieg und Fall von Atlantic City, übers. v. B. Mayer, München 2013, 357.
[6] T. Lebbon: Alien. In den Schatten, übers. v. K. Kurz, München 2014.
[7] A. Schnitzler: Das große Lesebuch, ausgewählt v. S. Michel, Frankfurt am Main 2008, 287.
[8] Klappentext von ALIENS™ OMNIBUS 5, 1987 – 2008 (Dark Horse Books)
[9] Vgl. dazu auch M. Frisch – M. Lindwedel – Th. Schärtl: Wo nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Science-Fiction-Filme: Angewandte Philosophie und Theologie, Regensburg 2003.
[10] Dadurch schafft der Autor geschickt den erzählerischen Anschluss an den Film Aliens.
[11] Vgl. dazu auch G. Baudler. Der freigelassene Kosmos. Naturwissenschaft und Schöpfung, Ostfildern 2011. Hier wird der Kosmos alles andere als niedlich und kuschelig in denkfaule Theologie zurückentschärft.
[12] G. Baudler: Darwin, Einstein – und Jesus. Christsein im Universum der Evolution, Düsseldorf 2009, 185.
[13] H. Arendt, in: Was ist das Böse? Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, hg. v. C. Schäfer, Stuttgart 2014, hier 298.
[14] J. W. von Goethe: Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel, hg. v. M. Kämper, Stuttgart 2013, 19.
[15] A. Angenendt: Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, 2. Aufl., München 1997, 331 f. Vgl. dazu auch Markus Pohlmeyer-Jöckel: Ein Florilegium, literarisch: Die Blumen des (Un)Heiligen, in: Ders. (Hg.): Heilige: die lebendigen Bilder Gottes. Mit Beiträgen v. A. Angenendt u. a. (Glauben und Leben 6), Münster 2002, 73-87.
[16] Vgl. dazu ausführlich G. Gamm: Einleitung: Zeit des Übergangs. Zur Sozialphilosophie der modernen Welt, in: Hauptwerke der Sozialphilosophie, hg. v. G. Gamm u.a., Stuttgart 2001, 7-27. Nach Gamm scheint das Soziale die einzige umfassende Wirklichkeits- und Beschreibungskategorie der Moderne, die nach dem Untergang der Metaerzählungen, Metaphysik und Natur übriggeblieben sei.
[17] Ein Denkangebot, voller Trauer und Schmerz, ist zu finden in H. Jonas: Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, 14. Aufl. 2013 (suhrkamp).











