 Der Chronist der alten Bundesrepublik
Der Chronist der alten Bundesrepublik
Ein Porträt über Frank Göhre von Elfriede Müller.
Wie viele Kriminalautoren ging auch Frank Göhre einigen Berufen nach, bevor er hauptberuflich Schriftsteller wurde. 1943 geboren, absolviert er zwei Lehren, zum Großhandelskaufmann und zum Buchhändler. Später arbeitet er als Buch- und Kunsthändler, als Werbetexter, Bibliothekar und Lektor. Viele Tätigkeiten um das Buch herum also, bis er sich 1981 als Roman- und Drehbuchautor in Hamburg niederlässt. Göhre lehrt auch das Schreiben und bekam mehrere Literatur- und Krimipreise. Seine Publikationsliste ist beachtlich, am erfolgreichsten waren seine St.-Pauli-Romane, vielleicht deshalb, weil es gerade keine Kiez-Krimis sind. Die meisten seiner Bücher sind in der nicht mehr existierenden rororo Thrillerreihe erschienen. Erschütternd ist, dass sie bis heute vergriffen sind. Die neueren Werke von Göhre (Zappas letzter Hit, Mo, Abwärts) erscheinen im Pendragon Verlag, der es sich verdienstvollerweise auch zur Aufgabe gemacht hat, die früheren Romane von Göhre neu zu verlegen. Göhre ist nicht nur Romanschriftsteller, sondern auch Herausgeber der Werke von Friedrich Glauser und hat 2008 eine fulminante Glauser-Biografie vorlegt: Mo.
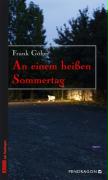 An einem heißen Sommertag, erschienen 2008 bei Pendragon, ist ein Sammelband. Er umfasst zwei frühere Romane von Göhre, die für diese Ausgabe neu überarbeitet wurden: Letzte Station vor Einbruch der Dunkelheit und Schnelles Geld sowie zwei bisher unveröffentlichte Erzählungen: Verrückte Schritte und Keine Chance. Letzte Station vor Einbruch der Dunkelheit ist ein expressionistischer Text, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit spielt, worüber es wenig deutsche Kriminalromane gibt. Die düstere Stimmung auf dem Land, der verdrängte und gleichzeitig omnipräsente Faschismus spitzen sich zu in Fremdenfeindlichkeit gegenüber dem „Reingeschneiten“ und in einer Überreaktion eines ehemaligen Obersturmführers aus Auschwitz, Rolf Sträter. Wie immer bei Göhre, gibt es ein breites Personenpanoptikum und wenig sympathische Menschen. Das durch fast alle seine Romane wandernde Polizistentrio wird hier mit Kriminalkommissar Gottschalk an der Spitze eingeführt. Der sucht den Mörder eines jungen Mädchens, stößt dabei aber auf einen Massenmörder: „Hat zig Juden in die Kammern getrieben, und protzt hier in seiner Villa.“ (S. 107)
An einem heißen Sommertag, erschienen 2008 bei Pendragon, ist ein Sammelband. Er umfasst zwei frühere Romane von Göhre, die für diese Ausgabe neu überarbeitet wurden: Letzte Station vor Einbruch der Dunkelheit und Schnelles Geld sowie zwei bisher unveröffentlichte Erzählungen: Verrückte Schritte und Keine Chance. Letzte Station vor Einbruch der Dunkelheit ist ein expressionistischer Text, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit spielt, worüber es wenig deutsche Kriminalromane gibt. Die düstere Stimmung auf dem Land, der verdrängte und gleichzeitig omnipräsente Faschismus spitzen sich zu in Fremdenfeindlichkeit gegenüber dem „Reingeschneiten“ und in einer Überreaktion eines ehemaligen Obersturmführers aus Auschwitz, Rolf Sträter. Wie immer bei Göhre, gibt es ein breites Personenpanoptikum und wenig sympathische Menschen. Das durch fast alle seine Romane wandernde Polizistentrio wird hier mit Kriminalkommissar Gottschalk an der Spitze eingeführt. Der sucht den Mörder eines jungen Mädchens, stößt dabei aber auf einen Massenmörder: „Hat zig Juden in die Kammern getrieben, und protzt hier in seiner Villa.“ (S. 107)
Schnelles Geld ist geprägt vom gescheiterten Aufbruch der 60er-Jahre, von Subkultur und Rock ’n‘ Roll, von der Ablehnung von Lohnarbeit, nicht aus politischen Gründen, sondern aus Überdruss und dem Bedürfnis, das schnelle Geld zu machen, das mit Autoschiebereien verdient werden soll. Der Roman thematisiert das Erwachsenwerden und die durch den Konformismus verlorenen Hoffnungen auf ein interessantes Leben: „Ist alles weg, murmelte Charly, alles kaputt und tot. Läuft nichts mehr. Noch keine Fünfundzwanzig und schon durch. Mit Otto geh ich kegeln, verstehst du? Kegeln! Und dich treff ich auf ’ner Teenieparty. Okay, frag mich nicht, warum ich hier bin. Weiß ich auch nicht. – Komm, lass uns einen saufen.“ Der Traum vom Alles-in-die-Luft-jagen hat sich in den Traum vom schnellen Geld verwandelt, der selbstverständlich scheitert. Charly, der, wie Göhre einst, einem langweiligen Bibliotheksjob entkommen will, hat am Ende alles verloren.
Die drei Kiezromane Der Schrei des Schmetterlings (1986), Der Tod des Samurai (1989) und Der Tanz des Skorpions (1991) erzählen die Geschichte der Bundesrepublik anhand der Verwobenheit von Politik, Geschäft und Milieu in der Hamburger Sexindustrie. Dokumentarisch, voyeuristisch, schonungslos werden alle Arten von Beziehungen, vor allem die sexuellen, auf Macht und Geschäft reduziert. Guter Sex oder gar Liebe kommt so gut wie nicht vor, und wenn es ein Begehren danach gibt, scheitert es in amerikanischer Noir-Tradition, wir sind schließlich nicht in Frankreich! Im Zentrum der Handlung stehen die Kommissare Broszinski, Gottschalk und Fedder und ihr Gegenspieler, der Kiezkönig Werner „Emma“ Stobbe, der in seiner Freizeit auf Ibiza Marcel Proust liest. Die ersten beiden Polizisten schmeißen ihren Job im Lauf der Trilogie hin. Überhaupt ist von Ausstieg bei Göhre viel die Rede, das Begehren danach groß. Ausstieg aus dem Job, der Beziehung, dem Milieu, der Prostitution. Ein Ausstieg, der aber in den seltensten Fällen gelingt.
Der Aufstieg und die Macht des Kiezkönigs Werner „Emma“ Stobbe stehen paradigmatisch für das bundesrepublikanische Wirtschaftswunder und sein Scheitern. Ein Verbrecher, ein Geschäftsmann mit todsicheren Verbindungen in die große Politik, dem die drei Polizisten kaum gewachsen sind, zumal ihre Vorgesetzten korrupt sind und mit dem Kiezkönig gemeinsame Sache machen. Der Tanz des Skorpions ist fragmentarischer als die anderen beiden Bände, die Sexszenen und Morde sind brutaler und sexistischer. Der Roman liest sich mit seinen Schnitten schon fast wie ein Drehbuch. Die Struktur der Sexindustrie wird wie die alltägliche Polizeiarbeit detailliert geschildert. Im Zentrum des Plots im dritten Band steht der depressive Killer Karl „Zappa“ Weber, dem Göhre ein weiteres Buch gewidmet hat: Zappas letzter Hit. Die Rivalitäten auf dem Kiez laufen noch zwischen den Hamburger und Wiener Loddeln, die Internationalisierung und der Sklavenhandel mit Prostituierten scheinen noch in weiter Ferne zu liegen, Exotik kommt durch eine Italienerin im Stripteaseschuppen auf.
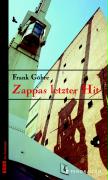 Der 2006 bei Pendragon erschienene Roman Zappas letzter Hit spielt in den Jahren 1996 bis 2002 und nimmt den roten Faden der drei St.–Pauli-Romane wieder auf. Er beginnt mit dem Selbstmord von Killer Zappa und seiner Frau im Gefängnis. Hier geht es neben der unverklärten Beschreibung des Milieus auch um Gentrifizierung und stärker als in den anderen Bänden um die Korruption der Politik. Broszinski ist aus dem Polizeidienst ausgestiegen, weil seine Geliebte Birte verschwand, und unter die Künstler gegangen war. Gottschalk hat ein Gourmetrestaurant eröffnet und möchte mit Hilfe des Partykönigs Smoltschek noch höher hinaus. Nur Jörg Fedder ist seinem Job treu geblieben. Zappas Tochter, davon überzeugt, dass ihr Vater ermordet wurde, geht auf Rachefeldzug.
Der 2006 bei Pendragon erschienene Roman Zappas letzter Hit spielt in den Jahren 1996 bis 2002 und nimmt den roten Faden der drei St.–Pauli-Romane wieder auf. Er beginnt mit dem Selbstmord von Killer Zappa und seiner Frau im Gefängnis. Hier geht es neben der unverklärten Beschreibung des Milieus auch um Gentrifizierung und stärker als in den anderen Bänden um die Korruption der Politik. Broszinski ist aus dem Polizeidienst ausgestiegen, weil seine Geliebte Birte verschwand, und unter die Künstler gegangen war. Gottschalk hat ein Gourmetrestaurant eröffnet und möchte mit Hilfe des Partykönigs Smoltschek noch höher hinaus. Nur Jörg Fedder ist seinem Job treu geblieben. Zappas Tochter, davon überzeugt, dass ihr Vater ermordet wurde, geht auf Rachefeldzug.
Kurios ist, wie Göhre seine Protagonistinnen darstellt. Egal, wie emanzipiert sie im Leben sein mögen (wie z.B. Birte, die investigative Journalistin, oder Angelika Gabers, die Anwältin des Killers), sie werden doch primär durch ihr Aussehen und ihre Sexualität beschrieben. Keine Frau wird geschildert, ohne auf ihre Beine oder ihren Hintern zu verweisen. Krass ist die Darstellung von Evelyn, Fedders Ehefrau und Geliebte von einflussreichen Männern, die auf der Toilette einer Kneipe brutal vergewaltigt wird und am nächsten Morgen Gottschalk bereits wieder mit einem offenen Bademantel, frisch rasierten Beinen, makellos lackierten Fußnägeln und Champagner begrüßt. Sex spielt bei Göhre insgesamt eine zentrale Rolle und beschränkt sich nicht allein auf die Sexualisierung seiner Akteurinnen.
 Abwärts (1984) war ein mit Carl Schenkel verfasstes Drehbuch, das ursprünglich mit vielen Bildern bei Heyne erschien, und ein Kinohit mit Götz George und Wolfgang Kieling. 2006 hat es der Pendragon Verlag neu aufgelegt mit einem zwanzigseitigen Nachwort von Frank Göhre, das die Entstehung und Vermarktung des Films erzählt. Abwärts ist ein Kammerspiel mit vier Leuten im Aufzug, das im Handyzeitalter nicht mehr so stattfinden könnte. Dem abgehalfterten Werbefuzzi Jörg, der auf seine Kosten aufstrebenden Werbetussi Marion, dem jungen Proleten Pit und dem Loser Gössmann, der als Einziger unversehrt aus dem Schlamassel rauskommen wird: „Ein Verletzter, ein Toter und der Fahrstuhl komplett im Arsch.“ (S. 176)
Abwärts (1984) war ein mit Carl Schenkel verfasstes Drehbuch, das ursprünglich mit vielen Bildern bei Heyne erschien, und ein Kinohit mit Götz George und Wolfgang Kieling. 2006 hat es der Pendragon Verlag neu aufgelegt mit einem zwanzigseitigen Nachwort von Frank Göhre, das die Entstehung und Vermarktung des Films erzählt. Abwärts ist ein Kammerspiel mit vier Leuten im Aufzug, das im Handyzeitalter nicht mehr so stattfinden könnte. Dem abgehalfterten Werbefuzzi Jörg, der auf seine Kosten aufstrebenden Werbetussi Marion, dem jungen Proleten Pit und dem Loser Gössmann, der als Einziger unversehrt aus dem Schlamassel rauskommen wird: „Ein Verletzter, ein Toter und der Fahrstuhl komplett im Arsch.“ (S. 176)
 Sein literarisches Können, das in seiner Knappheit und Schnelligkeit in der deutschen Kriminalliteratur einzigartig ist, beweist Göhre im Lebensroman von Friedrich Glauser Mo, einer existentialistischen Biografie, die auch der literarische Krankenbericht eines Außenseiters ist: „Ich hab einen Schmerz in mir, den ich immer und immer wieder betäuben muss, verstehst du?“ (S. 40) Die Biografie besteht aus mehreren Perspektivenwechseln und Literaturformen und liest sich rasant. Göhre schildert die Psychiatrie der Zeit, die Fremdenlegion, die Entmündigung des ersten deutschsprachigen Kriminalautors, des Erfinders von Wachtmeister Studer, des Dadaisten und Anarchisten, und seinen Tod am 8. Dezember 1938 in Italien an seinem 42. Geburtstag. Schöner und trauriger kann die Aktualität Glausers nicht gezeigt werden.
Sein literarisches Können, das in seiner Knappheit und Schnelligkeit in der deutschen Kriminalliteratur einzigartig ist, beweist Göhre im Lebensroman von Friedrich Glauser Mo, einer existentialistischen Biografie, die auch der literarische Krankenbericht eines Außenseiters ist: „Ich hab einen Schmerz in mir, den ich immer und immer wieder betäuben muss, verstehst du?“ (S. 40) Die Biografie besteht aus mehreren Perspektivenwechseln und Literaturformen und liest sich rasant. Göhre schildert die Psychiatrie der Zeit, die Fremdenlegion, die Entmündigung des ersten deutschsprachigen Kriminalautors, des Erfinders von Wachtmeister Studer, des Dadaisten und Anarchisten, und seinen Tod am 8. Dezember 1938 in Italien an seinem 42. Geburtstag. Schöner und trauriger kann die Aktualität Glausers nicht gezeigt werden.
Elfriede Müller
| Zur Homepage des Autors
| Dieser Text ist auf unserer Partner-Seite europolar.eu erschienen











