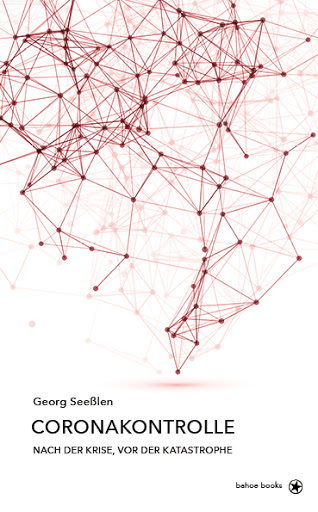
Analyse ohne Illusionen
In unserer August-Ausgabe brachten wir bereits von Georg Seeßlen einen spielverderberischen Einwurf zur Systemrelevanz von Kultur. Jetzt im September erscheint das zugehörige, weiterführende Buch. Es nennt sich Coronakontrolle, oder: Nach der Krise ist vor der Katastrophe und dekliniert den Abschied von den Hoffnungen auf eine bessere Post-Krisen-Welt. Diese Hoffnungen gab es zu Beginn der Pandemie: Die Krise würde zu mehr Einsicht in die Notwendigkeit gesellschaftlich-solidarischer Einrichtungen führen, zu mehr Wertschätzung für Ärzte und Pflegepersonal, zu mehr Solidarität in den Bevölkerungen. Als kleines Nebenprodukt würde sie die Frage erlauben, ob der Kapitalismus in seiner aktuellen Form wirklich die beste Weltordnung liefere, sie würde Autokraten enttarnen, den Populismus überflüssig machen, die Wertschätzung für Kultur und Kritik wieder beleben, soziales Verantwortungsgefühl und ein Bewusstsein für den Kampf gegen die Umweltzerstörung erzeugen … Kurz: Die Krise wäre zugleich mit den Gefahren vielleicht auch eine Geburtshilfe für neue Chancen. Aber Pustekuchen. Ganz im Dienste des «Systems» sollen die Verlierer vermutlich weitere Verluste in Kauf nehmen – noch aber sind die Chancen, die für Kritik und Widerstand in einer Krise stecken, nicht endgültig vertan. Deswegen unternimmt Seeßlen eine Analyse, die sich keine Illusionen macht, aber auf «tätige Hoffnung» (Bloch) nicht verzichtet. Hier ein Textauszug:

Als Präsident Trump, scherzend wie es so seine Art ist, darauf verwies, er fühle sich mit einer Mund- und Nasenmaske zum Schutz gegen die Übertragung des Coronavirus «wie der Lone Ranger», da war dem Popkultur-Nerd klar: Davon versteht er also auch nichts. Denn bekanntlich – ähem! – trägt der Lone Ranger eine Augenmaske, die genau das offen lässt, was eine Coronamaske bedeckt, sodass die Frage durchaus berechtigt ist, wer zum Teufel in dieser Aufmachung John Reid nicht erkennen würde. Einer der Helden, die mit ihrer Maske gelegentlich auch die untere Gesichtshälfte verbergen, ist der Zorro, der aber wohl wegen seiner hispanischen Kultur für einen Trump-Scherz nicht infrage kommt.
Masken also. Stets scheinen sie neben einer praktischen auch eine symbolische Bedeutung zu haben, und das macht sie ein wenig unheimlich. Sie verbergen etwas, eine «Identität»; sie stehen in mysteriöser Verbindung mit Tod, Verrat und Revolte. Sie sind Teil einer «Verkleidung», also einer unklaren Persönlichkeitsbeziehung; irgendwie überschreiten Masken den Bereich, den wir «Wirklichkeit» nennen. Sie sind Theater, Ritus, Magie. Darum ist das Tragen von Masken auch strengen Regelungen unterworfen. Wer wann wie und warum eine Maske tragen muss, soll oder darf, das muss von Gesetzen und Diskursen festgelegt werden, wo kämen wir sonst hin. Wenn jede und jeder zu jeder Zeit eine Maske tragen könnte, wäre es aus mit Ordnung und Kontrolle. Genau deshalb sind Masken auch ein großes Faszinosum.
Dient die Maske dem Schutz. Zahnärzte, Punktschweißer, Chemielaboranten, Viehtreiber und Motorradrennfahrerinnen können ihre jeweiligen Geschichten dazu erzählen. Die Maske dient zunächst dem eigenen Schutz. Die bizarren Schnabelmasken der Pestärzte des späten Mittelalters spuken noch durch surrealistische Träume. Aber schon die OP-Maske des Chirurgen bedeutet auch eine Umkehr der Schutzfunktion. Es ist ein großer zivilisatorischer und gesellschaftlicher Fortschritt, dass wir Masken auch überziehen können, nicht um uns vor den Mitmenschen, sondern im Gegenteil unsere Mitmenschen vor uns zu schützen. Es soll, fern im Osten, Gesellschaften geben, in denen ein solches Verhalten auch bei weniger desaströsen Erkrankungen Teil des normalen Verhaltenscodes ist. Umgekehrt gibt es in den Gesellschaften des Westens nicht wenige Menschen, denen eine solche Rücksichtnahme als «Eingriff in die persönliche Freiheit» gilt. Aber vielleicht hat die Aversion ge- gen die Maske auch noch tiefere Ursachen?
1. Nämlich dient die Maske dem Verbergen. Nicht nur einsame Rächer tragen sie, sondern auch Banditen, Raubmörder, Mitglieder von verbotenen Organisationen und Geheimgesellschaften oder Teilnehmer mehr oder weniger wilder Orgien. Im Karneval und beim Maskenball wird das auch für normale Menschen für eine Zeit möglich, natürlich in «netter Form». Aber auch hier schleicht Verrat und Mord an jeder Ecke. Die Pest, wir erinnern uns an die «Maske des roten Todes», nutzt diesen Tanz der Anonymisierungen und der verbotenen Lüste.
2. Ist die Maske ein theatralischer Ausdruck? Das was in Alltag, Arbeit und Politik verborgen bleiben muss, die Wünsche und Hoffnungen, natürlich auch Ängste und Projektionen, finden in der Maske einen Ausdruck. Mit der Maske beginnt das ganze Theater. Schicksal, Struktur und «Persona» finden eine neue Sprache. Die Maske sagt, so oder so, dass der Mensch nicht genau das ist, was er ist, und nicht alles ist, was er ist (um die Worte eines berühmten Matrosen zu zitieren). Es ist schließlich:
3. Die Maske eine Form der Transzendenz. In der Maske tritt man in Unter- und Überwelt ein, tanzt mit den Dämonen, lässt Jenseitiges in sich ein. An- und Ablegen der Maske ist ein ritueller Übergang.
4. Aber kann die Maske auch als eine Form der Bestrafung, der entwürdigenden öffentlichen Darstellung dienen. So mag der Mensch gänzlich in ihr gefangen sein, wie es der «Mann in der eisernen Maske» war, oder die armen Frauen in den Hexenmasken. Dem Spott preisgegeben wie der dumme Schüler mit der Eselsmaske. Die Maske ist ein wichtiges Instrument der Karikatur und der Satire. Im Maskenspiel sollen die politischen Verhältnisse und ihre Protagonisten zur Kenntlichkeit verzerrt werden.
5. Die Maske ist ein Kunstwerk. Oder wenigstens kann sie Teil der Mode werden. Darin versucht sie listenreich ihre eigene Bestimmung zu unterwandern, und statt zu verbergen, drückt sie das Verborgene nur noch stärker aus. Immerhin im kleinen versuchen viele Menschen aus einer «Coronamaske», die als notwendig akzeptiert wird, ein «Accessoire» zu machen, mit dem man sich darstellen und unterscheiden kann.
6. Eine Maske ist eine Drohung, nicht nur im Bereich des Sportlichen und des Militärischen. Als Signal löst sie Alarm und Furcht aus, beginnend mit einer «Kriegsbemalung». Die Maskenbehelmung macht aus Clonkriegern oder Einsatzpolizisten lebende Waffen.
7. Allgemein erscheint «Maskenhaftigkeit» als etwas Verstörendes. Menschen, die ihr Gesicht zu einer Verweigerung der Gefühle oder zu einer Verleugnung des sozialen Status disziplinieren, im Pokerface oder in der Grinsemaske des Medienpolitikers.
8. Maskiert muss schließlich das Defekte und Feh- lende werden, die Fassade wird zur potemkin’schen Maske, und auch ein menschlicher Körper kann durch Teil-Maskie- rungen prophetisch verwandelt werden. Kosmetische Chirurgie lässt am Ende auch menschliches Fleisch als Maske zu; in den Visionen des «Posthumanismus» verschwinden die Grenzen zwischen Mensch und Maske. Der Mensch der Zukunft wird lernen müssen, sich in seinen Masken zu Hause zu fühlen.
9. Die Maske bezeichnet die Prekarität des Atmens (und damit des Lebens). Sie verlangt ein anderes Atmen, sie zeigt, wie gefährdet das Atmen ist, und sie macht einen unbewussten körperlichen Vorgang bewusst. Unter Wasser und im Weltraum wird dieser Vorgang der Maskenatmung besonders dramatisch, weshalb wir in der Tat auch Ge- schichten um entsprechende Gefährdungen voller Angstlust goutieren. Es ist die «Atemnot», die auf höchst sonderbare Weise die beiden Leitthemen des Sommers 2020 miteinander verbindet, die Maskenpflicht in der Krise und die wahrhaft erstickende rassistische Gewalt der Polizei. Die Angst vor dem Ersticken aber setzt sich auch in die ökologischen Katastrophenszenarien fort. In einer vergifteten Luft können Menschen nur noch mit Masken überleben in den Science Fiction Phantasien, die «in naher Zukunft» spielen. Mit den Masken würden sich Gesellschaften zur allgemeinen Erstickungsangst bekennen.
10. Ist die Maske auch ein Bekenntnis, nicht nur zum Micky Maus-Club oder zur Fast-Food-Kette. Durch Masken kann man sich distanzieren oder solidarisieren. Die Maske wird politisiert.
Und damit sind wir wieder in der Gegenwart der Pandemie und der prekären sozialen Maßnahmen gegen sie. Verlangt wird die Maske nun nicht nur als praktischer Schutz, sondern auch als Zeichen einer mitmenschlichen Fürsorge. Eine Gesellschaft, die auf kritische Vernunft und humanistische Liberalität bezogen sein will, würde diese Maske «anstandslos» akzeptieren, doch dieser Bezug ist längst nicht mehr selbstverständlich. Auf der einen Seite entwickelte sich eine Form der «phobischen Reaktion» gegen das Maskentragen. Dürfen wir vermuten, dass diese nicht so sehr mit der etwas grotesken Analogie zum «Maulkorb» sondern vor allem mit den erwähnten Mehrdeutigkeiten der Maske zu tun hat? Also z.B. mit dem Subjektverständnis des Neoliberalismus? Auf der anderen Seite wird die Maske von den üblichen Verdächtigen der Post- und Antidemokratie politisiert. Wer Maske trägt, ist ein demokratisches Weichei, und wer Maske tragen muss, soll auf jeden Fall daraufhinweisen, dass diese Maske keineswegs Teil seiner Überzeugungen oder gar seiner politischen Persönlichkeit ist. Der Verzicht auf die Maske wird zum heroischen maskulinen Widerstand stilisiert, Maskenträger sind so etwas wie «Gutmenschen». Die soziale Zärtlichkeit, die sich im Maskentragen ausdrückt, ist dem rechten Maskenphobiker schon zu viel. Was dem liberalen Humanisten eine kleine Hoffnung ist, das ist ihm das Gräuel: Dass er durch die Maske ein klein wenig zu einem anderen Menschen werden könnte.
Textauszug aus: Georg Seeßlen: Coronakontrolle, oder: Nach der Krise ist vor der Katastrophe. Die Post-Corona-Gesellschaft und was sie uns über die Zukunft erzählt. bahoe books, Wien 2020. 180 Seiten, 15 Euro. Erscheinungstermin: 10. September 2020.











