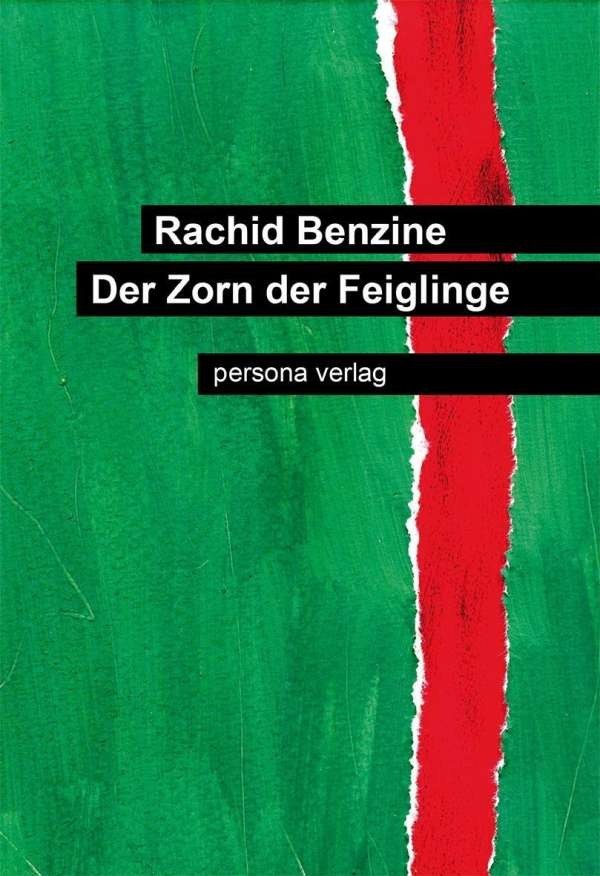
Multikulturelle Wahrheiten
Vor fünf Jahren haben zwei maskierte Männer, die ihresgleichen als Helden betrachten, in der Redaktion des Satireblatts Charlie Hebdo elf Menschen getötet. Vor fünf Jahren wanderten knapp 900 000 Flüchtlinge von Budapest Richtung Westen, der einstige Oppositionelle Victor Orban hatte gedroht, mit Waffengewalt gegen sie vorzugehen (wird ja oft vergessen, wenn von Merkels „Einladung“ die Rede ist). Tausende hilfsbereiter deutscher und, ja, auch österreichischer Bürger konnten sich nicht vorstellen, dass diese Willkommenskultur binnen weniger Jahre als Auslöser für neuen Rechtsradikalismus gelten würde.
Im Jahr 2015 siedelt Rachid Benzine auch den Briefwechsel zwischen dem vernünftigen, forschenden, der Aufklärung und Weltverbesserung verpflichteten Vater und seiner zu Islamisten in den Irak entlaufenen Tochter an. Das Buch Zorn der Feiglinge ist in dem kleinen mutigen persona-Verlag erschienen. Benzine berichtet, weit über die Auseinandersetzung zwischen dem wissenschaftlich argumentierenden Koranforscher und der fanatisch gewordenen islamistischen Tochter, wie Argumente von den Füßen auf den Kopf gestellt werden.
Der Vater hat die Tochter nach dem frühen Tod der Mutter alleine und im Geist kritischen Denkens erzogen, er liebt sie, er fleht sie an, zurückzukommen, er fragt sich und sein kluges, gebildetes Mädchen, wieso junge Männer und Frauen in ein Land ziehen, in dem Krieg herrscht und im Namen Gottes töten.
Der sogenannt islamische Staat ist in den Hintergrund gerückt, aber auch in neuen Kontexten ist die Frage aktuell, wie anfällig unsere Gewissheiten, wie beschränkt unsere Vernunft und wie schwer zu erreichen Menschen sind, die noch vor kurzem nahe Verwandte oder Freunde waren. Die Tochter beruft sich auf jene Prinzipien, die der Vater ihr beigebracht habe – Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube. Sie interpretiert sie nur anders. Ihr Weg zu den islamistischen Kämpfern ist ihre Emanzipation, sie engagiert sich „für die Beseitigung einer Sklaverei“, es geht um Befreiung, sie erlebt Mut und Solidarität und habe begriffen, wie nutzlos ihr früheres Leben war. „Du glaubtest, mich zur Freiheit zu erziehen, aber Du hast nur das Joch weitergereicht, unter dem Du selber gefangen bist.“ Ihre Briefe kommen auf komplizierten Wegen aus Falludscha, der Vater lebt irgendwo im Maghreb, wo genau wird nicht erwähnt, aber es ist ein arabischer Staat, er ist ein gläubiger Muslim, der den Koran genau kennt und versucht, die Tochter mit Worten zu erreichen, pendelnd zwischen Verzweiflung und seinen Überzeugungen.
Umgedreht werden nicht nur die Argumente, auch die Menschen. Der Vater wird wegen „Apostasie“ angeklagt und gefoltert, sein einstiger Lieblingsschüler – nun ein fanatischer Imam – schlägt ihn zusammen und er landet im Krankenhaus. Benzine plädiert hier für ein besseres Verständnis des Islam. „Unsere Aufgabe als Menschen ist es nicht, Antworten zu finden, sondern zu suchen. Von den Muslimen wird erwartet, dass sie bescheidene Sucher sind und keine Esel, die fortwährend die haarsträubendsten Geschichten herauswiehern.“ Für ihn gibt es nur eine Identität – die menschliche. Ihre Realität ist eine andere, sie spricht von den Toten, die amerikanische Bomben hinterlassen, von den durch „Deine Yankeefreunde“ zerstörten Moscheen … und kritisiert seine „satten Gewissheiten“. Da gibt es, vorerst, keine Brücken. Wie die Geschichte ausgeht sei hier nicht erwähnt.
Es ist auch ein Buch für zunehmend in die Defensive geratende altmodische Rationalisten. Weit über den islamistischen Kontext hinaus führt Benzine in diesem fiktiven Briefwechsel vor, wie Argumente und auch nahe Menschen, die man zu kennen glaubt, umgedreht werden. Ein „anders“ interpretiertes Verständnis von Freiheit, Liebe und Solidarität, das gute Gefühl von Brüdern und Schwestern, die gemeinsam kämpfen, der Vorwurf an das „leere Intellektuellengeschwätz“ oder die Erfahrung von erfülltem Leben werden im Brustton verschiedenster Überzeugungen „ins Feld“ geführt. Die Beispiele sind auf viele „Bewegungen“ anwendbar, auch im Land von gebildeten, von ihrer Wahrheit überzeugten Querdenkern, Verschwörungsglaubenden, Fanatikern oder Esoterikern aller Couleur, die sich von Fakten und vernünftigen Argumenten nicht verunsichern lassen.
Rachid Benzine: Der Zorn der Feiglinge (Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir?, 2016). Roman in Briefen. Aus dem Französischen von Regina Keil-Sagawe. Persona verlag, Mannheim 2017. 96 Seiten, Hardcover, 17,50 Euro.











