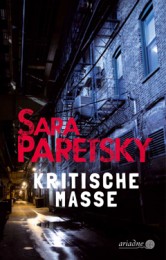 „Das war ein irrer weltweiter Rüstungswettlauf“
„Das war ein irrer weltweiter Rüstungswettlauf“
Kapitel 9
Der Schatten des dünnen Mannes
In meinem Traum spielte Jake Bass für den König von Schweden, der sagte, er würde in den Todeslagern verschwinden, wenn er ihm bis zum Morgen keine neue Küche gebaut hätte. »Lass den Kopf in den Wolken«, schrie der König, »oder ich hacke ihn ab!«
Ich verbrachte eine anstrengende Nacht, kämpfte mit dem König, versteckte Jakes Bass, ging in den Wolken verloren. Als ich am Morgen aufstand, war ich fast genauso müde wie beim Zubettgehen. Ich lief eine große Runde, allein, ohne die Hunde, um den Kopf frei zu kriegen.
Jakes Reaktion auf meine arme gerettete Rottweilerin ging mir zwar gegen den Strich, aber sie traf des Pudels Kern. Es war schon haarig, sich um zwei große Hunde kümmern zu müssen, selbst mit Mr. Contreras’ Hilfe. Ich hatte kaum je genug Zeit, auf die meditative Art zu laufen, die mir guttut. Ein dritter Hund würde das vollends unmöglich machen.
Beim Duschen entwarf ich das Programm für den Tag. Martins Freund Toby Susskind aufspüren. Bibliotheksrecherchen über Nobelpreisträger: Martin Binder jagte womöglich seiner mutmaßlichen Familie nach. Zur Abrundung dieser Lustbarkeiten würde ich bei meinem Kumpel vom Pflichtver- teidigerbüro nachhaken, ob er Bekannte meines toten Methkochers ausgegraben hatte.
Es wäre leichter gewesen, Toby zu finden, wenn ich seine Handynummer gehabt hätte, aber schließlich ermittelte ich, dass er am Rochester Institute of Technology studierte. Die Verwaltung rückte seine Nummer nicht heraus, wohl aber seine Uni-Mailadresse, denn die galt als mehr oder weniger öffentlich. Während ich darauf wartete, dass er auf meine E-Mail ant- wortete, knöpfte ich mir die Nobelpreisträger zwischen 1920 und Ende der Dreißiger vor.
Eine Liste war schnell gefunden, doch die Recherche erwies sich als weniger simpel, als ich mir vorgestellt hatte. Man musste persönlich zur wissenschaftlichen Bibliothek der University of Chicago, um Zugriff auf ihr Archiv zu erhalten. Ich ging davon aus, dass ich binnen einer Stunde wieder draußen sein würde. Das war nicht mein größter Irrtum an diesem Tag, nur der erste.
Ich musste tief eintauchen, aber dann fand ich eine Erwähnung von Martina Saginor in einer Abhandlung – auf Deutsch – über Frauen am Wiener Institut für Radiumforschung. Ich wollte nicht abwarten, bis Max oder Lotty dazu kamen, mir die Abhandlung zu übersetzen, also trug ich mein Laptop mit der kopierten Datei zum Auskunftsschalter, wo sie einen jungen Mann herbeiriefen, der Deutsch lesen konnte. Mit seiner drahtgerahmten Brille und dem weißen Hemd unter einem Pullunder erinnerte er mich an William Henry, den jungen Möchtegernkriminalisten aus Der dünne Mann.
Er stellte sich als Arthur Harriman vor, ich mich als V. I. Warshawski. Als ich ausführte, dass ich Detektivin und bemüht sei, mit der Machete durch das Dickicht von rund siebzig Jahren zur Fährte einer toten Physikerin vorzustoßen, wurde Harriman noch mehr zu William Henry. »Wir jagen eine verschwundene Person? War sie eine deutsche Spionin? Muss ich wissen, wie man mit einer Kanone umgeht?«
»Sie müssen nur Deutsch lesen können, denn das kann ich nicht.« Ich reichte ihm mein Laptop mit der deutschen Abhandlung auf dem Bildschirm.
»Das klingt interessant«, sagte Harriman, als er sich durch einen Teil des Textes gescrollt hatte. »Es geht um das Wiener Institut für Radiumforschung, das IRF. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Atoms wollte Wien mit Paris und Cambridge und Kopenhagen konkurrieren. Bemerkenswert ist, dass die Forschungsabteilung dort zu vierzig Prozent aus Frauen bestand, im Vergleich dazu gab es in den USA praktisch gar keine, genau wie im Rest von Europa – das schließt sogar das Labor von Irène Curie mit ein, obwohl sie relativ oft Frauen eingestellt hat.«
Er scrollte weiter, bis er zu Saginor kam. »Ihre Lady hat von 1926 bis 1936 an der Technischen Hochschule für Mädchen Chemie und Mathematik gelehrt. Zwischendurch ging sie nach Deutschland, nach Göttingen, um ihren Doktor in Physik zu machen, anschließend wurde sie Forscherin am IRF. In Göttingen hat Heisenberg eine Algebra der Quantenmechanik entwickelt, alle Physiker kamen zur einen oder anderen Zeit dorthin. Oppenheimer, Fermi, einfach alle.«
»Steht da irgendetwas über Saginors Privatleben?«, fragte ich. »Hatte sie Kinder, einen Ehemann, ist von so was die Rede?«
Er las weiter bis zum Ende der Abhandlung. »Nichts über ihr Privatleben. Als Deutschland Österreich annektiert und die Rassegesetze der Nazis eingeführt hat, verlor Saginor ihren Lehrauftrag, aber das IRF hat aus irgendeinem Grund sein jüdi- sches Personal nicht sofort entlassen. Warum ist unklar. 1941 wurde Saginor dann zum Uranverein abgestellt.«
»Was ist das?«
Harriman klickte sich durch ein paar Links. Ich wartete, während er weitere Dokumente überflog, seine Lippen bewegten sich, als er stumm übersetzte.
»Es nannte sich Uranverein, aber es waren mehrere Forschungseinrichtungen, in denen Deutschland versuchte, die physikalischen und technischen Voraussetzungen für den Bau einer Atombombe zu entwickeln. Es gab sechs Labore des Uranvereins in Deutschland und eins in Österreich. Ihre Lady wurde in das in den österreichischen Alpen geschickt.«
Er las weiter, immer noch vor sich hin murmelnd. »Also: 1942, als es an der Ostfront schlecht lief, ging Deutschland das Geld für seine Bombenprojekte aus. Zudem hat Hitler nie wirklich geglaubt, dass die Spaltung des Atoms möglich ist. Das zeigt, wieso es ein Fehler ist, wenn man die Forschung von einem Diktator diktieren lässt.« Er grinste über sein kleines Wortspiel, wurde aber schnell wieder ernst. »So leid es mir tut, man hat Saginor 1943 deportiert, als die Anlage in Österreich stillgelegt wurde. Saginor wurde nach Theresienstadt geschickt, dann auf einen Zwangsmarsch weiter nach Osten, wahrscheinlich zum Vernichtungslager Sobibor. Sie muss unterwegs gestorben sein, denn das ist der letzte Eintrag über sie.«
Ich kniff die Augen zu und versuchte das Bild einer zerlumpten, im Schnee sterbenden Frau zu vertreiben. »Heißt das, bevor sie starb, war sie an einem deutschen Äquivalent zum Manhattan-Projekt beteiligt?«, fragte ich. »Ich wusste gar nicht, dass es so was gab.«
»Oh doch, und ob. Das war ein irrer weltweiter Rüstungswettlauf«, sagte Harriman fröhlich.
»Aber – hat sie denn in Wien an diesem IRF auch an Waffen gearbeitet?«
»Nein, nein.« Er setzte mein Laptop ab. »Es ging ihr wie praktisch allen Physikern in den Dreißigern: Sie versuchte die Architektur des Atoms zu verstehen. In der Abhandlung über die Frauen am Institut für Radiumforschung kommt eine ihrer Mitarbeiterinnen zu Wort, die sagt, Saginor war mit Leib und Seele Forscherin.«
Er sah wieder auf den Bildschirm und klickte zurück zum ersten Artikel. »Sie kam nach ihrer Arbeit in der Hochschule immer noch ins Institut und führte Experimente durch. Die Frau, die in dem Artikel zitiert wird, sagt, Saginor schien nie etwas zu essen – es gab im Gemeinschaftsraum Kaffee und Kuchen, aber Martina hielt es kaum aus, ihr Labor zu verlassen. Die zitierte Frau meint, Martinas Hauptinteresse galt der Interaktion von Neutronen mit schweren Nukliden, aber die Forschungsfelder von Physikern, Chemikern und Geologen der Dreißigerjahre überschnitten sich ständig.«
Er tippte auf den Bildschirm. »Es ist schon klar, warum sie sie zum Uranverein holten, wenn auch nur als Zwangsarbeite- rin. Saginor war wahrscheinlich eine der Ersten, die an Kernspaltung glaubten. Sie scheint schon 1937 mit verschiedenen Materialien experimentiert zu haben, um eine Methode zu entwickeln, den Resonanzquerschnitt von Uran und Thorium ohne allzu viele Störgeräusche zu erfassen.«
Ich versuchte verständig zu nicken, aber innerlich stöhnte ich auf. Warum hatte ich in Professor Wrights Vorlesungen nicht besser aufgepasst, als ich hier mein Grundstudium absolvierte?
Ich brachte Harriman dazu aufzuschreiben, was er mir referiert hatte, und es mir als E-Mail zu schicken. Als er das sehr zuvorkommend erledigt hatte, fragte ich ihn nach Nobelpreisträgern, die Martina Saginor getroffen haben könnte, entweder in Wien oder in Göttingen. »Es müsste jemand sein, der um 1955 in Chicago war, denn Martinas Tochter kam her, um nach ihm zu suchen.«
Auch dies erwies sich als eher komplizierte Recherche. Physiker in den Dreißigern waren die reinsten Wandervögel, flatterten von Kopenhagen nach Cambridge, von Kalifornien nach Kolumbien, mit Zwischenstation in Göttingen oder Berlin und Paris.
Wir gingen die Liste der Nobelpreisträger in Physik und Che- mie von den Zwanzigern bis 1950 durch. Jede Menge Preisträger konnten in Deutschland oder in Wien gewesen sein, als Kitty Binder zur Welt kam. Die meisten der Europäer unter ihnen waren während des Krieges nach England oder in die USA geflüchtet, Harriman sagte, jeder davon könnte eine Weile in Chicago gelebt haben. Einige, wie Fermi, traten dem Fachbereich der Universität von Chicago bei. Andere arbeiteten hier am Manhattan-Projekt oder hatten Kurzauftritte als Gastdozenten.
»Chicago war nach dem Zweiten Weltkrieg der absolute Hot Spot für Physiker. Fermi, Teller, sie zogen die nächste Generation von Wunderkindern an. Spielt die Nationalität eine Rolle?«
Ich schüttelte den Kopf. »Saginor bekam ihr Baby 1930 oder ’31, also ist der Vater jemand, dem sie zwischen ’29 und ’30 ent- weder in Wien oder in Deutschland begegnet ist. Nach dem, was Sie gesagt haben, könnte es von Werner Heisenberg bis Robert Oppenheimer jeder sein.«
»Schon«, sagte Harriman, »aber Heisenberg war nach dem Krieg nicht hier, es ist also kein ganz so weites Feld.«
Meine heimliche Sorge behielt ich für mich: Kittys Fantasien über ihren Vater konnten auch heißen, dass er gar kein Wis- senschaftler gewesen war, geschweige denn Nobelpreisträger. Es mochte wirklich ein Wiener Handwerker gewesen sein, der bereits eine Frau und zwei Kinder hatte. Der Schnappschuss auf Kittys Anrichte zeigte vielleicht einen Strandtag, an dem seine Gattin die Tochter seines Liebchens großzügig hatte teilnehmen lassen.
Harriman gab mir mein Laptop zurück. Ich schloss die Fenster, die er geöffnet hatte, da sah ich die Fotografie. In der Mitte eines der deutschen Zeitungsartikel, die Harriman ausgegraben hatte, prangte das Bild, das ich im Meth-Haus gefunden hatte: das riesige Metall-Ei auf dem Dreifuß mit feierlichen Männern und Frauen, die stolz in die Kamera schauten.
»Was ist das hier? Wer sind diese Leute?«
Harriman starrte mich verwundert an, weil meine Stimme so belegt klang, aber er nahm mir den Computer wieder ab. »Ein früher Teilchenbeschleuniger, der am Institut für Radiumforschung entwickelt wurde. Was ist daran so aufregend?«
»Ich habe kürzlich einen Abzug von diesem Bild gesehen, und zwar an einem Ort, wo ich jede Wette eingehe, dass dort niemand je von einem Teilchenbeschleuniger gehört hat, geschweige sich dafür interessiert. Wer sind die Leute da?«
»Es gibt keine Bildunterschrift«, sagte Harriman, »aber die waren alle am IRF. Ich nehme an, Ihre Martina ist eine von den Frauen, das sollte nicht allzu schwer herauszufinden sein. Der zweite Mann von rechts, sein Gesicht kenne ich. Ich glaube, ich hab es in unseren Archiven gesehen.«
Er sah auf die Uhr an der Wand. »Ich muss gleich zu einem Treffen, aber ich kann nach dem Mittagessen noch ein bisschen rumstöbern. Wenn Sie mich schon keine Kanone tragen lassen, kann ich vielleicht diese Leute aufspüren.«
Ich dankte ihm überschwänglich: Es war eine Erleichterung, wenigstens eine Aufgabe delegieren zu können. Während er in den Innereien der Bibliothek verschwand, suchte ich mir eine freie Lesekabine und setzte mich, um meine Mails zu checken.
Jari Liu hatte zurückgeschrieben, dies sei die einzige Mailadresse, die er von Martin hatte. Er hatte dieselbe Fehlermeldung erhalten.
Martins Freund Toby Susskind hatte geantwortet. Er wusste nicht, wo Martin war, aber er hatte seine Handynummer dazu- geschrieben. Als ich anrief, erklärte Toby mir stockend und unsicher, warum er und Martin keinen Kontakt mehr hatten.
»Martin wollte aufs College, aber seine Großmutter, sie war so dagegen, dass er am Ende in Chicago blieb und sich einen Job suchte. Ich selbst hätte es wahrscheinlich nie nach Rochester geschafft, wenn Martin mir nicht mit dem Oberstufenprojekt geholfen hätte, und, na ja, das machte alles irgendwie schwierig, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Ich murmelte etwas Mitfühlendes. Ich konnte mir Martins Kummer und Tobys Verlegenheit vorstellen, viel Spannung in einer Beziehung, die von Anfang an nicht sehr vertraut gewesen war. Ich fragte Toby, ob er wüsste, wer das Grillfest im August veranstaltet hatte. »Ich muss mit jemandem reden, der mit Martin gesprochen hat, ehe er verschwand«, erklärte ich, aber Toby sagte, Martin und er hätten sich diesen Sommer kaum gesehen und überhaupt hätte Martin nie etwas von sei- nen Kollegen erzählt.
»Was hat Martin denn von Besuchen bei seiner Mutter erzählt?«, fragte ich.
»So was hat er nie erwähnt. Natürlich wusste jeder, dass sie eine Drogensüchtige ist. Manche Kids haben Martin deswegen ziemlich übel zugesetzt, wenn er also los ist, um sie zu treffen, hätte er das wohl für sich behalten.«
Martin hatte offenbar früh gelernt, sich abzuschirmen. Vielleicht war sein Großvater der Einzige, der wirklich zu ihm durchgedrungen war. Ich dachte an das Grinsen der beiden, als Martin beim Science Fair den ersten Platz gemacht hatte.
Toby war nervös: Er musste zu einem Seminar, er musste noch jemanden zurückrufen, er konnte mir wirklich nichts weiter sagen. Er hatte keine Handynummer von Martin. Aber Ms. Hahne, die an der Highschool Physik auf College-Niveau unterrichtete, könnte vielleicht Martins Pläne kennen; Toby glaubte, dass Martin ihr nahestand.
Nadja Hahne war im Unterricht. Die Frau im Sekretariat nahm eine Nachricht entgegen und versprach, sie der Lehrerin zukommen zu lassen. Während ich in einem der kleinen Cafés in Uninähe ein Sandwich und einen überraschend guten Cap- puccino zu mir nahm, schickte mir mein alter Freund Stefan Klevic eine E-Mail: Er hatte die Cook County-Akte von Ricky Schlafly aufgetrieben und für mich gescannt.
Ich las sie und versuchte, kein Hummus auf meine Tastatur zu schmieren. Schlafly war ein paarmal festgenommen wor- den, Drogenbesitz, Dealen und Einbruch. Er war an einem verpfuschten bewaffneten Raubüberfall auf einen Spätkauf beteiligt gewesen. Niemand wurde ernstlich verletzt, aber er hatte sich fünf Jahre in Stateville eingebrockt.
Schlaflys letzte bekannte Adresse in Chicago war in Austin, am äußersten Ende der heruntergekommenen West Side. Der Mietvertrag lief auf einen Mann namens Freddie Walker.
Stefan schloss seine Mail mit den Worten: »Walker hat keine Akte, aber in Oak Park und Chicago PD heißt es übereinstim- mend, er ist die treibende Kraft hinter einem Haufen Koks, der in diesem Teil der Stadt in Umlauf ist. Du weißt jetzt alles, was ich weiß, und falls du vorhast, ihm einen Besuch abzustatten, solltest du dein bestes Sonntags-Kevlar anlegen.«
Ich tat noch mehr: Nicht nur fuhr ich zu Hause vorbei, um mir eine Weste und meine Waffe zu holen, ich kündigte meine Expedition auch einem Bekannten bei der Chicagoer Polizei an, auch wenn Conrad Rawlings’ Bezirk im Südosten, wo ich auf- gewachsen war, auf der anderen Seite des Stadtplans lag.
In ferner, nebliger Vergangenheit waren wir mal ein Paar gewesen. Unsere Trennung war nicht harmonisch verlaufen, besonders weil er sich dabei eine Kugel einfing, aber in einem gut versteckten Winkel seines Herzens bedeutet es Conrad noch etwas, ob ich lebe oder sterbe.
»Ich hoffe, du stellst dir nicht vor, dass ich dich in ein Meth-Haus eskortiere, Ms. W. Wenn du auf die Art von Kick aus bist, kannst du jederzeit nachmittags in meinem Revier vorbeikommen.«
»Ich würde nicht im Traum daran denken, dich von den Latin Cobras und euren anderen Gangs abzuziehen, Conrad. Ich dachte nur, vielleicht lässt du einen deiner Kumpels in der Fifteenth wissen, dass ich komme, damit sie mich nicht verhaften, wenn sie mich diese Adresse an der Lorel betreten sehen. Außerdem möchte ich, dass sich jemand um meine Hunde kümmert, falls ich nicht zurückkehre.«
»Ich kann dir die rührseligste Grabrede halten, die du je gehört hast, aber diese verdammten Hunde nehme ich nicht. Der Rüde, wie heißt er noch? Mitch? Er ist meiner Männlichkeit viel zu oft viel zu nahe gekommen. Worum geht es hier wirklich, Vic?«
Ich berichtete ihm von Derrick Schlaflys Tod und Judys Hilferuf. »Ich versuche rauszukriegen, wo sie hin ist, als sie Lotty nicht erreicht hat.«
Ich hörte, wie Conrad auf einer Tastatur tippte. »Vermisste Person, Mordfall im Drogenmilieu. Wage es ja nicht, in diese Wohnung zu gehen, Warshawski. Ich schicke gerade eine Nachricht an Frettchen Downey, er soll sich einen Durchsuchungs- beschluss holen und den Laden überprüfen. Du hältst dich da fern. Dafür zahlen sie uns Bullen schließlich das große Geld. Hast du kapiert?«
»Aye, aye, Sergeant«, sagte ich.
»Sei nicht neunmalklug, Vic. Das steht dir in deinem Alter nicht mehr. Wenn ich rausfinde, dass du auf eigene Faust da rein bist, erschieße ich dich persönlich.«
 Auszug mit freundlicher Erlaubnis von Autorin und Verlag aus:
Auszug mit freundlicher Erlaubnis von Autorin und Verlag aus:
Sara Paretsky: Kritische Masse (Critical Mass, 2013). Deutsch von Laudan & Szelinski. Ariadne im Argument Verlag, Hamburg 2013. Hardcover, 540 Seiten, 24 Euro. Verlagsinformationen.
Als eBook Longplayer bei CulturBooks, 19,99 Euro.
Marcus Müntefering bei Spiegel Online über das Buch.
Sara Paretskys Blog.
Sara Paretsky bei CrimeMag:
Ein Nachruf auf Sue Grafton
Neither Vamp nor Victim: Wie sie ihre Ermittlerinnen-Figur fand.
„Kritische Masse“ beginnt mit einem kleinen Gefallen für eine gute Freundin, führt in einen Drogenhaus außerhalb von Chicago, und dann bald schon sehr viel weiter. V. I. Warshawski, Sara Paretskys Privatdetektivin – endlich wieder in Deutschland aufgelegt und übersetzt – taucht hier tief in die Vergangenheit. Einer der Erzählstränge orientiert sich an der wahren Geschichte der österreichischen Physikerin Marietta Blau, die in den Dreißigerjahren am Institut für Radiumforschung in Wien grundlegende Forschungsarbeit leistete, aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln vor den Nazis nach Mexiko fliehen musste und unbekannt starb.












