 Das größte Geheimnis von Hollywood, Ecke Le Vine St.
Das größte Geheimnis von Hollywood, Ecke Le Vine St.
Manchmal reichen ganze drei Romane, um einen Autor ganz fest ins Gedächtnis von Lesern zu brennen. Andrew Bergman ist so ein Fall. Seine period pieces waren zu seiner Zeit noch ungewöhnlich, heute sind period pieces schon fast eine Plage. Die von Andrew Bergman aber haben überdauert. Ein Klassiker-Check von Matthias Penzel.
Der Autor, um dessen Bücher es hier geht, ist ziemlich unbekannt. Biografische Daten scheinen eher irreführend als erhellend, bei Tageslicht betrachtet kann man sich einen Reim darauf machen, mehr dazu aber erst später. Neben einem unverschämt witzigen Roman über eine jüdische Familie in Amerika hat er drei Krimis geschrieben, die zwischen 1974 und 2001 erschienen sind. Kein Wunder, dass er bei diesem spärlichen Ausstoß selbst für beinharte Junkies von Private-Eye-Novels ein unbeschriebenes Blatt ist. Er schreibt nicht am Fließband, ist zur Vermarktung kaum zu gebrauchen, er bestreitet sein Einkommen anderswo, schreibt also, wie er will – denkt man sich, wenn man diese Juwelen zwischen eher hässlichen Buchdeckeln betrachtet.
PI Classics
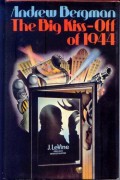 Wer allerdings die Lebens- und Leidenswelten von Schnüfflern schätzt, ihr Stochern im Dreck, den der amerikanische Traum aufwirbelt, dazu ihre lakonischen One-Liner, nicht nur, wenn sie am falschen Ende einer Knarre dumm aus der sorgsam ausgewählten Wäsche schauen, der kommt an Andrew Bergmans Kreation nicht vorbei.
Wer allerdings die Lebens- und Leidenswelten von Schnüfflern schätzt, ihr Stochern im Dreck, den der amerikanische Traum aufwirbelt, dazu ihre lakonischen One-Liner, nicht nur, wenn sie am falschen Ende einer Knarre dumm aus der sorgsam ausgewählten Wäsche schauen, der kommt an Andrew Bergmans Kreation nicht vorbei.
So wie es sich für einen Privatdetektiv der Zeit Philip Marlowes gehört, arbeitet Jack LeVine allein. Cops mögen ihn nicht, weil er seine Rechte kennt. Seine Kunden landen eher zufällig in seinem schäbigen Office, und seine Feinde belächeln ihn. LeVine wäre gern cool wie Sam Spade, er liest und träumt von den Antiheroen in Pulp Novels, … und er war auch schon mal in Hollywood, wo er unter dem Schafott den ersten Toten fand, dann im Kugelhagel auf die Knie ging. Er kam nur in letzter Minute davon, dann aber auch gleich mit wahnwitziger Unterstützung eines der traumhaftesten Schutzengel … Ja, ja, schon klar, er ist ein Serienheld, er überlebt alles, sein Autor weiß das, und darum ist alles immer nicht so ganz bierernst. Zumeist ist LeVine eben nicht locker lapidar wie Marlowe, wiewohl er Similes wie von Chandler manchmal am Fließband produziert, phasenweise einen Lacher pro Seite.
„Das ist nicht metaphorisch gemeint?“, fragt irgendwann der Detektiv den in sein Office hineingewalzten Klopper.
Er zuckt zusammen. Er hatte nicht erwartet, dass ich irgendeinen Laut von mir geben könnte, der aus mehr als zwei Silben besteht. „Metaphorisch“ war ein Wort, das ich gern alle paar Wochen aus der Garage rollte wie ein Ford Coupé für eine alte Dame.
Nicht cool, aber cool
Doch, und das macht diesen Detektiv so wertvoll: Er ist nicht cool, auch nicht mit Hut. Er mag sich LeVine nennen, doch wenn er auf besonders gemeine Halunken trifft, dann sind die vorbereitet. Die lachen LeVine dann ins Gesicht, dass er sich nennen kann wie er will, solange er als Jacob Levine geboren wurde, ist und bleibt er, wie er aussieht: ein untersetzter, übergewichtiger Jud mit Vollglatze, eine armselige Existenz aus New York.
Bücher
 Meine Paperback-Ausgabe von dem wohl besten der drei Krimis („Comedy-Krimis“, wer möchte) hat auf der Seite, wo normal der Autor vorgestellt wird, ein Zitat. Auf Deutsch gab es das Buch mal in Ullsteins Gelber Reihe (zu deren unredlicheren Zeiten), und schon der Titel war dort so abschreckend, dass ich hier den Text lieber auf Englisch wiedergebe:
Meine Paperback-Ausgabe von dem wohl besten der drei Krimis („Comedy-Krimis“, wer möchte) hat auf der Seite, wo normal der Autor vorgestellt wird, ein Zitat. Auf Deutsch gab es das Buch mal in Ullsteins Gelber Reihe (zu deren unredlicheren Zeiten), und schon der Titel war dort so abschreckend, dass ich hier den Text lieber auf Englisch wiedergebe:
„I don’t enjoy killing people, but this was not a situation in which ethics were up for debate. It was caveman time and I got Clarence White with what was actually a bad shot. I wanted the heart, but the stinging pain in my shoulder was throwing me off balance, so the shot flew upwards and caught White below the Adam’s apple, cutting his windpipe. He tossed his gun away and clutched at his throat, as if to repair the damage with his hands. Death broadcast a hoarse and ruined melody. It was no fun to hear.“
Liest man dann den Prolog zu Hollywood & Le Vine, über die Nachkriegsjahre in New York, die wilde lange Party, Sieger kehrten heim, G.I.s ließen ihre Gattinnen bespitzeln und 1947 war die Konjunktur verebbt, die Soldaten hatten andere Sorgen, und zu dem Hangover nach der Party dann der Griff in den Safe, und zum Vorschein kam: eine Handvoll Staub. Liest man das dann, dann ist man in diesem Sog. Den erzeugt Bergman, weil er schreibt, was er schreiben will – ohne Druck, hier etwas beweisen zu müssen –, weil er seinen Chandler kennt und damit spielt wie ein beschwipster Bar-Pianist, dazu noch etwas Screwball, dann die ganze jüdische Last nach dem Krieg, der bleibende Humor im Angesicht existenziellen Grauens und manchmal eine Nackte, die dem Detektiv Gesellschaft leistet, manchmal der Tod.
„Das Telefon klingelte um drei Uhr dreißig am Morgen. Ich kann mich präzise erinnern, da ich in dem Moment in meinem Wohnzimmer saß, im Seersucker-Mantel einen Ellery Queen-Krimi las und mein Magen wegen einer Dose Chili nach Mitternacht am kollabieren war. Ich sah auf das Telefon, dann meine Armbanduhr. Wenn es etwas Schlimmeres gibt als um drei Uhr dreißig vom Telefon geweckt zu werden, dann ist es um die Zeit hellwach sein und hören, wie das Telefon zu klingeln beginnt. Nie im Leben passiert das wegen etwas Gutem.“
Also stiefelt er wieder los (hier in Krimi No. 3) …
„Sie stand unter Schock, redete, um die Realität in den Griff zu kriegen, um die Welt anzuhalten, auf alle Ewigkeit im Stillstand des Jetzt-minus-zwei-Stunden. Das normale Gerede des normalen Alltags […] Das Leben geht weiter, reden wir doch einfach weiter, bitte, und dann kommt der Moment, in dem der Tod reinspaziert, seinen Mantel und Hut abnimmt, die Schuhe aufbindet und es sich bequem macht, sich häuslich einrichtet. Aber sie war noch Wochen, vielleicht Monate entfernt von diesem grauenhaften, erschlagenden finalen Moment. Sie lebte immer noch um Vor-zwei-Stunden.“
Gags & Lacher
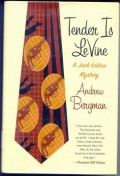 Krimi No. 3, Tender Is Le Vine, hat einige dieser Kadenzen, wie auch bei dem Boxkampf (Yankee Stadium, im anbrechenden TV-Zeitalter schwach besucht, Joe St. Louis gegen den jüngeren fitteren Charles): „Wir wurden Zeuge vom Ende der Ära, die einst alle unsere Kindheitsträume angefeuert hatte.“
Krimi No. 3, Tender Is Le Vine, hat einige dieser Kadenzen, wie auch bei dem Boxkampf (Yankee Stadium, im anbrechenden TV-Zeitalter schwach besucht, Joe St. Louis gegen den jüngeren fitteren Charles): „Wir wurden Zeuge vom Ende der Ära, die einst alle unsere Kindheitsträume angefeuert hatte.“
Die Lacher, die nicht beschwipsten, sondern fast geschwätzig aus dem Ärmel geschüttelten Lacher im Debüt The Big Kiss-Off of 1944 liest man auch mit Wonne und Gewinn an einem Nachmittag weg. Von vorne, frei übersetzt:
„Es war ein Donnerstagmorgen und ich hatte eine Menge zu tun, musste beispielsweise schwarzen Kaffee aus einem Pappbehälter schlürfen und aus dem Fenster glotzen, zusehen, wie die Buchhalter in dem Gebäude gegenüber Papiere rumschieben.“
Nach diesen beiden Büchern von 1974 und 1975 dann 2001 Tender is Le Vine, für das das Office renoviert wurde, und Le Vine im noch dekadenten Havana bewirtet, betrogen und verprügelt wird, in Vegas fast verendet („eine klasse Stadt, um sich umzubringen, außer dass man es hier möglicherweise gar nicht merkt, wenn man nicht mehr am Leben ist“). Die Familie seines Klienten, Holocaust-Überlebende, hat in ihrer auch tagsüber abgedunkelten Wohnung „fünf Zimmer und Möbel für zehn“.
Der gewiefte Schnüffler von heute „googelt“ ja nicht nur, er „amazont“ sich auch durchs Web. Und wenn man da also nach Andrew Bergman stochert, sieht man, dass es von ihm vieles gibt. Sachbücher zur Großen Depression und Film, auch den zum Schreien komischen und gemeinen Roman über eine jüdische Familie in Amerika, vor allem aber viele Filme. In Hollywood ist Bergman kein Unbekannter. Er debütierte 1974 mit Der wilde wilde Westen (Buch und Drehbuch). Mit Mel Brooks und Gene Wilder machte ihn der Film zu einem Lieferanten von Hits für die Massen, meist mit mehr, manchmal ohne Comedy-Elemente – siehe Ein ungleiches Paar (2003), Striptease (1996) und vergleichbare Schnelldreher. Erwähnenswert vielleicht noch Freshman (1990) mit Marlon Brando und das immer wieder um Mitternacht auf seltsamen Sendern ausgestrahlte Fletch – Der Troublemaker (1985) nach der allerdings weniger von der Zeit überholten Vorlage von Gregory MacDonald.
Für mich sind seine Krimis wie die von Gregory MacDonald: gewitzt, schnell, handwerklich atemraubend … und verblüffend unbeachtet.
Matthias Penzel
| Filmographie Andrew Bergmann
| Los Angeles. Porträt einer Stadt
| Matthias Penzel bei Kolumnen.de
| Mehr zu Matthias Penzel











