George in the Box
Dirk Schmidt, der mit “Letzte Nacht in Queens” einen der bemerkenswertesten New York Romane der letzten Dekaden geschrieben hat, checkt heute George Smiley, dessen Leute und deren Erfinder John le Carré auf ihre literarische Haltbarkeit im Pantheon des Polit-Thrillers und somit der Gegenwartsliteratur.

Na, ja, – da sitzt der Spion zur hohen Zeit des kalten Kriegs hinter dem eisernen Vorhang und was noch nicht schief gegangen ist, wird bald schief gehen. Unter anderem weil die bereits damals vorsintflutliche Sendeapparatur ihren Geist aufgibt. In Zeiten, in dem wir ihm theoretisch mittels Google Earth beim Funken zusehen könnten, und die Kollegen diverser CSIs in der Lage wären aus seinem Angstschweiß das entscheidende Indiz für einen Kriminalfall des 17. Jahrhunderts zu extrahieren, wirkt diese Wendung ähnlich altbacken wie der kurz darauf folgende Auftritt eines Deus Ex Machina in der Einsatzzentrale auf der anderen Seite der deutsch-deutschen Grenze. „In der Tür zum Dachboden erschien eine Gestalt. Sie trug einen teuren Mantel aus braunem Tweed mit etwas zu langen Ärmeln. Es war Smiley.“
Smiley, als George out of the box, der die gescheiterte Mission auf Bitten eines nicht näher genannten Ministeriums beendet und den kleinen namenlosen Dienst, der sich nach Jahren der Stagnation im Schatten des großen, im Jargon der Branche „Circus“ genannten MI6, noch einmal zu alter Größe aufschwingen wollte, endgültig in die Bedeutungslosigkeit entlässt. Zuvor waren wir ein Buch lang Zeugen wie sich das Desaster andeutete, anbahnte und schließlich mit der bedächtigen aber unaufhaltsamen Präzision einer Bürokratiemaschine seinen Lauf nahm. Und nach der Lektüre sind wir, wie sich das so gehört, um Einiges klüger. Wir haben etwas erfahren über die ewigen Themen Hybris und die Suche nach Bedeutung.
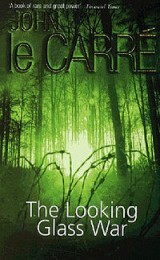 Denn der kalte Krieg und seine Nebenschauplätze sind le Carrés eigentliches Thema nie gewesen, weshalb es nicht überrascht, dass er sein Schreiben nach dem Mauerfall ungerührt und mit der gleichen brillanten Konsequenz fortsetzte, als sei lediglich in China eine Mauer gefallen. Natürlich, Verrat ist ein Thema, Selbstverrat ein großes und le Carré hätte sich sein Genre nicht ausgesucht, wenn er nicht dem Tricksen, Täuschen, dem Spiel mit der Maske des Scheins etwas abgewinnen wollte. Aber bereits „The Looking Glass War“ ist mehr als die Summe seiner Teile. Die gnadenlose Ignoranz mit der LeClerc, der seltsame Chef des seltsamen namenlosen Dienstes, auf dem Weg in die Katastrophe immer zwei Schritte vor dem ersten nimmt, die Indifferenz mit der sein junger Untergebener Avery auf die stete Abfolge von Anzeichen für eine nahende Katastrophe reagiert und die stoische Dumpfheit mit der Leiser, der Spion außer Form in den sicheren Tod marschiert, beschwören eine Tragik des Scheiterns, der es nicht an Größe fehlt. Ja, hier scheitert ganz England, das Ex-Weltreich noch ein weiteres Mal und am Schluss wird Leiser sterben und kein Schachtelteufel-Smiley kann ihn retten. Avery versteht die Welt nicht mehr und LeClerc hat sie nie verstanden.
Denn der kalte Krieg und seine Nebenschauplätze sind le Carrés eigentliches Thema nie gewesen, weshalb es nicht überrascht, dass er sein Schreiben nach dem Mauerfall ungerührt und mit der gleichen brillanten Konsequenz fortsetzte, als sei lediglich in China eine Mauer gefallen. Natürlich, Verrat ist ein Thema, Selbstverrat ein großes und le Carré hätte sich sein Genre nicht ausgesucht, wenn er nicht dem Tricksen, Täuschen, dem Spiel mit der Maske des Scheins etwas abgewinnen wollte. Aber bereits „The Looking Glass War“ ist mehr als die Summe seiner Teile. Die gnadenlose Ignoranz mit der LeClerc, der seltsame Chef des seltsamen namenlosen Dienstes, auf dem Weg in die Katastrophe immer zwei Schritte vor dem ersten nimmt, die Indifferenz mit der sein junger Untergebener Avery auf die stete Abfolge von Anzeichen für eine nahende Katastrophe reagiert und die stoische Dumpfheit mit der Leiser, der Spion außer Form in den sicheren Tod marschiert, beschwören eine Tragik des Scheiterns, der es nicht an Größe fehlt. Ja, hier scheitert ganz England, das Ex-Weltreich noch ein weiteres Mal und am Schluss wird Leiser sterben und kein Schachtelteufel-Smiley kann ihn retten. Avery versteht die Welt nicht mehr und LeClerc hat sie nie verstanden.
Hybris und die Suche nach Bedeutung – „The Looking Glass War“, war ein Misserfolg nach dem Durchbruch mit „The Spy who came out of the cold“, verrissen vor allem in England. Auch der Rezensent der New York Times ist alles andere als begeistert von le Carrés offenkundiger Weigerung mit einer Art Spy II zum Formula-Writer zu mutieren. Er scheint überdies zu ahnen wohin der Wind der Ambitionen le Carrés weht und spricht dem Autor vorsichtshalber die für einen echten Literaten nötige Subtilität im Umgang mit seinen Figuren ab. Hier wird doch nicht jemand zu neuen Ufern aufbrechen, sich aufmachen zu den Gestaden der Hochliteratur. Tatsächlich ist die Gefahr evident. Aber die Gefahr zu scheitern auch. Der Ausflug in ein gefühltes Oben („The naive and sentimental Lover“) gerät zum Desaster. Wenn John le Carré sich schließlich entscheidet irgendwie doch ein Formula Writer zu sein, dann hat er seine Gründe.
The cat sat on the mat
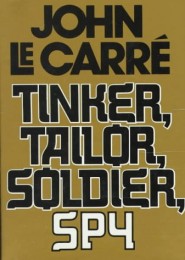 „The cat sat on the mat“ sei keine Story hat le Carré mal gesagt, „The cat sat on the dogs mat“ dagegen schon. Es gibt wahrlich spannendere Ansätze. Nein, das Storytelling hat er nicht erfunden, der „chap“ mit dem Germanistikstudium. Selbst der ungeübte Leser kann sich irgendwann dem Verdacht nicht entziehen, dass Prideaux, der verratene Agent, der Tote auf Abruf, dem so viel Raum eingeräumt wird in der Exposition von „Tinker, Taylor, Soldier, Spy“, dass dieser Prideaux, der keine große Hilfe ist bei der Suche nach dem Verräter in den eigenen Reihen, irgendwann noch zu dramaturgischen Ehren kommen wird. Ein Ziegelstein von einem Roman und nichts ist so leicht wie die Haupthandlung in einem Satz zusammenzufassen. George Smiley wird beauftragt einen Maulwurf namens „Gerald“ zu suchen, sucht lange und findet ihn schließlich. Nebenhandlung: Prideaux ermordet Gerald nach dessen Enttarnung. Neben-Nebenhandlungen: Der kleine Fisch Rickie Tarr bringt den Stein ins Rollen, er hat eine Affäre mit einer Russin, die bald darauf verschwindet und Prideaux verbindet mit Gerald mehr als Freundschaft und berufliche Kollegialität. Ach ja, um Smiley aus der Spur zu bringen schläft Gerald mit Ann, Smileys nymphomanischer Frau. Diese simple „reverse psychology“ hält ihn bis zum Schluss aus der Schusslinie. Aber das war es im Großen und Ganzen.
„The cat sat on the mat“ sei keine Story hat le Carré mal gesagt, „The cat sat on the dogs mat“ dagegen schon. Es gibt wahrlich spannendere Ansätze. Nein, das Storytelling hat er nicht erfunden, der „chap“ mit dem Germanistikstudium. Selbst der ungeübte Leser kann sich irgendwann dem Verdacht nicht entziehen, dass Prideaux, der verratene Agent, der Tote auf Abruf, dem so viel Raum eingeräumt wird in der Exposition von „Tinker, Taylor, Soldier, Spy“, dass dieser Prideaux, der keine große Hilfe ist bei der Suche nach dem Verräter in den eigenen Reihen, irgendwann noch zu dramaturgischen Ehren kommen wird. Ein Ziegelstein von einem Roman und nichts ist so leicht wie die Haupthandlung in einem Satz zusammenzufassen. George Smiley wird beauftragt einen Maulwurf namens „Gerald“ zu suchen, sucht lange und findet ihn schließlich. Nebenhandlung: Prideaux ermordet Gerald nach dessen Enttarnung. Neben-Nebenhandlungen: Der kleine Fisch Rickie Tarr bringt den Stein ins Rollen, er hat eine Affäre mit einer Russin, die bald darauf verschwindet und Prideaux verbindet mit Gerald mehr als Freundschaft und berufliche Kollegialität. Ach ja, um Smiley aus der Spur zu bringen schläft Gerald mit Ann, Smileys nymphomanischer Frau. Diese simple „reverse psychology“ hält ihn bis zum Schluss aus der Schusslinie. Aber das war es im Großen und Ganzen.
Eines sehr fernen Tages wenn le Carrés Romane endgültig von der Realität überholt wurden, weil Verrat und Hybris endgültig abgeschafft sind und alle Menschen ihrer Bedeutung und Würde entsprechend in Frieden und Liebe leben, kann man sie immer noch als historisches Kompendium versunkener bürokratischer Rituale lesen. Da werden unablässig Abrechnungen kontrolliert, Spesen gewährt und entzogen, sichere Häuser gemietet, Flüge gebucht, Rechenschaftsberichte geschrieben, Quittungen gesammelt und dem tiefen Geheimnis der korrekten doppelten Aktenführung auf die Spur gekommen. Und es scheinen diese Mechanismen zu sein, welche die Figuren und den maroden Apparat selbst am Leben erhalten. Spionage, so lernen wir, ist wie Steuerberatung ohne die tägliche Dosis Adrenalin. Und wenn es doch einmal hinaus in die Welt geht, dann ist diese zunehmend undurchschaubar geworden, seit die Sonne des Empires nicht mehr scheint.

Die „Vettern“ von der anderen Seite des Atlantiks sind die neuen Herren und von mindestens so zweifelhafter Natur wie die Russen, die Deutschen oder diese fremdartigen Skandinavier mit ihrem vielen Schnee zu Beginn von „The Looking Glass War“. Taylor, der Außenagent, der schon lange nicht mehr draußen war, läuft der Gegenseite mit einer Konsequenz ins Messer die den Übergang von der Tragödie zur Farce markiert. „Aber ihm fiel ein, vielleicht ein bisschen spät, dass man auf dem Kontinent rechts fuhr und er genau genommen auf der falschen Straßenseite ging (…)“ Bei einem seiner, als Besuch euphemisierten Rapporte in der Londoner CIA Dependance befällt Smiley der Gedanke, dass allein der Wert des Eingangstores den Circus einige Wochen am Laufen halten könnte.
John le Carré ist ein Schriftsteller der Beobachtung, des Details und der Atmosphäre. Und George Smiley ist eine dicke alte Katze und die dog mat der geliebt/gehasste Circus, um den sich alles dreht. Der geneigte Leser kann sich verlieren in diesen Büchern und selbst zur Katze werden. Einer Katze die stundenlang in diese vergangene und immer schon altmodische Welt hineinstarrt, den wunderbaren Dialogen nachlauscht und dem morbiden Charme, der Lakonie und leisen Trauer erliegt, die fast jede Zeile durchziehen.
Keep Smiley
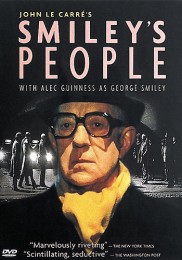 Der Theorien sind einige. Hat le Carré das Potential der Figur zunächst nicht erkannt? Hat er geglaubt, der gute George habe bereits in den beiden ersten (schwachen) Romanen sein Pulver verschossen? 12 Jahre braucht es, bis Smiley wieder einen Stoff schultern darf und dann gleich in einem großen Wurf. „Tinker, Taylor, Soldier und Spy“, inspiriert von einem englischen Kinderreim, stehen für die vier Hauptverdächtigen im schlimmsten Fall von Verrat der neueren englischen Geschichte. Der älteste und berühmteste Geheimdienst der Welt ist am Ende eines langen Weges angekommen, und Smiley, der verhinderte Geistliche hat die Aufgabe ihn entweder gesundzubeten oder ihm die letzte Ölung zu geben. Nach und nach wird klar, was die Figur so enorm anstrengend für ihren Schöpfer macht. Smiley ist das personinfizierte Scheitern und trotzdem, laut le Carré, der ideale Spion. 10 Cent für jedes Mal in der eine andere Figur Smiley als „cunning as a fox“ bezeichnet, ohne das es irgendwo bewiesen würde, für jede Sequenz in der Smiley aus nichts als Marotten und Attitüde zu bestehen scheint 10 Cent – und eine le Carré Gesamtausgabe wäre locker drin.
Der Theorien sind einige. Hat le Carré das Potential der Figur zunächst nicht erkannt? Hat er geglaubt, der gute George habe bereits in den beiden ersten (schwachen) Romanen sein Pulver verschossen? 12 Jahre braucht es, bis Smiley wieder einen Stoff schultern darf und dann gleich in einem großen Wurf. „Tinker, Taylor, Soldier und Spy“, inspiriert von einem englischen Kinderreim, stehen für die vier Hauptverdächtigen im schlimmsten Fall von Verrat der neueren englischen Geschichte. Der älteste und berühmteste Geheimdienst der Welt ist am Ende eines langen Weges angekommen, und Smiley, der verhinderte Geistliche hat die Aufgabe ihn entweder gesundzubeten oder ihm die letzte Ölung zu geben. Nach und nach wird klar, was die Figur so enorm anstrengend für ihren Schöpfer macht. Smiley ist das personinfizierte Scheitern und trotzdem, laut le Carré, der ideale Spion. 10 Cent für jedes Mal in der eine andere Figur Smiley als „cunning as a fox“ bezeichnet, ohne das es irgendwo bewiesen würde, für jede Sequenz in der Smiley aus nichts als Marotten und Attitüde zu bestehen scheint 10 Cent – und eine le Carré Gesamtausgabe wäre locker drin.
Smiley geistert durch 3 große Romane ohne auf dem langen Weg zum Finale Greifbares zu produzieren, ohne eine Heldentat zwischendurch, ohne einen erkennbaren Geistesblitz mittendrin. Vielleicht wird er deshalb so oft gefeuert, oder geht in Pension. Selbst wenn sich der letzte Stein ins Mosaik fügt und der Maulwurf ins Netz geht und Carla, Smileys sowjetischer Gegenspieler auf einer dunklen Brücke von Ost nach West, haben wir nicht das Gefühl einem Genie bei der Arbeit begegnet zu sein. Smiley putzt unablässig seine Brille mit dem breiten Ende seiner Krawatte, er ist seitenlang geistesabwesend, leidet an dem Zustand seiner Ehe, des Circus, Englands und der Welt und philosophiert über den Sinn seines Tuns. Wenn er nicht Akten liest, wobei es aussieht, als wäre er eingenickt, hört er zu und scheint dabei zu schlafen. Für die wirkliche Arbeit hat er seine Leute, einen James Bond namens Peter Gilliam zum Rumkommandieren und im Hintergrund Connie Sachs, die lebende Festplatte. Im Feld ist Smiley klug und besonnen, aber er ist selten unterwegs. Le Carré beschreibt ihn immer wieder aufs Neue als eine Ansammlung von Schrulligkeiten und als zu lebensuntüchtig, zu schwer, zu alt, zu weltfremd, zu gutmütig, zu verletzt, zu müde, zu durchsetzungsschwach und natürlich zu kurzsichtig. Es dauert eine Weile bis sich der Nebel legt und dem Leser nach vielen, vielen Seiten Brille-mit-Krawatte-putzen aufgeht, dass le Carré ihn getäuscht hat und in die Irre führt.
Wenn Smiley ein Mensch ist ohne Gesicht und Namen, ohne Geschichte, ohne echte Leidenschaften und asexuell. Wenn Smiley überall zuhause ist und überall fremd, unauffällig und auffällig zugleich, eine unsichtbare Fata Morgana in einem ewig schlecht sitzenden Anzug. Wenn das alles gleichzeitig zutrifft, dann ist Smiley tatsächlich nichts anderes als der ideale Spion. Das ist das wunderbare an dieser Figur und macht sie sozusagen dreidimensional. Wahrscheinlich sind die Smiley Romane auch deshalb so gut gealtert und bestehen jeden Klassikercheck.
Dirk Schmidt
John le Carré: Krieg im Spiegel (The Looking Glass War, 1965). Roman. Deutsch von Manfred Conta. Wien/Hamburg: Zsolnay 1965. 319 Seiten. 7,95 Euro.
John le Carré: Agent in eigener Sache (Smiley’s People, 1979) Roman. Deutsch von Rolf und Hedda Soellner. Hamburg: Hoffmann & Campe 1980. 400 Seiten. 8,99 Euro.
John le Carré: Dame, König, As, Spion (Tinker, Taylor, Soldier, Spy, 1974). Roman. Deutsch von Rolf und Hedda Soellner. Hamburg: Hoffmann & Campe 1974. 415 Seiten. 8,95 Euro.
Le Carré bei kaliber.38. John le Carré bei Arte TV. John le Carré: Official Author’s Website











