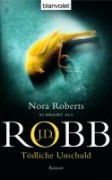 Warum immer der Ärger mit den Übersetzungen?
Warum immer der Ärger mit den Übersetzungen?
Tja, peinlich – da starten wir eine kritische Kolumne und schon lässt das zerknirschte Lektorat einen fetten Druckfehler stehen. Danke, liebe genaue Leserinnen und Leser, für die vielen schnellen Hinweise! Klaus Kamberger grübelt über die möglichen Folgen und knöpft sich dann eine Erfolgsautorin vor …
Beispiele, Gründe
Vorweg noch zwei Anmerkungen.
Anm. 1: Vor Gericht ist es verpönt, sich bei der Beweisführung aufs bloße hearsay zu berufen, und auch beim Schreiben mehr oder weniger schlauer Glossen aus dem Gedächtnis, sollte man sich besser nicht aufs eigene Hörensagen allein verlassen. Wie letztlich leider geschehen in meinem Mini-Feature übers Übersetzen an dieser Stelle. Sorry. Umso gewinnbringender, wenn einem dann gleich kluge Leser zu Hilfe eilen und das Ganze wieder gerade rücken. Danke. Doris Wieser hat Casablanca offenbar häufiger im O-Ton genossen als ich. Natürlich sagt Bogey zu Ingrid: Here’s looking at you.
Ja nun, nicht mehr als ein besserer Tippfehler, ließe sich tröstlich schließen. Doch so locker geht es nicht immer ab … Denn was wäre wohl passiert, wenn so ein Fehler schon in die Vorlage gerutscht und damit objektiv „wahr“ geworden wäre? Etwa so. Beim Synchronisieren guckt jemand in die Vorlage, kapiert etwas nicht und macht aus „Here’s“ ein schlichtes „He’s“. Dann hätt’s doch gestimmt, zumindest fast: „Ich schau dir in die Augen …“
Unvorstellbar? Mitnichten: Vor etlichen Jahren hatte ich das unvergleichliche Vergnügen, mich an seinem Wohnort in Bamberg mit keinem Geringeren als dem großen Joyce-Übersetzer Hans Wollschläger über Karl May, Arno Schmidt, Gustav Mahler, das Cellospielen und außerdem noch über die Tücken des Übersetzerhandwerks unterhalten zu dürfen. Bei seiner Arbeit am Ulysses, schmunzelte er, sei ihm zum Beispiel ein richtiger Bock unterlaufen. In der Vorlage sei an einer Stelle von … the public sweat of monks die Rede gewesen. Einen Reim habe er sich darauf überhaupt nicht machen können, auch der weitere Zusammenhang habe keinerlei Erleuchtung gebracht, also habe er halt achselzuckend … der öffentliche Schweiß der Mönche hingeschrieben. Inzwischen wisse er es besser. Die Zensur habe ja seinerzeit in Joyce’s Heimat Druck und Erscheinen des Ulysses erfolgreich verhindert. Erst auf dem Umweg über Frankreich sei es zu einer Veröffentlichung (des englischen Originals!) gekommen. Doch die französischen Setzer und Korrektoren seien mit dem Englischen, wenn überhaupt, höchstens im Schulunterricht in Berührung gekommen, und so hätten sie leider nichts mit dem Originaltext anfangen können, in dem es hieß: … the pubic sweat of monks. Prompt habe einer in den Korrekturfahnen zwischen dem „b“ und dem „i“ ein bescheidenes, das Verständnis aber auch nicht gerade optimierendes „l“ eingeschoben.
Mal ganz ehrlich: Wer von uns hätte an des Korrektors Stelle wohl gleich so etwas wie „Schambein“ (pubic bone, anatomisch: mons pubis) assoziiert? Die Folge: Der schamschweißtreibende Fehler schlich sich ins ¼uvre ein und feierte auch in späteren Ulysses-Ausgaben noch fröhliche Urstände, dem irischen Dichter wohl augenzwinkernd die vielen „Eigentümlichkeiten“ nachsehend, die jeden Joyce-Leser, so er sich ans Original heranwagt, ohnehin in die nackte Verzweiflung treiben dürften.
Anm. 2: Übersetzen ist oft nur ein Annähern, nein, fast immer ist es das. Was ist schon deckungsgleich im Englischen und im Deutschen? Einzelne Wörter vielleicht. Der richtige Ausdruck für diese oder jene Phrase ist dagegen meistens nur noch der passende. Folgerichtig ist jede Kritik an Übersetzungen fast immer ein Balanceakt. Man tänzelt da quasi zwischen traduktorischem Fundamentalismus, freundlichem Laissez-faire und deftigem Spott, wenn es mal allzu plump wird.
Trotzdem gibt es Grenzen, an deren unverrückbarem Verlauf man festhalten sollte. Fundamentalistisch gesprochen: Einfach Falsches darf nicht durchgehen. Beim Laissez-faire sollte man sich nie von eleganten Formulierungen und spritzigen Verbal-Volten aufs Glatteis führen lassen: Vielleicht hatte der Übersetzer nämlich nur nichts begriffen und diesen Umstand wortreich zu kaschieren gewusst. Spott aber ist meistens wohlfeil, man sollte ihn sich also für solche Fälle aufheben, in denen einer es wirklich verdient hat.
Nachsicht ist auch nicht angesagt, wenn ein deutscher Text zwar ausschließlich aus deutschen Wörtern besteht, am Ende aber doch verdächtig – z.B. – englisch klingt. Ein Übersetzer, der aus einem englischen Satzbau keinen deutschen macht, der Perfekt und Imperfekt nicht unterscheiden kann, es auch sonst nicht mit der Zeitenfolge hat, dafür mit gewagten Partizipkonstruktionen um sich wirft, sollte seine Berufswahl noch einmal überdenken.
Andererseits soll Kritik nicht in ihr Gegenteil ausarten – in Rechthaberei nämlich. Da sei der nervende Bastian Sick-sei-bei-Uns vor! Klar doch: Wenn es bei einem „entlang des Rheins“ geht, dann grummelt es bei mir schon mächtig, weil ich lieber den Rhein entlang fahre. Aber sollte man deswegen dann gleich die Keule des Herrn Beckmesser schwingen (halt, falsches Bild, besser: seine Kreide quietschen lassen)?
Zurück zu den Gründen und Beispielen für so wenige gute und so viele miese Übersetzungen. Gründe gibt es in der Hauptsache zwei. 1. Erfreulicherweise können sich immer mehr Mitmenschen lesend, zuhörend, parlierend verständigen. Vor allem auf Englisch. Und manche meinen deswegen: Dann nutze ich das doch mal ein bisschen und übersetze für ein paar Euro den einen oder anderen Text. Bei Gebrauchsanweisungen kann das indes schon jeder Automat besser (und lustiger), also muss es leider gleich die Literatur sein. Da stellt sich dann aber oft und schnell heraus: Der/die Akteur/in kann gar kein Deutsch. 2. Die Verlage – man kann das durchaus so pauschal sagen – bezahlen gute wie schlechte Übersetzungen gleichermaßen beschissen, da kommt es also gar nicht so sehr darauf an, was man abliefert. Zumal das, was abgeliefert wird, erfahrungsgemäß schlecht bzw. kaum bzw. unprofessionell kontrolliert wird. Und warum? Weil Lektoren längst zu Verwaltern in Sachen Buchproduktion degeneriert sind, selber gar nicht mehr ordentlich zum Lektorieren und Redigieren kommen (falls sie so etwas überhaupt können), dafür einlangende Übersetzer-Manuskripte für zwei, drei Euro pro Seite von freien Mitarbeitern (Hausfrauen, Rentnern und sonstigen selbsternannten, oft sicher gutwilligen, aber systematisch überforderten Redakteuren) anschauen und für druckfertig erklären lassen. Dass bei derart doppeltem Sparen oft Mist herauskommt, wen wundert’s?
Jede Menge angestrengt flotte Formulierungen, reichlich garniert von Streu und Mist aus dem Übersetzerstall, bietet zum Beispiel: Nora Roberts’ Ausflug in New Yorks raue Krimiwelt. Ja, ganz richtig: Nora Roberts. An sich fasse ich ihre Texte ja, wenn überhaupt, nur mit Handschuhen und Kneifzange an. Doch wenn einem da nun eine „andere“ Seite der Erfolgsautorin angekündigt wird, sollte man doch mal fairerweise …
Leider entpuppt sich J.D. Robb (= Nora Roberts): Tödliche Unschuld (Blanvalet) prompt als reichlich missglückter Versuch des Heranwanzens an eine große amerikanische Tradition mittels cooler Sprüche und aufgesetzt lässiger Attitüden. Die Übersetzerin tut zwar sicherlich ihr Bestes, das auch im Deutschen zu treffen, gerät aber leider so oft ins Stolpern, dass sie das ganze Unternehmen erst recht desavouiert.
Nicht nur, dass sie immer mal wieder an der Vorlage klebt, bis hinein in den englischen Satzbau („Der andere lag auf dem Rücken und hatte die vor Überraschung weit aufgerissenen Augen der Decke zugewandt“ – alles klar? Da lag ein Toter am Boden, und seine weit aufgerissenen Augen, in denen noch die Überraschung stand, starrten zur Decke …). Auch Beamtendeutsch kann plötzlich cool sein, wenn der Übersetzerin gerade nichts Besseres einfällt und sie die Polizeibeamtin eine Leiche nicht mit einem „Eilt!“-Schildchen in die Pathologie schicken lässt, sondern mit einem veritablen „Dringlichkeitsbescheid“ (in dreifacher Ausfertigung?)
Schiefe Bilder en masse. Da „wickelt“ doch tatsächlich einer „den Tanz der Bürokratie ab“, während er doch bloß die geforderten bürokratischen Tänzchen bei seiner Arbeit naserümpfend hinter sich bringt. Anderswo taucht plötzlich eine Frau mit „schwarz-weiß gestreiftem Haar“ auf – wie wär’s da schlicht mit „Strähnen“? Dafür verfrachten die Undertaker dann Leichen nicht in die einschlägigen Säcke, sondern stecken sie in (hoffentlich reißfeste) „Tüten“.
Und wenn sie eine Phrase, eine Floskel oder ein Wort offenbar überhaupt nicht versteht, scheint unsere Übersetzerin lieber alles ganz wörtlich zu nehmen, statt zu recherchieren. Auch wenn das Ergebnis dann absolut rätselhaft ausfällt. „Die einzige Gewalttat … war, einen nicht zahlenden Kunden mit einem leichten Tritt von seinem Luftbrett zu befördern.“ Von was, bitte? Luftbrett? Stand da im Original – leider habe ich es nicht zur Hand – vielleicht „… give somebody the air“? Das hieße bei uns dann sinngemäß: vor die Tür setzen.
Noch eine Probe gefällig? „Ich strecke meinen Schnorchel eben nicht mehr ganz so oft wie andere Leute aus der Wiese.“ Gibt da der Maulwurf eine seiner Lebensweisheiten zum Besten? Eher nicht, denn Maulwürfe haben keine Schnorchel. Was soll uns dieses Bild also sagen? Schnorchel heißt im Englischen eigentlich „snorkel“, aber das kann man ja mal mit einem „snort“ (Schniefer) verwechseln. Ein „snort“ kann indes auch ein Näschen voll Kokain sein. War das gemeint? Doch was ist dann mit der Wiese? Auf deutschen Wiesen wächst Gras, und „gras“ ist … nein, kein Kokain. Was dann?
Ratlos klappt der Leser auf Seite 98 das Buch zu, lässt weitere knapp 300 ungelesen zurück und grübelt: Hat Frau Roberts das verdient? Wahrscheinlich. Aber man wird ja noch mal fragen dürfen …
Klaus Kamberger
J.D. Robb: Tödliche Unschuld (Purity in Death, 20002). Roman.
Deutsch von Uta Hege.
München: Blanvalet/Random House 2009. 479 Seiten. 8,95 Euro.











