 Der „Regio-Krimi“ hat viele Aspekte, CrimeMag diskutiert sie (Links siehe unten!)
Der „Regio-Krimi“ hat viele Aspekte, CrimeMag diskutiert sie (Links siehe unten!)
Ein Essay von Ulrich Baron beschäftigt sich in zwei Teilen mit der „local knowledge“ und dem Argument, im Grunde sei jeder Krimi ein Regionalgrimmi …
„Es gibt so viel Wissenswertes über Erlangen“ (Foyer des Arts)
„Eben nicht“ (Samuel Beckett)
Nicht alles, was irgendwo spielt, ist ein Argument für den Regio-Krimi (Teil 1)
I. Nicht allzu weit weg von Marsvinsholm

Annie Proulx
Es muss wohl ein bedingter Reflex sein, der mich erschaudern lässt, wenn ich beim Öffnen eines Buchpaketes Wörter wie „Norden“, „Wein“ oder „Eifel“ entdecke, und es sind nicht die Schrecken des Eises und der Finsternis, sind keine tief in uns Norddeutschen verwurzelten Ängste vor skrupellos panschenden Winzern oder verspäteten Regionalzügen, die solchen Schauder auslösen. Es ist der begründete Verdacht, dass wieder einmal eine 10-Kilo-Lieferung druckfrischer Regional-Krimis bei mir eingeschlagen hat, die zwischen Biberach und Finsterwalde keinen Marktflecken auslässt.
Dabei habe ich nichts gegen literarischen Regionalismus. So unterschiedliche Autoren wie Arno Schmidt, Annie Proulx und David Guterson haben daraus Weltliteratur gemacht. Frank Göhres Hamburg- und Karr/Wehners Gonzo-Krimis haben im regionalen Rahmen den Geist und den Sound einer Ära eingefangen. Doch an Regio-Krimis, die sich ausdrücklich als Regio-Krimis präsentieren, stört mich, was mich auch an vielen berufsmäßigen, doch unberufenen Fremdenführern ärgert: die Impertinenz, mit der sie mich mit banalen Fakten überhäufen, die ich bei Bedarf einem gedruckten Reiseführer entnehmen oder vor Ort selbst beobachten könnte. Die Penetranz auch, mit der einem angebliche lokale Gepflogenheiten vor- und die Tümlichkeit, mit der sie nachgekaut werden.
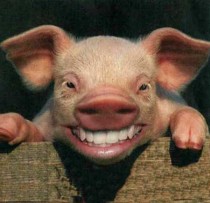
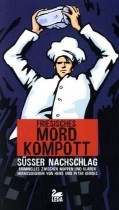 Was mich aber fast noch mehr stört, ist das Verteidigungsargument der Regiokriminalisten, dass jeder Krimi ja irgendwo spielen müsse und also alle Krimis eigentlich Regio-Krimis seien. Das ist ein argumentativer Rohrkrepierer, denn wenn das so wäre, dann gäbe es die boomende Marktnische Regio-Krimi mit deren Auswahlkriterien nach Ortsverzeichnis nicht. Niemand hätte sich Slogans wie „Morden im Norden“ oder „Mord-Sachsen“ abringen müssen, und der Leda-Verlag hätte keine Einladung zur Anthologie „Mordkompott-Nachschlag – Kriminelles zwischen Puffert und Peeren“ verschickt, der man entnehmen kann: „Es handelt sich um eine kulinarische Kurzkrimi-Sammlung mit stark regionalem Bezug (Ostfriesland/Friesland). Gesucht werden Stories um die zehn oder zwölf Normseiten, in deren Handlung eine regionaltypische Speise eine Rolle spielt. Das entsprechende Rezept wird angehängt.“ Angehängt scheint mir dabei auch die Krimi-Handlung, als eine Art Außenbordmotor für Sitcoms voller Spätzle, Schwätzle und Gschpäßle.
Was mich aber fast noch mehr stört, ist das Verteidigungsargument der Regiokriminalisten, dass jeder Krimi ja irgendwo spielen müsse und also alle Krimis eigentlich Regio-Krimis seien. Das ist ein argumentativer Rohrkrepierer, denn wenn das so wäre, dann gäbe es die boomende Marktnische Regio-Krimi mit deren Auswahlkriterien nach Ortsverzeichnis nicht. Niemand hätte sich Slogans wie „Morden im Norden“ oder „Mord-Sachsen“ abringen müssen, und der Leda-Verlag hätte keine Einladung zur Anthologie „Mordkompott-Nachschlag – Kriminelles zwischen Puffert und Peeren“ verschickt, der man entnehmen kann: „Es handelt sich um eine kulinarische Kurzkrimi-Sammlung mit stark regionalem Bezug (Ostfriesland/Friesland). Gesucht werden Stories um die zehn oder zwölf Normseiten, in deren Handlung eine regionaltypische Speise eine Rolle spielt. Das entsprechende Rezept wird angehängt.“ Angehängt scheint mir dabei auch die Krimi-Handlung, als eine Art Außenbordmotor für Sitcoms voller Spätzle, Schwätzle und Gschpäßle.
Auch die abgemilderte Variante der Regio-Krimi-Verteidigung, nach der ja selbst Henning Mankell sein Ystad oder Raymond Chandler sein Los Angeles so beschrieben habe wie heutige Regio-Krimis, trifft nicht zu. Mankells Krimis spielen so wenig im „richtigen“ Ystad, wie Chandlers Romane im „wirklichen“ Los Angeles gespielt haben. Sie spielen in einem fiktionalen Raum, für den Bezüge auf die realen Städte nur den Rahmen liefern.
 Zwar hat man zunächst den Eindruck, dass sich Mankell bei der Beschreibung der Lokalitäten und Lokale in und um Ystad sehr genau an der Wirklichkeit orientiert hat, doch bei einer Überprüfung am Text stellt man fest, dass solche exakten Realitätsbezüge eher selten und punktuell auftauchen. Das scheinbar so genaue Bild von Ystad hat man sich selbst gemacht und dafür Informationen aus Mankells Romanen mit geografischen Realien und zahllosen Szenen aus zahllosen Verfilmungen verbunden. Je berühmter die Serie wurde, desto bekannter sind auch ihre regionalen Bezüge geworden, und deshalb lohnt es sich, noch einmal an den Anfang zurückzugehen.
Zwar hat man zunächst den Eindruck, dass sich Mankell bei der Beschreibung der Lokalitäten und Lokale in und um Ystad sehr genau an der Wirklichkeit orientiert hat, doch bei einer Überprüfung am Text stellt man fest, dass solche exakten Realitätsbezüge eher selten und punktuell auftauchen. Das scheinbar so genaue Bild von Ystad hat man sich selbst gemacht und dafür Informationen aus Mankells Romanen mit geografischen Realien und zahllosen Szenen aus zahllosen Verfilmungen verbunden. Je berühmter die Serie wurde, desto bekannter sind auch ihre regionalen Bezüge geworden, und deshalb lohnt es sich, noch einmal an den Anfang zurückzugehen.
Das erste Kapitel von „Mörder ohne Gesicht“, dem im Original 1991, in deutscher Übersetzung 1993 erschienenen ersten Band der Wallander-Serie, beginnt auf einem zunächst nicht näher lokalisierten Bauernhof, wo einem alten Paar langsam klar wird, dass ihren Nachbarn etwas Schreckliches widerfahren ist. Das Kapitel endet mit einem Anruf bei der Polizei und wird mit zwei Präzisierungen abgeschlossen: „Es ist der 8. Januar 1990“ und: „Noch keine Spur von Morgendämmerung.“ Noch weiß man nicht, wo das Ganze spielt, und von Kurt Wallander hat man auch noch nichts gehört.
Das zweite Kapitel präzisiert die Zeitangabe noch weiter und lokalisiert das Geschehen in Ystad und dessen Umgebung, indem es ans andere Ende der Leitung springt und eine Ortsangabe zufügt: „Der Eingang des Telefongesprächs wurde von der Polizei in Ystad gegen 5.13 Uhr registriert.“ Wenig später wird Kommissar Wallander aus wilden Träumen geweckt, und über den alarmierenden Anruf eines alten Bauern informiert, der „Nyström heißt und in Lenarp wohnt“.
Mankell lässt uns an den Gedanken seines Helden teilhaben und legt damit den Keim einer vermeintlichen Vertrautheit mit Ystad und Umgebung, die seinen Helden und seine Leser fortan verbinden wird: „Wallander überlegte kurz, wo Lenarp genau lag. Nicht allzu weit weg von Marsvinsholm, in einem für schonische Verhältnisse relativ hügeligen Gebiet.“
 Wo Lenarp „genau“ liegt, erfährt man hier aber gerade nicht. Die Formulierung „Nicht allzu weit weg von Marsvinsholm“ erinnert vielmehr an die berühmte lateinische Lokalisierung der Varusschlacht „haud procul Teutoburgiensi saltu“ – also unweit des „Saltus Teutoburgiensis“, woraus später der „Teutoburger Wald“ gemacht wurde. Nach dem tatsächlichen Schlachtfeld aber hat man dort und an hunderten anderen Plätzen in Deutschland über Jahrhunderte hinweg vergeblich gesucht – und das gern in Gegenden, die man mit Mankell als für dortige „Verhältnisse relativ hügelig“ bezeichnen könnte.
Wo Lenarp „genau“ liegt, erfährt man hier aber gerade nicht. Die Formulierung „Nicht allzu weit weg von Marsvinsholm“ erinnert vielmehr an die berühmte lateinische Lokalisierung der Varusschlacht „haud procul Teutoburgiensi saltu“ – also unweit des „Saltus Teutoburgiensis“, woraus später der „Teutoburger Wald“ gemacht wurde. Nach dem tatsächlichen Schlachtfeld aber hat man dort und an hunderten anderen Plätzen in Deutschland über Jahrhunderte hinweg vergeblich gesucht – und das gern in Gegenden, die man mit Mankell als für dortige „Verhältnisse relativ hügelig“ bezeichnen könnte.
Nun gibt es dank Mankells Romanen und deren Verfilmungen zwar einen regelrechten Wallander-Tourismus zu dessen Wohnstraße, Polizeiwache und Lieblingscafé, der Ort Lenarp aber lässt sich in Südschweden laut der einschlägigen schwedischen Broschüre überhaupt nicht lokalisieren, weil er eine Fiktion ist. Vorlage für Mankells Doppelmord-Geschichte sei ein Überfall auf ein Bauernehepaar in Knickarb aus dem Jahre 1990 gewesen, heißt es dort.
Die durch ein paar Zeit- und Ortsangaben suggerierte Wirklichkeitsnähe lässt in Mankells Romanen überhaupt nach, je weiter man sich den Tatorten nähert, die überwiegend nicht in Ystad liegen. Die realistisch anmutende Präsenz dieses südschwedischen Provinzstädtchens hat nämlich eine durchaus antiregionalistische Funktion. Kommissar Wallander, der sich seine Sporen einst in der Großstadt Malmö verdient hatte, stellt in Ystad ein ums andere Mal fest, dass die Großstadtkriminalität ihm in die Provinz gefolgt sei: Die Unterschiede zwischen den Großstädten und dem Land würden bald völlig verwischt sein, klagt er. Die „umfassend organisierte Kriminalität“ lasse sich nicht einhegen. Ähnliches gilt für das allgegenwärtige Junkfood, mit dem Wallander sich dick und zuckerkrank frisst, statt sich auf schonische Spezialitäten zu beschränken, wie man es von einem anständigen Regio-Kommissar erwarten sollte.
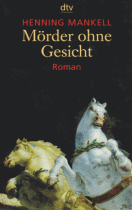 Man muss also nicht mehr wie Maj Sjöwall und Per Wahlöö nach Stockholm gehen, um der internationalen Kriminalität zu begegnen, lautet die These, doch das ist zumindest übertrieben. So übertrieben wie der Doppelmord in Lenarp, den Mankell aus jenem Raubüberfall in Knickarb gemacht hat. Diese Übertreibung aber lässt sich dadurch rechtfertigen, dass es ihm in „Mörder ohne Gesicht“ nicht nur um die Provinzialisierung der Schwerstkriminalität, sondern auch um die eskalierende Gewaltbereitschaft gegenüber Ausländern im friedlichen Hinterland ging. Auf den Doppelmord folgen Brand- und Mordanschläge gegen Asylbewerber. „Mörder ohne Gesicht“ war in diesem Sinne alles andere als ein Regio-, sondern ein Anti-Regiokrimi, bei dem die Lokalisierung keine Rolle mehr spielte. Dass Mankell an Wallander und Wallander an Ystad hängen geblieben ist, als die Fälle schon ein paar Nummern zu groß geworden waren, steht auf einem anderen Blatt.
Man muss also nicht mehr wie Maj Sjöwall und Per Wahlöö nach Stockholm gehen, um der internationalen Kriminalität zu begegnen, lautet die These, doch das ist zumindest übertrieben. So übertrieben wie der Doppelmord in Lenarp, den Mankell aus jenem Raubüberfall in Knickarb gemacht hat. Diese Übertreibung aber lässt sich dadurch rechtfertigen, dass es ihm in „Mörder ohne Gesicht“ nicht nur um die Provinzialisierung der Schwerstkriminalität, sondern auch um die eskalierende Gewaltbereitschaft gegenüber Ausländern im friedlichen Hinterland ging. Auf den Doppelmord folgen Brand- und Mordanschläge gegen Asylbewerber. „Mörder ohne Gesicht“ war in diesem Sinne alles andere als ein Regio-, sondern ein Anti-Regiokrimi, bei dem die Lokalisierung keine Rolle mehr spielte. Dass Mankell an Wallander und Wallander an Ystad hängen geblieben ist, als die Fälle schon ein paar Nummern zu groß geworden waren, steht auf einem anderen Blatt.
Ulrich Baron
Ulrich Baron, Jahrgang 1959, war Literatur- und Sachbuchredakteur in Bonn und Berlin, schreibt Rezensionen, Kritiken, Essays und Texte aller Art, findet Kriminalliteratur umso unterhaltsamer, je ernsthafter man sich über sie unterhalten kann, und mag keine Ersatz- und Füllstoffe im Krimi und anderswo.
Links zur Debatte: Klaus-Peter Wolfs Artikel zum Regiokrimi …, Carlo Schäfers Regiokrimiwettbewerb …, Thomas Wörtches Einschätzung …, daraufhin wieder Carlos … und Dirk Schmidt. Ein Artikel zum Thema von Christine Lehmann











