
Dichten? Nein. Ja. Zu Ulla Hahn und Horaz.
Achtung, Vorleser!
Unbestreitbar von literaturtheoretischer Wichtigkeit und mit einer breiten Rezeption die Poetik des Aristoteles[1], aber die des römischen Dichters Horaz ist voller Witz, Ironie, charmanten Frechheiten – zum Schmunzeln, zum Genießen, viel zu lernen. Surreal und höchst selbstkritisch. Aber was ist das? „Was die eigentliche Originalität der Ars Poetica gegenüber den anderen antiken Poetiken ausmacht, ist die Übersetzung von Dichtungstheorie in praktizierte Dichtung […].“[2] (Gott bewahre, ein Literat schreibt schön und angenehm und in Versen über Literaturtheorie … heute undenkbar?) Oder ganz einfach: ein phantastisches Gedicht, aber alles andere als einfach. Und wie aus dem echten (Literatur)Leben, z.B. – was ich als Student in Vorlesungen bisweilen auch erleiden musste: „Ein gnadenloser Vorleser, schlägt er Ungebildete und Gebildete in die Flucht; wen er aber ergriffen hat, hält er fest und bringt ihn um – durch Vorlesen, ein Blutegel, der nicht von der Haut lassen will – außer voll mit Blut.“[3] Bitte einmal das folgende Gedicht leise und dann sich oder anderen laut vorlesen, aber bitte so, dass Ihre Zuhörer und Zuhörerinnen nicht umfallen, wegrennen oder den Kontakt zu Ihnen abrechen:
Ulla Hahn
“Ars poetica
Nomina si pereunt, perit et cognitio rerum
Carl von Linné
Ja. Nein. Verantwortung. Gott
so viele Worte. Zu haus sein wo
man hingehört der große Weltatlas
finale Störungen Erlebnisdichtung die
rose is a rose is rose
An dieser Stelle muss nur noch Ich Erleberin
Adresse weltweit unbedeutend und beliebig
die Sonne scheint geh diesen Weg entlang
was täglich abfällt ist dein Material
Erzähl mir nichts vom Gehn steh auf und geh
Der Garten wartet Ostermelodie wo es sich dreht
gefiltert sublimiert und schön tief und hoch
prozentig destilliert Bewusstseinspoesie der alten Art die
Rose is a rose est una rosa
und würde ohne jeden Namen duften.“[4]

Fragende Kommentierung
Ars poetica
(Anspielung auf Aristoteles und Horaz?)
Nomina si pereunt, perit et cognitio rerum
(„Namen, wenn sie untergehen, dann geht auch unter die Erkenntnis der Welt und die Fähigkeit, dass Welt erkennen kann.[5])
Carl von Linné
Ja. Nein. Verantwortung. Gott
Entscheidungen sind gefordert: Ethik der Dichtung? Die vier Wörter wirken durch die Punkte wie Monumente. Laut vorgelesen, bleibt unklar, ambig, da kein Komma, ob Gott zur Aufzählung gehört, also nun von der Ethik zur Metaphysik, oder ob es sich um einen Vokativ handelt,[6] das Folgende verstärkend?)
so viele Worte. Zu haus sein wo
(Vier Wörter sind tatsächlich so viele Worte? Und vielleicht auf diese Weise zu haus sein: wo? Ein Enjambement in einen fortgesetzten Lokativsatz:)
man hingehört der große Weltatlas
(Ein Buch, das die Welt abbildet, nicht die Welt ist?)
finale Störungen Erlebnisdichtung die
(Final: der Tod? Kann Erlebnisdichtung eine Störung sein oder ist die nächste Zeile ein Beispiel für Erlebnisdichtung?)
rose is a rose is rose.
(… klein geschrieben, aber für ein Laut-Vorlesen kaum relevant: Ist die R/rose noch ‚deutsch‘ – wegen des Artikels – oder schon ‚englisch‘?)
An dieser Stelle muss nur noch Ich Erleberin
(Vom man zum Ich, welches erlebt. Das Abstraktum wird konkreter. Anspielung an Wilhelm Diltheys „Das Erlebnis und die Dichtung“?)
Adresse weltweit unbedeutend und beliebig
(Globalisiert, zuhause: überall-nirgends, marginalisiert, das bedeutende Ich unbedeutend, austauschbar. Ade, liebe Ich-Erleberin-Dichtung?)
die Sonne scheint geh diesen Weg entlang
(Beruhigend, die Natur; aber dann Unruhe durch den Imperativ: wer befiehlt wem dieses geh?)
was täglich abfällt ist dein Material
(Abfall, Alltäglichkeit als Material der Dichtung? Nicht mehr Gott oder Verantwortung?)
Erzähl mir nichts vom Gehn steh auf und geh
(Keine Reflexion mehr über das Gedichteschreiben. Schreib! Gedichte. Andere Ebene: Und Jesus heilte den Lahmen.[7] Übertragen: Wirf die Krücke der Theorie weg, geh und schreib Gedichte?)
Der Garten wartet Ostermelodie wo es sich dreht
(Der Garten Epikurs?[8] Das könnte einen Bezug zu Horaz herstellen. Oder wo Maria Magdalena im Johannes-Evangelium dem auferstandenen Jesus begegnet? Das würde die Ostermelodie nahelegen – und somit auch eine Referenz zu Goethes „Faust I“. Unheimlich dieses offene es – eine Umkehr? Eine Erhöhung, Auferstehung durch Kunst?)
gefiltert sublimiert und schön tief und hoch
(Wer filtert, die Dichterin? Zum Sublimen? Antike Rhetorik. Hoch: als Gegensatz zu tief und gleichzeitig Adverb zu …)
prozentig destilliert Bewusstseinspoesie der alten Art die
(Dichtung, Alkohol, Ekstase, Platons „Symposion“; Bewußtseynsphilosophie, schweres Wort,
Epoche des Idealismus, Hölderlin?, ‚old school‘. Auch eine alte Art, ausgestorben? Poetische Dinosaurier.)
Rose is a rose est una rosa
(Groß geschrieben: das erste Wort ist ein deutsches, oder schon Englisch? Zwei englische folgen, und dann in meiner Lesart Latein?)
und würde ohne jeden Namen duften.
(Gertrude Stein; und Umberto Eco: „Name der Rose“. Hier läge der Bezug zur komplexen Nominalismus-Debatte nahe, wieder schweres Wort; Wörter duften nicht, aber sie geben eine Erkenntnis von dem, was duftet, was schön, hoch und tief, alltäglich und Abfall ist. Und nun die Umkehr, die Um-Drehung in der letzten Strophe: Die Welt, pars pro toto hier als duftende Rose, wäre auch noch ohne Namen da. Aber wüssten wir überhaupt, was ‚duften‘ bedeutet, wenn wir es nie erfahren hätten? Mit dem Verschwinden der Namen: verschwände dann auch die Systematik der Dinge nach Carl von Linné?)

Nachschrift
Das waren Fragen an das Gedicht, von ihm provoziert, in ihm implizit angelegt, Fragen an die Poeta-docta-Ich-Instanz dieses Gedichtes, das fast wie ein Stichwortkatalog (in einer Bibliothek) wirkt. Überschriften-Aneinanderreihung. Expliziert könnte dieser Text Bände füllen. Welche Leser und Leserinnen braucht dieses Gedicht? Nicht unanspruchsvoll verlangt es eine Entfaltung und Kommentierung. Um dann noch einmal anders gelesen werden zu können. (Solch ein intellektueller Prozess kann auch eine Form des delectare sein; siehe dazu bitte unten.) Und es bietet gleichzeitig etwas Überraschendes, bei allem Respekt vor Theorie und Tradition, die zu wissen notwendig sind: Geh hin, schreib Gedichte! Wer auch immer die Sprecherin dieser Zeilen sein mag, sie zeigt zwar einen messianischen Gestus, aber streicht demütig ihren eigenen Text durch, der, eben nur eine Krücke, wegzuwerfen wäre. Eine Schwebe zwischen den zwei Seiten der Ars Poetica. Gedichte verfassen und über sie reflektieren können.
Dieser ianushafte, synthetisch-analytische Gestus baut eine Brücke zurück, zurück zu Horaz (ich wiederhole ein Zitat vom Anfang): „Was die eigentliche Originalität der Ars Poetica gegenüber den anderen Poetiken ausmacht, ist die Übersetzung von Dichtungstheorie in praktizierte Dichtung […].“[9] Die fast performativ zu nennende Ars Poetica von Horaz: Ein Hin und Her zwischen konkreter Alltäglichkeit und Literaturtheorie, zwischen Literaturpraxis und einem reflektierenden Werkstattbericht des Dichters. Alles gleichzeitig. Vielleicht sogar polyphon. Nietzsche über Horaz: „Bis heute habe ich an keinem Dichter dasselbe artistische Entzücken gehabt, das mir von Anfang an eine Horazische Ode gab. In gewissen Sprachen ist das, was hier erreicht ist, nicht einmal zu wollen.“[10] Dieses artistische Entzücken wäre die eine Seite von Horazens berühmter Definition:
„aut prodesse volunt aut delectare poetae
aut simul et iucunda et idonea dicere vitae.”[11]
(„Dichter wollen entweder nützen oder erfreuen
oder zugleich sowohl Nützliches als auch Angenehmes dem Leben künden.“ Übers. MP)

Ein (selbstbezügliches) prodesse als die andere Seite ist nun zu ergänzen, das zugleich als Paradigma des Dichterseins gelten kann: „Darum kann der Dichter ‚nützen‘ und ‚ergötzen‘, weil das Vollendete Sinn und Seele zugleich erfreut. […] Dichtung kommt also aus der Welt (nicht aus Hirngespinsten) und soll für die Welt geschaffen werden. Horaz stellte an sich am Ende seines Lebens den höchsten Anspruch: Verpflichtende Rechenschaft abzulegen über seines Lebens Würde und Werk, Rechenschaft letztlich dem Gott Apoll gegenüber.“[12] Also die Welt, das was täglich abfällt … und das kann auch göttlich sein.
Mit diesem Versuch zu Ulla Hahn wollte ich einen anderen Weg einschlagen, als die unselige Frage zu beantworten, was denn uns die Dichterin sagen wollte. Natürlich, dieses Gedicht. Was sonst? Als ob Dichterinnen und Dichter per se inkompetent wären, Etwas richtig zu sagen, und nur Gedichte schreiben können, und zwar an einem gewissen Etwas irgendwie vorbei komponiert. Julia Zeh beschreibt dieses (Tradition gewordene) Missverständnis:
„[… D]er real existierende deutsche Deutschunterricht, respektive der sich – glücklicherweise! – als Literaturvermittlung begreifende deutsche Deutschunterricht der Sekundarstufe Zwei zeichnet für die Erfindung eines parapsychologischen Phänomens verantwortlich, das man ‚Autorenintention‘ nennt. Die Autorenintention wird, und das ist das Parapsychologische daran, nicht vom Autor, sondern vom Deutschlehrer hervorgebracht. Dreh- und Angelpunkt ist die Gretchenfrage folgenden Wortlauts […]: ‚Was will uns der Autor damit sagen?‘ Die Frage beinhaltet die Grundpfeiler eines literarischen Weltbilds, das den Deutschkurs längst verlassen, die Germanistik erobert oder vielleicht sogar hervorgebracht hat […].“[13]

Als ich in meiner Zeit als Gymnasiallehrer eine neue Oberstufenklasse in Deutsch bekam, frugen mich die Schüler/innen vor einer Lyrik-Klausur, ob sie denn zum Autor JWG (er möge hier anonym bleiben) meine Interpretation, also die des Lehrers, schreiben sollten – das hätte so der Vorgänger gemacht. Wohl einer der effizientesten Wege, maximalst (obwohl schon im Lateinischen Superlativ) den Zauber, das Geheimnis, die Schönheit von Gedichten zu eliminieren. Nun ließe sich fragen, wie viel Projektion, Ideologie oder krasser: Gewalt werden so der Autonomie und Fremdheit eines Kunstwerkes angetan? (Das ist keinesfalls gegen notwendige Theoriebildung geschrieben, sondern gegen Theorien, die nur als Masken für andere Interessen fungieren.) Was wären gute Theorien? „Theorie zu lesen schult so gesehen den selbstreflexiven Begriff auf vorausgesetzte Frames und Paradigmen und stärkt so die emanzipatorische Kraft des Misstrauens.“[14]
Vielmehr stellt sich mir die Frage: Was kann dieses Gedicht in mir auslösen? Welche Gedanken- und Gefühlsprozesse? Und für mich persönlich gilt: Will ich mit diesem Gedicht leben? Tage, Monate, Jahre? Ulla Hahns Gedicht thematisiert exemplarisch und kursorisch eine Ars Poetica-Tradition, um sich in sie einzureihen, sie in Frage zu stellen – und das äußerst knapp, eben verdichtet – noch verdichteter als Horaz mit seinen 476 funkelnden Versen. Ulla Hahns Text scheint mir eher einem „prodesse“ verpflichtet, ist verkürzter Theorieüberblick, in Strophen formatiert – als wäre es ein Gedicht. Oder eine Anleitung zum Gedichtschreiben? Oder doch nur Form: nuda nomina tenemus[15]? Das folgende Gedicht von Tomas Tranströmer liest sich meiner Meinung nach wie eine poetische Umsetzung von Hahns Poetica, ohne dass ich eine direkte Beeinflussung ausmachen könnte:
„Espresso
Der schwarze Kaffee auf der Terrasse
mit Stühlen und Tischen prächtig wie Insekten.
Es sind kostbar aufgefangene Tropfen,
gefüllt mit der gleichen Kraft wie Ja und Nein.
Er wird aus dunklen Cafés hinausgetragen
und blickt in die Sonne, ohne zu blinzeln.
Im Tageslicht ein Punkt von wohltuendem Schwarz,
das schnell in einen bleichen Gast ausfließt.
Er ähnelt den Tropfen aus schwarzem Tiefsinn,
die bisweilen von der Seele aufgefangen werden,
die einen wohltuenden Stoß geben: Geh!
Inspiration, die Augen zu öffnen.“[16]
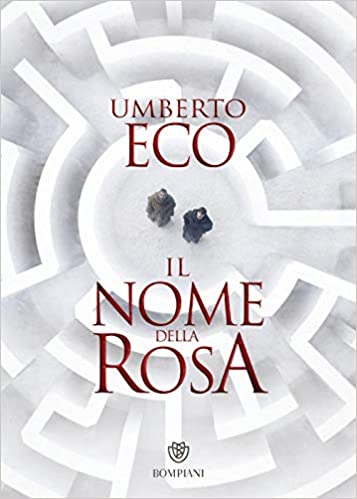
Abschied
Und zum Schluss das berühmte Zitat vom Ende des Umberto Eco-Romans „Il nome della rosa“: „stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.“[17] (Es steht eine vergangene Rose nur noch dem Namen nach, nur noch nackte Namen haben wir. Übers. von mir). Signifikanten ohne Signifikate? Ein Verweis zum Carl von Linné-Zitat, das Ulla Hahn ihrem Gedicht voranstellt? Das Gedicht wendet dies um, wo es sich dreht, fast wie die Geste eines Haikus. Unabhängig, in welcher Sprache formuliert: die Rose ist eine Rose. Von der wir uns jetzt mit Horaz verabschieden: „Junge, ich hasse Luxus. […] Lass das Suchen, wo in aller Welt spät noch eine Rose weilen könnte. Bitte, füg’ der einfachen Myrte nichts eifrig hinzu: weder dir als Mundschenk ist unschicklich Myrte noch mir, wenn ich unter dichtem Wein trinke.“[18] (Anm.: Gemein, dieser Wein, könnte sein sowohl ein Dativ und Nicht-Akkusativ als auch ein Nicht-Dativ und Akkusativ. Hysteron proteron:)
Ausblick
Mich begleitet seit Wochen ein Satz von Werner Heisenberg, dessen Folgen für die Dichtung immer noch kaum auslotbar scheinen. In seinem Text „Sprache und Wirklichkeit in der modernen Physik“ verweist er auf die Paradoxien der Quantenlogik: „Denn im täglichen Leben könnten wir uns schlechterdings nicht vorstellen, was eine Mischung zwischen dem Fall, daß hier ein Tisch steht, oder dem anderen, daß hier kein Tisch steht, überhaupt bedeuten solle.“[19] Das wäre der Ansatzpunkt für eine ars poetica quantumphysica.
Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg. Seine Texte bei uns hier.
[1] Siehe dazu Aristoteles: Poetik, gr./dt., übers. u. hg. v. M. Fuhrmann, Stuttgart 2001.
[2] E. Schäfer: Nachwort, in Horaz: Ars Poetica. Die Dichtkunst, lat./dt., übers. u. hg. v. E. Schäfer, Stuttgart 2005, 55-67, hier 67.
[3] Übersetzung von mir nach Horatius. Opera edidit D. R. Shackelton Bailey, (Paperback) Berlin 2008 (Ars Poetica, Verse 474-476).
[4] U. Hahn: Gesammelte Gedichte, München 2013, 477. Zu den Artes poeticae Ulla Hahns siehe auch T. Anz: Literatur als Spiel. Ulla Hahns postmoderne Ars poetica, in Gedichte und Interpretationen, Bd. 7: Gegenwart II, hg. v. W. Hinck, Stuttgart 2011, 195-203.
[5] Diese freiere Übersetzung von mir schien notwendig, um die Ambiguität von genitivus subiectivus und obiectivus zu entfalten.
[6] Eine weitere Beobachtung: In diesem Gedicht kommt als rhetorisches Prinzip an verschiedenen Stelle ein ‚syntaktisch‘ und ‚semantisch kompliziertes Zeugma‘ vor; nach H. Lausberg: Elemente der literarischen Rhetorik, 7. Aufl., München 1982, 105. Deshalb auch die herausfordernde Zeichensetzung oder deren Ausbleiben?
[7] Siehe dazu Mk 1, 44 und 2,11.
[8] Siehe dazu auch B. Kytzler: Horaz. Eine Einführung, Stuttgart 1996, 33: Horaz „[…] bekannte sich vielmehr zu den ‚Gärten‘ des Epikur […]. Man darf darin nicht ein ungehemmtes genußsüchtiges ‚Epikuräertum‘ sehen, wie es nicht selten in der Moderne mißverstanden wird. Vielmehr ist es die Ruhe des Gemüts […], die jenen Kern der Gedanken bildet, dem Horaz folgt.“
[9] E. Schäfer, Nachwort, in Horaz: Ars Poetica. Die Dichtkunst, lat./dt., übers. u. hg. v. E. Schäfer, 55-67, hier 67.
[10] F. Nietzsche: aus Götzen-Dämmerung, in: Ders.: Werke II, hg. v. K. Schlechta, Darmstadt 1997, 1027.
[11] Horatius: Opra (s. Anm. 3), Ars Poetica, 333 f. Siehe auch M. Fuhrmann: Dichtungstheorie der Antike. Aristoteles – Horaz – ‚Longin‘, 2. Aufl., Darmstadt 1992.
[12] G. Maurach: Horaz: Werk und Leben, Heidelberg 2001, 480.
[13] J. Zeh: Treideln, 2. Aufl., München 2015, 76 f.
[14] S. Michel: Die Unruhe der Bücher. Vom Lesen und was es mit uns macht, Stuttgart 2020, 57.
[15] Zur Quelle dieses Zitates s. Anm. 17.
[16] T. Tranströmer. Sämtliche Gedichte, übers. v. H. Grössel, München 1997, 65.
[17] U. Eco: Il nome della rosa, Milano 2014, 576. Zum Zitat siehe auch Ders.: Postille a „Il nome della rosa“, aaO., 577-618, hier 580.
[18] Ode I, 38. Übersetzung von mir nach Horatius. Opera edidit D. R. Shackelton Bailey, (Paperback) Berlin 2008, 41.
[19] W. Heisenberg: Gesammelte Werke. Abteilung C, Bd. II, hg. v. W. Blum u. a., München 1984, 300.











