Götterdämmerung: „The Wire“ und „Battlestar Galactica“. Ein Essay
von
Markus Pohlmeyer
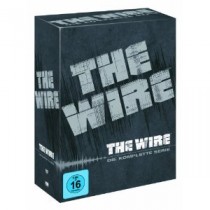 „The Wire“
„The Wire“
Meine absolute Lieblingsserie ist zurzeit „The Wire“ (2002–2008). Unvorstellbar, wie mein mediales Leben nach dem Ende der 5. Staffel weitergehen soll. Seufz! Das kann auch „Fringe“ mit seinem Paralleluniversum nicht raushauen.
Worum geht es? Um Baltimore: Drogen, Polizei, Hafen, Rathaus und Schule. In den postmodernen Ruinen einer untergehenden Weltmacht bewegen sich menschliche Ruinen. Gut Cop, böser Cop, guter Gangster, böser Gangster (meistens Farbige). Alle können alles sein. Beispielsweise bricht ein Schüler für seinen Mathematiklehrer dessen Auto auf – und das macht er sehr professionell –, weil dieser (ein ehemaliger Polizist, der ‚aus Versehen‘ schon andere Menschen erschossen hatte) seinen Schlüssel darin vergessen hat (Staffel 4). Humorvoll. Ironisch.
Wie „The Wire“ erzählt, ist einfach genial: von komplexen Handlungssträngen, über mehrere Episoden und Staffeln sukzessive aufgebaut, bis hin zu sprachphilosophischen Spielereien. Der rebellische, dem Alkohol und den Frauen zusprechende McNulty und sein rundlicher, dem Alkohol und den Frauen zusprechender Partner ‚Bunk‘ beispielsweise klären in Staffel 1 einen Mordfall auf, indem sie minutenlang nur das Wort „Fuck“ (tonal) variieren – aber auf der Handlungsebene kriminaltechnisch brillant das Problem knacken. Fast alle sprechen in mehr oder weniger ausgefeilten Metaphern, die aus dem Bereich ‚unter der Gürtellinie‘ stammen; und damit wäre schon fast das obere rhetorische Niveau erreicht. Die Sprache bildet die Alltagsrealität ab: kalt, brutal und entfesselt, eben ein großer Fuck – und ist doch trotz ihrer Reduktion und Redundanz in der Lage, Situationen treffend zu beschreiben.
http://www.youtube.com/watch?v=qlZGguSrp18
Die Hölle ist aber das, was die Drogen aus den Menschen und Baltimore machen. Und Dollars sind die Währung des Todes. Gewisse Kreise der Politik (korrupte Bauunternehmer eingeschlossen) nehmen gerne das Geld gewisser Drogenbosse: als Wahlkampfspenden, Formularbearbeitungsbeschleunigungshilfe oder so. In Staffel 3 entsteht aus der Verzweiflung eines Majors heraus eine (experimentelle) Drogenfreihandelszone („Hamsterdam“), um das Geschäft in einem unbewohnten Gebiet zu bündeln und somit die Kriminalität in anderen Teilen der Stadt zu senken. Das Experiment funktioniert, der Major wird jedoch suspendiert, die Uhr zurückgedreht. Diese Zone jedoch wirkt nachts wie eine postapokalyptische Welt, in der Menschen oder das, was von ihnen übrig blieb, wie Gespenster durch Dunkelheit und Feuer taumeln: ein Weltenbrand. Der Mensch – die Götter sind schon längst entzaubert – wird zum neuen Schöpfer des Jüngsten Tages, hier und jetzt, und immer wieder.
Absurd, tragisch und komisch zugleich, wie ‚Stringer‘ Bell, der Stellvertreter eines Drogenbosses, verzweifelt versucht, den Drogenhandel in ein modernes wirtschaftliches Unternehmen zu verwandeln, und dabei an der Korruption der Politik und der archaischen Dummheit und Brutalität seiner Kollegen scheitert. Während einer Sitzung beispielsweise von Gangstern erwischt er einen seiner Leute, wie er Protokoll führt – genau eben wie in der richtigen Wirtschaft, nur das ‚Stringer‘ regelrecht austickt und ihn darauf hinweist, dass es sich doch um eine Versammlung von Verbrechern handele (Staffel 3). ‚Stringer‘ Bells Motivation ist, freizukommen von den Gewaltverstrickungen der Drogenszene (und dem drohenden Gefängnis), nur noch Geld abziehen ohne Mord und Straßenkampf. Auch der Polizist McNulty versucht (in Staffel 4) freizukommen: von seinen Alkoholexzessen und seinen Frauengeschichten (gleichzusetzen mit Bindungsunfähigkeit). Bei ‚Bunk‘ stößt das auf Verständnislosigkeit. Einige engagierte Lehrkräfte versuchen, ihre Schüler und Schülerinnen aus den Mechanismen der Drogenszene herauszuholen oder zu verhindern, dass sie sich darin weiter verstricken. Und immer wieder kollabieren all diese Bemühungen, weil die familiären (oder beruflichen) Strukturen kein Ausbrechen erlauben – schicksalhaft wie in einer griechischen Tragödie. Die wenigen, die in dieser Serie aus Idealismus oder Einsicht ausbrechen wollen, ob weißer Polizist oder farbiger Drogendealer, scheitern immer wieder an der Statik anderer Charaktere und der Statik des Systems. So entsteht durchaus der Eindruck unsichtbarer, aber sehr wirkmächtiger Kasten.
In diesem Spiel gewinnt weder gut noch böse; was bleibt, sind hier und da Gesten der Menschlichkeit. In Baltimore ist Gott wirklich tot, abgeknallt, war halt zur falschen Zeit an der falschen Ecke. Das Grauen ist die Normalität. Man hat sich damit arrangiert. Kein moralischer Zeigefinger, nur Beschreibung, Darstellung. Resignation und Entsetzen entstehen, wenn bestimmte Figuren in diesem Strudel des Wahnsinns innehalten, wenn sie anfangen zu sehen, und wir es in ihren Gesichtern ablesen können. Das sind Momente blanken Horrors. Aber es auch gibt Momente stillen Humors, z.B. in Staffel 4: Carcetti, der neue Bürgermeister in spe, besucht die Mordkomission: alle tun beschäftigt und halten sich krampfhaft an Akten fest. Carcetti ermuntert, er sei doch nicht ihr Kindermädchen. Darauf legt „Kima“ ihre Akte weg und die Füße auf den Schreibtisch; ihr Chef zückt sein Pornoheftchen und Lester bastelt weiter an seinen Miniaturmodellen aus Holz, die er teuer verkauft. Bei einem Mordfall sei das aber alles anders. Smiley.
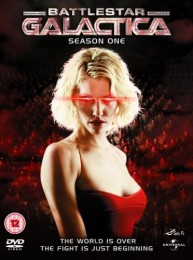 „Battlestar Galactica“
„Battlestar Galactica“
Es gibt noch eine Serie, die ich sehr vermissen werde, die Neuauflage von „Battlestar Galactica“ (2003–2009), vielleicht die beste Science Fiction-Serie der letzten Jahre. Menschen (der 12 Kolonien) schaffen Maschinen (die Zylonen), Maschinen rebellieren gegen die Menschen, Maschinen jagen Menschen durchs All. So die Kurzfassung der Handlung. Jenseits des gigantischen Militarismus entwickelt sich die Serie zu einer Art Fallstudie: Wie reagieren Menschen unter Bedingungen der Verfolgung? Welche politischen Systeme bauen sie nach der Zerstörung ihrer Heimat auf? Warum haben die Zylonen/Maschinen/Roboter eine Religion, eine Form von Monotheismus entwickelt? (Polytheismus dagegen auf der Seite der von Kobol stammenden Kolonien.) Warum wollen einige dieser Zylonen wie Menschen sein? Und verbünden sich gar mit ihnen?
Ich möchte nur auf die letzte Folge der letzten Staffel eingehen, die wie ein Schlüssel alles Vorhergehende erschließt. Diese Folge ist selbst Teil einer abschließenden Minitrilogie mit dem deutschen Titel „Götterdämmerung“. Die Suche nach der vermeintlich neuen Erde hatte sich zuvor als erfolglos erwiesen. Der Planet war schon durch einen Atomkrieg vernichtet worden. Alles auf der zerfallenden „Galactica“ geht in Resignation unter, bis Admiral Adama sich dazu entschließt, ein von den Zylonen entführtes Hybrid-Kind (menschlicher Vater, zylonische Mutter) aus der Basis der Maschinen zu befreien. Bombastische Schlacht, otpischer Overkill, die „Galactica“ rammt die Basis, zum Schluss Nuklearwaffen. Das Kind wird befreit, die „Galactica“, kurz vor dem Kollaps, kann entkommen, springt ihren letzten Sprung, geleitet durch die Vision von der Pilotin Kara, springt zu unserer Erde. Diese Erde (Landeziel in Afrika) ist vorgeschichtlich; auf ihr leben Urmenschen, die sich als genetisch kompartibel mit den Ankömmlingen erweisen. Zufall?
Auf zwei Szenen möchte ich verweisen, die religiös hochaufgeladen sind. Es gibt eine großen Abschied: Adama möchte mit der sterbenden Präsidentin, seiner großen Liebe, aufbrechen und verabschiedet sich von seinem Sohn Lee und der Pilotin Kara. Lee weiß, dass er seinen Vater nie mehr sehen wird. Er unterhält sich darüber mit Kara und in diesem Gespräch fokussiert die Kamera immer mehr auf Lee, während er begeistert davon schwärmt, diese neue Welt zu erkunden, bis er sich auf einmal umdreht, um Kara anzusprechen. Aber sie ist nicht mehr da. Einfach so. Rückblenden aus der Zeit vor der Flucht werden eingespielt: Lee und Kara, die mit Lees Bruder verheiratet war, hätten beinahe miteinander geschlafen. (Sie beide waren das Liebespaar in der Serie, das nicht zusammen sein sollte.) Und am nächsten Morgen fliegt eine Taube aus Lees Zimmer. Ich lese das als eine implizite Trinität: Der Vater (Schöpfer und gleichzeitig Anspielung auf Adam, den ersten Menschen), die Auferstandene (Kara als Jesus; provokativ: eine ‚trinitarische‘ Frau. In einer früheren Folge entdeckte Kara ihr abgestürztes Schiff mit ihrer Leiche, ist aber unfähig, dies alles zu deuten) und der Heilige Geist (die Taube), der hier in der linearen (nicht temporalen) Sequenz des filmischen Erzählens auch mit der neutestamentlich Erzähllogik (Gott-Vater, Jesus Christus, Sendung des Heiligen Geistes) sehr gut korrespondiert. Diese Szene kann man auch als Erinnerung von Lee verstehen, der rückblickend begreift, warum damals die Taube aus seinem Zimmer geflogen ist: sie wird nämlich auch zu einer Allegorie für Kara und seiner Liebe zu ihr: beides muss er loslassen. Damals und jetzt. Kara ist auch der Engel, der nach dem Exodus die Arche „Galactica“ in das gelobte Land führt. Ihre Mission endet mit einer Himmelfahrt.
Wenn man diesen religiöse Subtext ausblendet, dürfte es meiner Meinung nach sehr schwierig sein, diese letzte Folge von „Battlestar Galactica“ konsistent zu deuten, einer Serie, welche die Ebenen der Weltraumschlachten verlässt und sich am Ende in ein Schöpfungs- und Erlösungsdrama verwandelt. Verwirrend: Die Geschichten vieler Hauptdarsteller werden abgebrochen, nicht zu Ende erzählt. Das letzte Bild z.B. von Lee: er steht in der Steppe. Das letzte Bild von Adama, von oben gefilmt: er sitzt auf einem Hügel, schaut in die beeindruckende Landschaft, neben ihm das Steingrab seiner Liebe. Und die anderen splitten sich in Gruppe auf, besiedeln diese neue Welt. Auch wurde beschlossen, die Flotte in der Sonne zu zerstören. Diesmal soll alles anders werden. Der radikale Verzicht auf Technologie.
150 000 Jahre später treten in New York zwei Protagonisten auf, die schon Doppelgänger auf der „Galactica“ hatten (Projektionen? Wieder Engel? Reinkarnationen?): die schillernde Figur des Dr. Baltar und das Zylonen-Modell Nr. 6 (die Zahl steht auch mehrdeutig für ihr ästhetisch-erotisches Design und Agieren). Sie lesen in einer Nachricht, dass man in Afrika die mitochondriale Eva (Mutter aller Lebendigen) gefunden habe. Beide wissen, diese „Eva“ war das Messias-Kind, abstammend von einem Menschen und einer Zylonin. Und jetzt eröffnet sich der Blick in ein zyklischen Gesamtkonzept: all diese Kriege und all diese Untergänge von Zivilisationen (der Menschen wie auch der Zylonen) scheinen sich schon oft wiederholt zu haben – und damit auch bestimmte religiöse Muster, die in dieser Serie einen universalen Status erhalten und nicht mehr nur als singulär zu deuten wären. Baltar: „Kobol, die Erde, die echte Erde vor der hier. Caprica vor der Vernichtung.“ 6: „All dies ist schon mal geschehen.“ Aber Baltar stellt dann die Frage, ob all dies wiedergeschehen müsse. 6 dagegen ist optimistischer: das Überraschende in einem sich wiederholenden komplexen System gehöre auch zu Gottes Plan. Darauf Baltar, megacool mit seiner schwarzen Sonnenbrille, aber bitterernst: „Du weißt, ER hat was gegen diesen Namen!“ Also alles doch kein Zufall?
„The Wire“ und „Battlestar Galactica“ arbeiten mit zyklischen Konzepten, was typisch für Mythen ist, für diese uralten und neuen Welterklärungsgeschichten, die das Immer-Da und Immer-Schon deuten wollen. Mythen spielen in einer Zeit vor unserer Zeit, sie begründen diese, wie auch „Battlestar Galactica“ unsere genetische Herkunft einsichtig machen will. „The Wire“ dagegen zeigt, warum eine existierende Zivilisation stirbt. Auf der einen Seiten die ständige Zerstörung von Welten und Kulturen – in kosmischen Dimensionen –, aber mit einem Funken Hoffnung, vielleicht irgendwann doch aus diesem Muster ausbrechen zu können. Auf der anderen Seite der Einblick in eine Mikrodimension: der nie zu gewinnende Kampf der Polizei gegen die Kriminalität in Baltimore; ist der eine Drogenboss von der Bildfläche verschwunden, kommt schon der nächste, brutalere. Und die Korruption in der Politik bleibt einfach unschlagbar. Und überholt sogar ‚Stringer‘ Bell mit links. Wie 6 anmerkte: Konsum, Dekadenz etc. Dennoch haben die Beispiele aus Baltimore archetypischen Charakter: die Motive und Konstellationen sind uralt und anthropologische Konstanten, die ein negatives Menschenbild zeichnen, geprägt von Gewalt und Gier.
Markus Pohlmeyer
lehrt an der Universität Flensburg (Schwerpunkte: Religionsphilosophie; Theologie und Science Fiction).
Hinweise:
Die Film-Zitate sind entnommen aus: Battlestar Galactica. Season 4.2; Disc 3; Film © 2008/2009 Universal Studios.
James F. McGrath: Robots, Rights, and Religion, in: Ders. (Hg): Religion and Science Fiction. Pickwick Publications 2011. 118–153.
Zur mitochondrialen Eva vgl. die kritische Darstellung von Luigi Luca Cavalli-Sforza: Gene, Völker, Sprachen. Die biologischen Grundlagen unserer Zivilisation. Aus dem Italienischen von G. Memmert. München – Wien 1999. 98–102.











