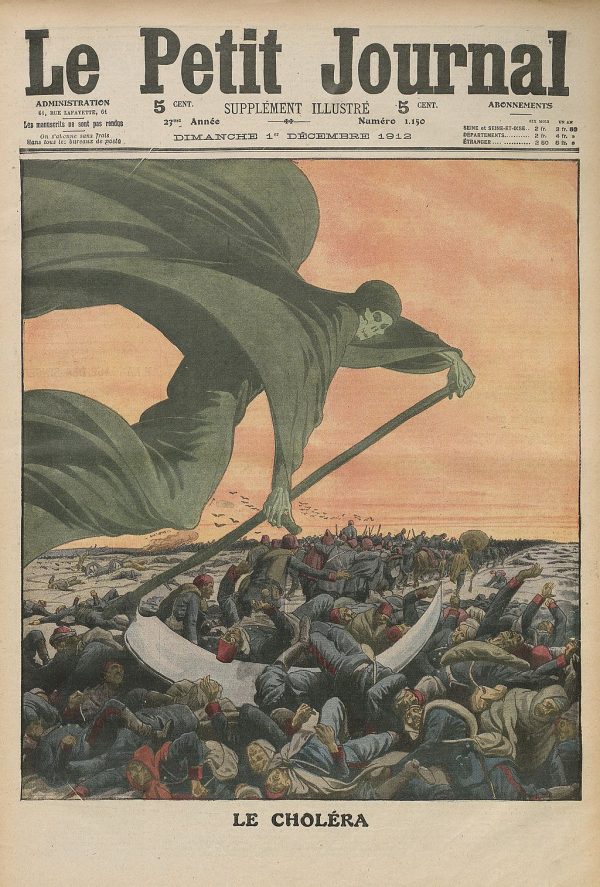
Sachbücher, kurz und bündig
Sekundärliteratur ist unerlässlich, wenn man nicht nur konsumieren will. Alf Mayer (AM) war im Revier unterwegs.
Christina Lamb: Unsere Körper sind euer Schlachtfeld. Frauen, Krieg und Gewalt
Tyler Maroney: The Modern Detective: How Corporate Intelligence Is Reshaping the World
Benjamin Moser: Sontag. Die Biografie
In den nächsten Tagen folgen hier noch Besprechungen von:
Bruno Cabanes (Hg.): Eine Geschichte des Krieges
Harald Jähner: Wolfszeit. Ein Jahrzehnt in Bildern. 1945 – 1955
Franziska Richter (Hg.): Echoräume des Schocks. Wie uns die Corona-Zeit verändert
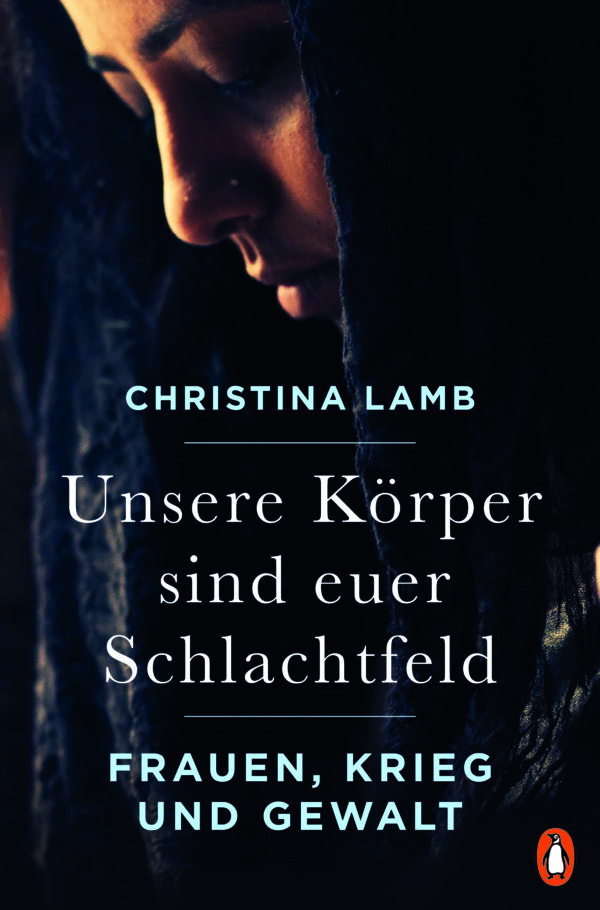
Die schäbigste Waffe, die es gibt
(AM) Es ist ein globales Thema, erschreckend wenig beachtet. Solange wir darüber schweigen, machen wir uns mitschuldig, denn wir sagen damit, es sei hinnehmbar. Eben deshalb ist es das am meisten vernachlässigte Kriegsverbrechen der Welt. Bis heute braucht man nicht alle Finger einer Hand, um die Gerichtsverfahren wegen Kriegsvergewaltigung zu zählen. Diese Verbrechen gehen ungestraft, werden als Nebensache abgetan. Aber das sind sie nicht. Christina Lamb, Auslands-Chefkorrespondentin der britischen „Sunday Times“ und langjährige Kriegsreporterin setzt jetzt mit ihrem Buch Unsere Körper sind euer Schlachtfeld. Frauen, Krieg und Gewalt ein Flammenzeichen. Sie weiß, dass ein Buch Kriegsvergewaltigungen nicht ausmerzen kann, aber sie will einen Anfang machen. Dazu gibt sie Frauen und Mädchen eine Stimme, die Verheerendes erlebt haben und erdulden mussten. Sie zeigt, was der Krieg mit Frauen macht. Was Männer im Krieg mit Frauen machen. (Und ja, für die Haarspalter, das Buch verschließt die Augen auch nicht vor der sexuellen Gewalt, die Männern in Krieg und Bürgerkrieg und autoritären Regimen angetan wird.)
Vergewaltigungen im Krieg sind Teil unserer kulturellen Identität, man braucht nur die großen Kunstmuseen der Welt besuchen oder in den Klassikern blättern. In Homers „Ilias“ verspricht der griechische General Agamemnon seinem Freund Achilles Frauen im Überfluss, wenn er Troja einnähme: „Die Götter geben, dass wir die große Stadt des Priamos zerstören, … troische Frauen zwanzig soll er sich selbst auswählen.“ Die Fehde zwischen den beiden Männern entsteht, weil sie sich über eine solche weibliche „Beute“ streiten. Vergewaltigung und Plünderung sind seit altersher Mittel zur Entlohnung unbezahlter Rekruten und Unterjochungs-Strategie. Die Römer prägten dazu den Ausspruch „vae victis“ (Wehe den Besiegten).
„Die Entdeckung des Mannes, dass seine Genitalien als Waffe zu gebrauchen sind, um damit Furcht und Schrecken zu verbreiten, muss neben dem Feuer und der ersten groben Streitaxt als eine der wichtigsten Entdeckungen in prähistorischer Zeit angesehen werden“, meinte die US-Autorin Susan Brownmiller 1975 in ihrer Dokumentation zum Thema Vergewaltigung „Gegen unseren Willen“. Als Christina Lamb begann, als Journalistin in Kriegsgebiete zu gehen, dachte sie noch, „als Frau wäre man in Kriegsgebieten sicherer, es gäbe so etwas wie einen Ehrenkodex gegenüber Frauen. Aber unter Terrorgruppen und Söldnern des Bösen gibt es keinen Ehrenkodex. Ganz ohne Zweifel ist es in vielen unserer heutigen Konfliktzonen sogar gefährlicher, eine Frau zu sein. Während der vergangenen fünf Jahre habe ich in vielen Ländern mehr schockierende Brutalität gegenüber Frauen erlebt als in über 30 Jahren als Auslandskorrespondentin.“ Den Prolog dieses wichtigen Buches gibt es in dieser Ausgabe als Textauszug nebenan.
Christina Lamb: Unsere Körper sind euer Schlachtfeld. Frauen, Krieg und Gewalt (Our Bodies, Their Battlefield: What War Does to Women, 2020). Aus dem Englischen von Maria Zettner, Friedrich Pflüger, Heike Schlatterer, Anja Lerz und Karin Schuler. Penguin Verlag, München 2020. 446 Seiten, 24 Euro.
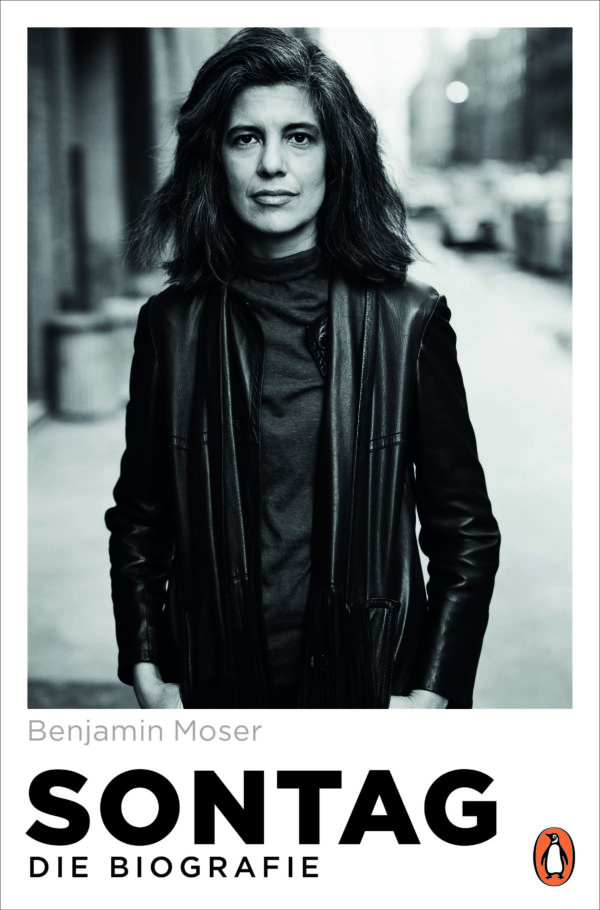
Arbeit am Mythos
(AM) Sie war eine Hoffnungsträgerin für alle, die meinen, Kultur sei es wert, verteidigt zu werden. Sie war eine Intellektuelle, selbst bei denen anerkannt, die nichts über Intellektuelle wissen. Kein Autor, keine Autorin war öfter in „Rolling Stone“ vertreten als sie. Sie war das Jahr 1968, zur Instanz geworden. Sie war der Archetypus des „public intellectual“. Sie war eine Metapher. Mit drei Jahren konnte sie lesen, mit sechs schreiben, machte das Abitur mit 15, war mit 16 zu Gast bei Thomas Mann – und gelangweilt – , heiratete mit 17 einen Akademiker, ging mit 26 nach New York. Wurde zur Ikone.
„Sie machte Ernsthaftigkeit cool. Sie machte Snobismus sexy. Sie war New York City. Sie war das Zentrum der Welt. Sie war Artaud, Bresson, Sebald, Cioran, Canetti und Weil. Sie rauchte in Bars mit deinen Freunden, redete bis zum Morgengrauen und war ganz hingerissen von der Vorstellung, dass sie die Hochkultur so promiskuitiv gemacht hatte. Sie war die sachkundige, differenzierte Meinung, mit der man auf Partys die Umstehenden beeindruckte. Und zwar zu jedem erdenklichen Thema: wie camp alles, womit es in Kontakt kommt, mit Anführungszeichen versieht („nicht eine Lampe, sondern eine ›Lampe‹, nicht eine Frau, sondern eine ›Frau‹“, lautet einer ihrer berühmtesten Sätze) – so Johanna Hedva im „Merkur“.
Sontag. Die Biografie ist der erste große Versuch, dieser ungemein schillernden, wahnsinnig produktiven Gestalt habhaft zu werden. David Rieff, Sontags Sohn, und ihr Agent Andrew Wylie wählten zusammen dafür den 1976 geborenen Benjamin Moser aus, der 2009 mit „Why This World“, der Biografie von Claire Lispector, bekannt geworden war. Moser erhielt Zugang zu Sontags Archiv und Einblick in Dokumente, die noch für Jahrzehnte unter Verschluss sein werden. Die Materialfülle, die er für seine Aufgabe zu erfassen hatte, ist schier unglaublich. Als Ariadnefaden wählte er sich einen chronologischen Faden, das funktioniert. Susan Sontags Leben, das ist ein Dreiviertel-Jahrhundert politischer, kultureller, künstlerischer und intellektueller Geschichte in Amerika und Europa, das sind mehr als ein Dutzend belletristischer und essayistischer Bücher, dazu Filme und Theaterinszenierungen, ein komplexes und kompliziertes Sozial- und Liebesleben, Jahrzehnte von Kampf gegen drei Krebserkrankungen – ein volles, pralles Leben.
Eine der Stärken von Susan Sontag lag darin, so vermerkt es Benjamin Moser, „dass alles, was von anderen über sie gesagt werden konnte, zuerst und am besten von Susan Sontag gesagt wurde. Ihre Tagebücher zeigen ein unheimliches Verständnis für ihren Charakter, eine Selbsterkenntnis, die – auch wenn sie im Alter nachließ – ihrem chaotischen Leben einen festen Halt gab.“ – Nebenan in dieser CulturMag-Ausgabe ein Textauszug, wie Susan Sontag, damals in Berlin, den 11. September 2011 erlebte.
Benjamin Moser: Sontag. Die Biografie (Sontag: Her Life and Work, 2019). Aus dem Amerikanischen von Hainer Kober. Penguin Verlag, München 2020. 924 Seiten, mit 32-seitigem Bildteil, 40 Euro.

Wenig betretene Welt
(AM) Wir glauben und argumentieren gerne, dass der Kriminalroman die Welt abbildet. Die ganze Welt, die ganze Wirklichkeit. Aber dem ist nicht so. Unsere Privatermittler haben tausend Besonderheiten, sind linkshändig lesbisch, rechtshändig fußamputiert blind oder männlich taubstumm schwul. Das Genre des Privatdetektivs wurde wieder und wieder totgesagt und wiederbelebt, sein Zeitalter als überholt deklariert und gleichzeitig in die Science Fiction gespiegelt. Einer der ältesten Hüte im Gewerbe ist der von Humphrey Bogart & Co, der als Philip-Marlowe-Wiedergänger immer neu aufgelegt wird. Würde man unter all den Privatdetektiven der weltweiten Kriminalliteratur eine Volkszählung veranstalten, wäre der Anteil der Amateure und der wie die Jungfrau zum Genre gekommenen Ermittlerfiguren vermutlich in der Mehrheit.
Was aber es kaum gibt – kann mir jemand auch nur fünf Beispiel nennen? –, das ist jene Privatdetektiv-Art, die in der wahren Realität den Großteil dieses Berufstandes ausmacht: Detektive und Detekteien, die für „die Wirtschaft“, für Konzerne und multinationale Unternehmen am Schnüffeln und Überprüfen, Recherchieren, Beschatten und Abhören, Hacken und Tricksen und Schadenanrichten oder Schadenabwehren sind. Kurz das, was Tyler Maroney nicht ganz zu Unrecht The Modern Detective nennt. Diese Detektive stehen in Diensten der sogenannten „Corporate Intelligence“ und sie verändern die Welt, wie Maroney im Untertitel seines Buches festhält: How Corporate Intelligence Is Reshaping the World.
Tyler Maroney selbst ist solch ein Detektiv, er ist Mitbegründer der New Yorker Investigativ-Firma QRI. Industriespionage, Weiße-Kragen-Kriminalität, Korruption, Bestechung, graue und schwarze Märkte, Beweise und Material für Prozesse und Vergleiche, Stillhalteabkommen und Terraingewinne, Durchleuchtung von Personal und Konkurrenz, die Wiederbeschaffung gestohlener Güter und Patente sind sein Metier. Seine Klienten sind mächtiger als manche Regierung, oft geht es um sehr sehr viel Geld oder sehr sehr viel Einfluss – denken wir an die anzüglichen Fotos von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner neuen Geliebten, die in den Machtkreisen Saudi-Arabiens landeten und von dort ihren Weg in die westlichen Boulevardblätter fanden. Polizei und Behörden sind eher keine Ansprechpartner, wenn es in solchen Welten etwas zu klären oder aufzuklären gibt. Dafür gibt es die Profis der „Corporate Intelligence“ – Privatgerechtigkeit für die Reichsten der Reichen der Welt. Und für die Konzerne.
Tyler Maroney stellt in diesem Sachbuch einige seiner Fälle vor. Natürlich schützt er dabei seine Klienten, die Darstellung ist interessensgeleitet. Aber es ist ein Blick in eine Profi-Welt, die Stoff für viele wirklich wirklichkeitstüchtige Kriminalromane wäre.
Tyler Maroney: The Modern Detective: How Corporate Intelligence Is Reshaping the World. Riverhead Books, New York 2020. 272 Seiten, 27 USD.











