 Facettenreiche Gesellschaftsbilder
Facettenreiche Gesellschaftsbilder
Die brasilianische Autorin Patrícia Melo gehört zu den interessantesten Autorinnen der Kriminalliteratur und insofern von Gegenwartsliteratur. Nicht nur in Brasilien, nicht nur in Südamerika. In Deutschland wird Pátricia Melo hoch geschätzt – und wenig verkauft. Das ist skandalös, kann aber nicht über die wirklichen Relevanzen hinwegtäuschen. Deswegen bringt der „Krimi-Samstag“ heute ein Porträt Pátricia Melos von Doris Wieser.
Dem Porträt folgt eine Einzelrezension über einen Roman. Letzteres tut man eigentlich nicht, wenn die Taschenbuchausgabe des Buchs, das es seit 2005 als Hardcover gibt, und die in diesen Tagen erscheinen sollte, gecancelt wurde – wegen zu weniger Vorbestellungen, wie der Verlag mitteilt.
Aber Literaturkritik geht eben nicht nur nach Aktualität und Marketingvorgaben. Sogar, wenn der Roman – im besten Sinne – kritikabel ist.
Deswegen folgt auf das Porträt eine Besprechung von Schwarzer Walzer.
Genießen Sie ein wunderbares Frühsommer- Wochenende!
Ihr Thomas Wörtche
Patrícia Melo wurde 1962 in Assis im Bundesstaat São Paulo geboren. Sie schreibt Romane, Drehbücher (z.B. für Bufo & Spallanzani von Rubem Fonseca), Theaterstücke und arbeitet zeitweise als Dramaturgin. Sie ist seit 2007 mit dem brasilianischen Dirigenten John Neschling verheiratet, den sie während ihrer Recherchen für Schwarzer Walzer kennengelernt hat.
1994 erschien ihr Debütroman Acqua toffana (dt. Ich töte, Du stirbst, 2002), in dem sie zwei schauderhaft grausame Geschichten mit vielen Schnitten und schnellem Rhythmus erzählt. Die eine handelt von Rita, die entdeckt, dass ihr Mann der berüchtigte Frauenmörder von Lapa ist, und die andere von einem Großstadtneurotiker, der einen perfiden Mordplan schmiedet und in der Nervenklinik endet. Ihr zweiter und wohl bekanntester Roman, O Matador (1995, dt. O Matador, 1997), war nicht nur ein großer Bucherfolg (Prix Deux Océans 1997 und Deutscher Krimi Preis 1998), sondern schaffte es auch auf die Leinwand. Ihr Freund und Vorbild Rubem Fonseca verfasste das Drehbuch und sein Sohn, José Henrique Fonseca, übernahm die Regie von O homem do ano. Der hervorragend geplottete Roman erzählt die steile „Karriere“ eines Auftragskillers, der mehr oder weniger durch Zufall ins Geschäft schlittert und unfähig ist, seine Taten moralisch zu hinterfragen. 1990 folgte Elogio da mentira (dt. Wer lügt gewinnt, 1999), ein herrlich amüsantes Werk voller ironischer, intertextueller Anspielungen, in dem ein drittklassiger Krimiautor einer Schlangengiftexpertin hilft, deren Ehemann umzubringen. 1999 wurde Patrícia Melo vom Time Magazine in die Schriftstellerliste der 50 „Latin American Leaders for the New Millennium“ aufgenommen. Für ihren bisher ambitioniertesten Roman, Inferno (2000, dt. Inferno, 2003), erhielt sie den wichtigsten Literaturpreis Brasiliens, den Prêmio Jabuti (2001). Inferno erzählt den Werdegang eines Favela-Kindes in Rio, das zu einem gefürchteten Drogenboss heranwächst und wird oft mit Cidade de Deus (City of God) von Paulo Lins verglichen. 2003 verlässt Patrícia Melo mit Valsa negra (dt. Schwarzer Walzer, 2005) das Terrain der Gewaltverbrechen und richtet ihr Augenmerk auf die brasilianische Oberschicht, die ihre ganz eigenen Probleme neben dem in Brasilien alltäglichen Morden auf den Straßen hat.
Es gehört zum ästhetischen Programm der Brasilianerin, die Gesellschaft, in der sie lebt, in möglichst vielen Facetten zu erfassen, und so gleicht keiner ihrer Romane dem anderen. Wiedererkennbar sind sie dennoch, da sie ein ganz besonderer „Melo-Stil“ verbindet. Ihr schneller Rhythmus steigert sich an manchen Stellen in ein Stakkato aus kürzesten Sätzen. Ihr Ton verstört, da er Grausamkeiten banal und häufig erschreckend lakonisch darstellt. Die Psyche der Täter scheint gleichzeitig durchschaubar und undurchdringlich. Melos Romane reichen tief ins Genre Kriminalroman hinein, aber auch weit hinaus, wie an Schwarzer Walzer sowie Inferno deutlich wird. Diese Romane teilen mit dem Genre nur einzelne Elemente und vor allem Schwarzer Walzer hat kaum etwas davon. So lässt sich die Autorin ebenso wenig aufs Kriminalgenre festlegen, wie sie davon gelöst werden kann. Großstadt, Gewalt, Verbrechen, Armut, Neurosen, Obsessionen bis hin zu pathologischen Verhaltensmustern gehören zu den erzählerischen Hauptinteressen der Autorin. Ihre Vorliebe für Giftmorde teilt sie mit Rubem Fonseca (vgl. Bufo & Spallanzani), hinzu kommen ihr Interesse für Gewaltdarstellung in den Medien, Telenovelas und deren Interdependenz mit der Wirklichkeit. Den Einfluss der Medien auf das Weltbild ihrer Figuren verbindet sie raffiniert mit intertextuellen Bezügen, eine Vorliebe, die sie unter anderem mit ihrem Landsmann Luis Fernando Veríssimo verbindet (vgl. O jardim do diabo).
Melo dringt tief in die Psyche ihrer Protagonisten ein, ohne sie letztendlich zu erklären. Das hohe Irritationspotenzial ihrer Romane rührt von diesen offenen Stellen. Wie ticken diese Killer und Drogenbosse eigentlich? Kann das überhaupt schlüssig erklärt werden, ohne ihr Verhalten billig als pathologisch abzustempeln? Melo lässt absichtlich Lücken im ihrem gesellschaftskritischen Erklärungsmodell und vermeidet so, Konflikte simplizistisch aufzulösen und den Leser wieder seiner kleinbürgerlichen Sicherheit zu übergeben. Das heißt aber nicht, dass die Romane keine Antworten liefern, sondern nur, dass bestimmte Bereiche in ihnen immer dunkel bleiben, genauso wie die Realität selbst. Dazu gehört auch, dass der Spannungsaufbau häufig diffus wirkt, da dem Leser die Möglichkeit genommen wird, für jemanden Partei zu ergreifen. Melo bietet keine Identifikationsfiguren an, aber auch keine, die schlicht als „die Bösen“ interpretiert werden können. So bangt der Leser zwischen mehreren möglichen Ausgängen, ohne zu wissen, welchen er favorisiert.
Wir dürfen gespannt sein, was in den nächsten Jahren noch kommt, denn in Brasilien hat Patrícia Melo bereits zwei weitere Romane veröffentlicht. Mundo perdido (2006) ist die Fortsetzung von O Matador und der obsessive Ich-Erzähler von Jonas, o copromanta (2008) liest aus seiner Kacke die Zukunft.
Globalisierte Egos
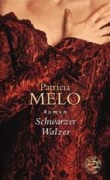 Durch den vergifteten Schleier seiner Psychose versucht der Protagonist in Patrícia Melos Schwarzer Walzer eine schlüpfrige Wahrheit an sich zu reißen und verfängt sich dabei immer mehr in seinem Netz falsch verknüpfter Neuronen.
Durch den vergifteten Schleier seiner Psychose versucht der Protagonist in Patrícia Melos Schwarzer Walzer eine schlüpfrige Wahrheit an sich zu reißen und verfängt sich dabei immer mehr in seinem Netz falsch verknüpfter Neuronen.
Ein ambitionierter Dirigent aus der brasilianischen Oberschicht geht an seiner selbstinitiierten Psychose zugrunde. Sein Faust’scher Wahn, das Glück für alle Zeiten pachten zu wollen, treibt ihn in die unerträgliche Angst davor, das zu verlieren, was er hat: Erfolg, Liebe, Wohlstand. So liest sich Patrícia Melos bissige Abrechnung mit intellektuellem Ehrgeiz und Egozentrik, die einen angesehenen Künstler zur Lachnummer werden lässt. Ein mögliches Verbrechen wird zwar erst auf der letzten Seite angedeutet, aber dafür enthält der Roman umso mehr an Ermittlungsarbeit, woran man auch hier wieder Melos Vorliebe für Kriminalliteratur erkennt. Als Nachgeschmack bleibt nicht einmal fades Mitleid über, eher die peinliche und peinigende Erkenntnis, in Melos Protagonisten Kollegen, Freunde oder sich selbst wiedererkannt zu haben.
Schwarzer Walzer ist ein Roman über hausgemachte Pseudoprobleme, an denen so viele Individualisten und Egomanen in Wohlstandsgesellschaften leiden. Denn in einer Wohlstandsgesellschaft lebt auch der erfolgreiche Dirigent aus São Paulo, der sein eigenes Orchester leitet und jährlich Gastauftritte in mehreren Ländern Europas wahrnimmt. Nein, es ist aber auch wirklich nicht leicht, eine 30 Jahre jüngere Frau zu heiraten. Jeder x-beliebige Mann wird so ganz automatisch zur Bedrohung, klar. Und wenn man dann noch das ganze Orchester gegen sich hat und von Kollegen nur gelobt wird, wenn sie bereits an deinem Stuhlbein sägen, dann ist es doch ganz logisch, dass man ein bisschen überreagiert. Oder? Ob oder wie sehr die Verschwörungstheorien des Dirigenten zutreffen, kann der Leser lange nicht beurteilen, da der ganze Roman aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Dieser Filter legt sich wie ein vergifteter Schleier über die Umwelt, jedoch wird nach und nach klar, dass die anderen Romanfiguren ganz normale Leute mit schlechten, aber vor allem auch vielen guten Eigenschaften sind, die der Protagonist obsessiv ins Negative verkehrt. Auch kulturelle Vorurteile sind mit von der Partie. So verarbeitet der Erzähler nie richtig, dass seine junge Frau Jüdin ist. Immer fühlt er sich ausgeschlossen, ein Goi, der niemals verstehen wird, was es bedeutet, Jude zu sein. Aber gibt ihm seine Frau wirklich Anlass dazu?
Auf den ersten Blick ist das andere, erschreckend arme, abstoßend gewalttätige und hoffnungslos marginalisierte Brasilien, das wir aus vielen Romanen und Filmen wie City of God oder Dokumentationen wie Tropa de elite kennen, ganz weit weg. Das Erzählen über Armut und Verbrechen wie es beispielsweise Rubem Fonseca mit seiner „narrativa brutalista“ hervorgebracht hat, wird hierzulande von den lateinamerikanischen Autoren häufig erwartet, da man sich mit Großstadtpsychosen, Karriereängsten, Beziehungsdramen und dergleichen Kram ja im eigenen Land hervorragend auseinandersetzen kann. Dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen bietet Patrícia Melos Roman hochinteressanten Stoff. Die Neurosen und Psychosen der Intellektuellen sind ja potenziell auf der ganzen Welt dieselben. Auch in den globalisierten „Erste-Welt-Ghettos“ São Paulos kämpfen die Reichen mit ihrem globalisierten Ego und leiden daran perverserweise nicht weniger als die Favela-Bewohner ein paar Kilometer weiter an ihrer Drogensucht und der allgegenwärtigen Gewalt. Diese Abgründe des reichen Brasiliens zeigt uns Melo in Schwarzer Walzer, nachdem sich ihre vorhergehenden Romane vor allem mit Armut, Gewalt und organisiertem Verbrechen auseinandergesetzt haben. Dass Schwarzer Walzer in Brasilien spielt, spürt man auch daran, dass sich die Reichen mehr als in den Industrienationen immer wieder über ihre Haltung zu den Armen definieren. Gehören sie zu den politisch Linken, die über eine gerechtere Umverteilung sprechen, aber nichts dafür tun? Oder gehören sie zu denjenigen, die das ungebildete, faule und stinkende Pack verabscheuen? Oder vielleicht zu denen, die die Armen abgöttisch lieben und ihre Putzfrau für ihre beste Freundin halten?
Trotz allem gelingt es Melo in diesem Roman nicht, die gleiche Durchschlagkraft des Plots zu entfalten wie in ihren vorhergehenden Romanen. Auch ihre sonst grausam karge Sprache, bei der man nur noch schreien möchte, findet man in diesem Roman nur in gedämpfter Form wieder. Einen dynamischen Sog entwickelt der Roman daher nur, wenn man ihn in einem Rutsch durchliest. Sonst hat man in den fünfzehn Minuten U-Bahn-Lektüre jeden Morgen das Gefühl, dieselben Seiten schon einmal gelesen zu haben. Das Überspringen von ein paar Absätzen sei daher durchaus erlaubt. Der Typ ist eben obsessiv.
Doris Wieser
Patrícia Melo: Schwarzer Walzer (Valsa negra, 2003). Roman. Deutsch von Barbara Mesquita. Droemer/Knaur 2005. 14,00 Euro.











