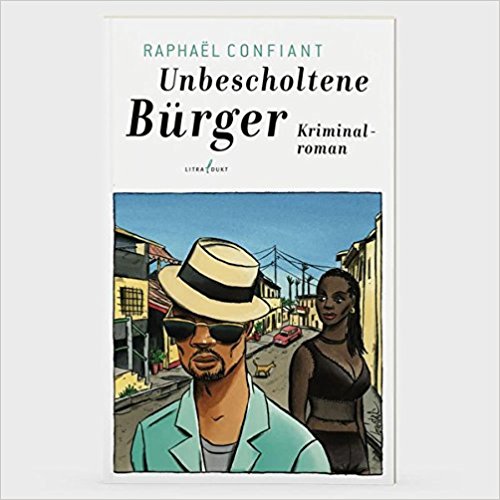
Ragoût caraïbe, saignant et étonnant
Raphaël Confiant gehört zu den großen Literaten Martiniques. Mit einer deutlichen Liebe zu Kriminalromanen. Seinen neuesten, auf deutsch vorliegenden „Unbescholtene Bürger“ hat Thomas Wörtche amüsiert und verwundert gelesen.
Es gibt kaum etwas Peinlicheres als einen Roman zu loben, nur weil er aus einer für uns „exotisch“ anmutenden Gegend kommt. Schwache Bücher, auch wenn sie aus Gabun, Indien oder sonst woher stammen, mit dem Argument zu verteidigen, man lerne ja schließlich etwas über Land, Leute und Verhältnisse, schrammt hart am benevolenten Rassismus entlang. Wer was über Land und Leute lernen will, soll sich einen guten Reiseführer kaufen. Wenn ein Roman als Roman nichts taugt, ist es nachgerade eine Unverschämtheit gegenüber guter Literatur aus eben diesen Gegenden, ihn zu featuren, nur weil andere Texte aus seinem Herkunftsland hier vermeintlich nicht sonderlich verbreitet sind.
Was im Fall von Martinique sowieso nicht stimmen würde – Raphaël Confiant, sicher einer der profiliertesten Autoren des Département d’outre-mer steht in einer seit Aimé Césaire und Frantz Fanon beeindruckenden Tradition, wenn man an Autoren wie Édouard Glissant oder Patrick Chamoiseau denkt. Auch dass Confiant eine Affinität zu Kriminalromanen hat, ist nichts Neues, auch wenn sein „Mord am Karsamstag“ schon seit ein paar Jährchen leider nicht mehr bei uns lieferbar ist. Jetzt startet also der auf die frankophone Karibik spezialisierte litradukt Verlag seine Serie (gerade ist der nächste Band um Jack Teddyson: „Du rififi chez les fils de la veuve“ bei Caraibéditions in deren Polar-Reihe erschienen) um den hoffnungslosen Privatdetektiv Raymond Vauban. Dass der sich den Namen Jack Teddyson gibt, hat damit zu tun, dass Privatdetektive nun einmal lieber amerikanische Namen tragen sollen. Das wiederum hat auch damit zu tun, dass „Unbescholtene Bürger“ zunächst einmal ein Pastiche  auf die Klassiker Hammett und Chandler ist – mit stilistischer Schlagseite zu Gunsten Chandlers. Der Fall ist klassisch: Jack wird von der Witwe eines reichen und mächtigen Mannes angeheuert, der kastriert und erschossen aufgefunden wird. Auch seine Geliebte, eine Prostituierte, wird tödlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Auftraggeberin ist, der ebenfalls klassischen Chandler´schen Misogynie verhaftet, nicht ganz koscher, der Privatdetektiv sticht in die üblichen Wespennester aus Gier, Politik, organisiertem Verbrechen, Prostitution, Drogenhandel, Überlebenswillen und was sich nicht so alles auf der globalisierten Welt herumtreibt. Am Ende ist er körperlich und seelisch vermackelt und gebeutelt, aber immer noch aufrecht stehend, comme il faut. Dass dabei die spezifischen Konstellationen Martiniques das Setting vorgeben, ist klar: Haitianische Gangster, Voodoo, illegale Lotterien, hispanophone Huren, die Pipelines nach Miami, syrische Händler, die alten und neuen Rassismen und die verschiedenen Abstufungen von „Kreolität“, französische Gaullisten, dubiose Polizisten – und alles das in einem wahnsinnigen Sprachmix (Confiant ist ein wichtiger Motor des Kreolischen) als Ich-Erzählung inszeniert. Man könnte, so gesehen, Confiants Roman als Komplementärstück zu Gary Victors Haiti-Krimis sehen, deren Helden, Inspecteur Azémar er auch prompt aufruft (S.169).
auf die Klassiker Hammett und Chandler ist – mit stilistischer Schlagseite zu Gunsten Chandlers. Der Fall ist klassisch: Jack wird von der Witwe eines reichen und mächtigen Mannes angeheuert, der kastriert und erschossen aufgefunden wird. Auch seine Geliebte, eine Prostituierte, wird tödlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Auftraggeberin ist, der ebenfalls klassischen Chandler´schen Misogynie verhaftet, nicht ganz koscher, der Privatdetektiv sticht in die üblichen Wespennester aus Gier, Politik, organisiertem Verbrechen, Prostitution, Drogenhandel, Überlebenswillen und was sich nicht so alles auf der globalisierten Welt herumtreibt. Am Ende ist er körperlich und seelisch vermackelt und gebeutelt, aber immer noch aufrecht stehend, comme il faut. Dass dabei die spezifischen Konstellationen Martiniques das Setting vorgeben, ist klar: Haitianische Gangster, Voodoo, illegale Lotterien, hispanophone Huren, die Pipelines nach Miami, syrische Händler, die alten und neuen Rassismen und die verschiedenen Abstufungen von „Kreolität“, französische Gaullisten, dubiose Polizisten – und alles das in einem wahnsinnigen Sprachmix (Confiant ist ein wichtiger Motor des Kreolischen) als Ich-Erzählung inszeniert. Man könnte, so gesehen, Confiants Roman als Komplementärstück zu Gary Victors Haiti-Krimis sehen, deren Helden, Inspecteur Azémar er auch prompt aufruft (S.169).
Pastiche oder Parodie?
Aber wo Gary Victor eine völlig eigene, originelle Syntax und Grammatik von Kriminalliteratur entworfen hat, überschreitet Confiant das Pastiche nur in Richtung Parodie und zwar mit dem Stilmittel der „Übererfüllung“. Auch wenn Jack ein großes Herz für Huren hat und die Beziehung zwischen den Geschlechter erfreulich polyamor gedacht sind, so überzieht er doch bewusst seine Rede über Frauen: Kerle „besorgen“ es Frauen, Frauen sind grundsätzlich sexuell aufreizende Wesen und unersättlich, Detektiv Jack ist praktisch am Dauersabbern, wenn er einen Frauenschenkel sieht und eine Zote und ein Grobianismus (cf. Rabelais) jagen die anderen. Aber es geht eben nicht um „karibische Sinnenfreude“ oder was um Himmels willen wir uns darunter vorstellen möchten, sondern die parodistische Technik erzielt ein gewisses Unbehagen. Versteht man die Parodie als einen Modus komischer, „kritischer Textverarbeitung“ (cf. Theodor Verweyen: Eine Theorie der Parodie) bleibt der kritische Ansatz eher unklar: Richtet er sich gegen die Vorlage (die amerikanische hardboiled school und deren Misogynie) oder gegen die davon abgeleitete, noch heute virulente Perspektive auf Geschlechterrolle? Ähnlich steht es mit der Intertextualität und der literarischen Struktur: Auch wenn der Gestus von Jacks Rede deutlich hardboiled ist, so wird er durch eine Vielzahl literarischer und geistesgeschichtlicher Bezüge gebrochen: Jack zitiert von Epiktet und Plotin bis Hegel, Heidegger und Wole Soyinka so ziemlich alles, was gerade zur Hand ist, selbst bei einem Voodoo-Ritual fällt ihm zu allererst ausgerechnet Saint-John Perse ein, und an einem eher  schlichten Kommissar lobt er, dass dieser die sokratische „Mäeutik“ so gut beherrsche. Auch dieses Prinzip exaltiert Confiant, bis es, je nach Sicht der Dinge, komisch oder nervig wird. Oder ging es ihm um eine „Gleichberechtigung“ europäischer und nicht-europäischer Kulturgeschichte?
schlichten Kommissar lobt er, dass dieser die sokratische „Mäeutik“ so gut beherrsche. Auch dieses Prinzip exaltiert Confiant, bis es, je nach Sicht der Dinge, komisch oder nervig wird. Oder ging es ihm um eine „Gleichberechtigung“ europäischer und nicht-europäischer Kulturgeschichte?
Fast konfrontativ lässt Confiant auch verschiedene Sprachmilieus aufeinander krachen, nicht nur in der Figurenrede, sondern in der Erzählstimme: Chandlerismen wie „maoistisch rot geschminkt“ oder „ich ging rasch im Geiste die zehn Gebote durch, um festzustellen, ob eines von ihnen verbot, sich eine Witwe anzueignen“ kontrastieren bewusst gesetzte Anachronismen wie „Höker“ oder „seine unverhofft aufgetauchte Dulcinea“, ein Höllenjob für den Übersetzer Peter Trier.
Bleibt die Frage, was von dem ganzen Aufwand zu halten ist. Ein literarischer Scherz, ein statt mit Stereoiden mit Bedeutsamkeit vollgepumpter traditioneller Privatdetektivroman, der sich über traditionelle Privatdetektivromane lustig macht (warum?) Oder eine wahnwitzige Manifestation des Prinzips „Mestizaje es grandeza“, das sich wollüstig auf allen Ebenen des literarischen Bedeutungsaufbaus austobt? Die letztere Option wäre mir lieber.
Thomas Wörtche
Raphaël Confiant: Unbescholtene Bürger (Citoyens au-dessus de tout soupçon …, 2010). Roman. Deutsch von Peter Trier. Verlag litradukt, Trier 2018. 194 Seiten, 13,80 Euro.
Zu Buch und Autor: hier entlang.











