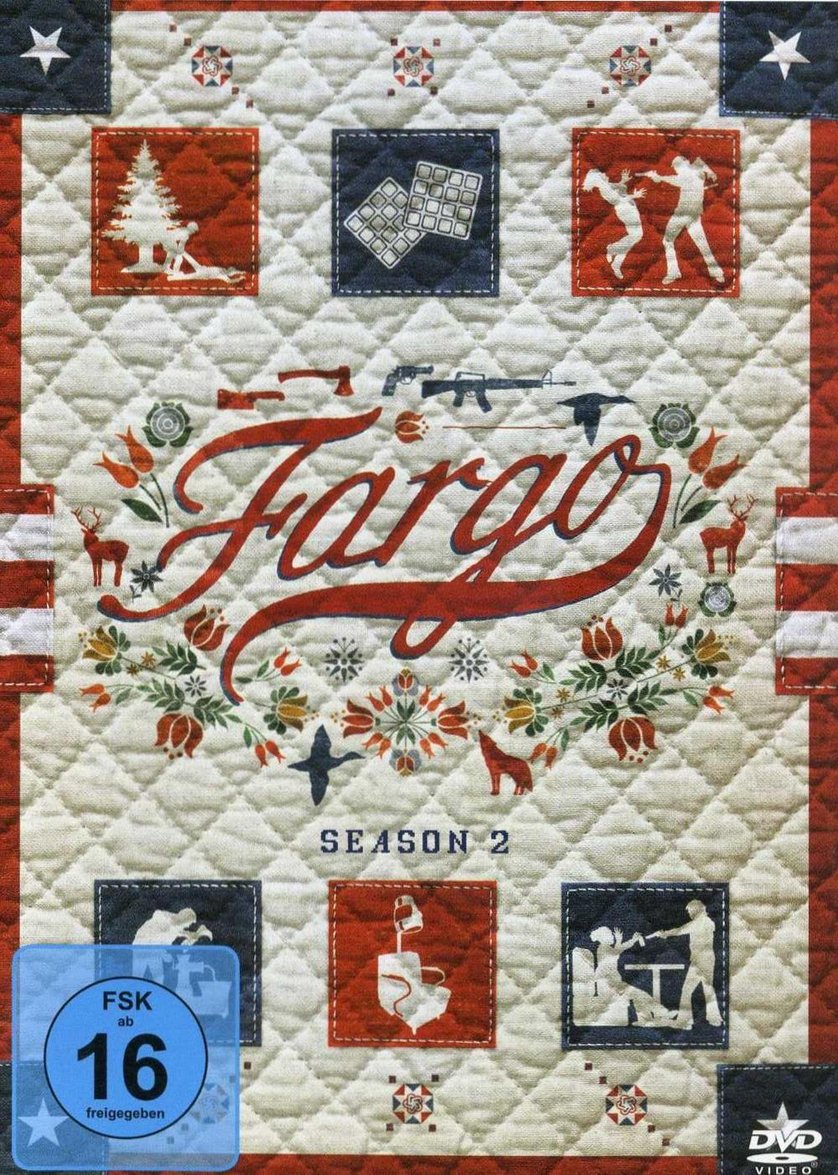 Mit Kierkegaard im Serienland
Mit Kierkegaard im Serienland
Gedanken zur zweiten Staffel von „Fargo“ – Ein Essay von Markus Pohlmeyer
Prolog
Vorangestellt das Motto dieser Serie: es handele sich um tatsächliche Begebenheiten; nur die Namen der Opfer seien geändert worden, aber: „Aus Respekt vor den Toten wird der Rest genauso erzählt, wie er passiert ist.“[1] Episodentitel wie The Myth of Sisyphus oder Fear and Trembling verweisen auf Camus und Kierkegaard. Letzteres baut schon von Anfang an ein dichtes Netz von Verweisungen auf. Ersteres wird sofort durch den Beginn von Episode 1 dekonstruiert. In Schwarz-Weiß: Titel Massacre At Sioux Falls, Hauptrolle: Ronald Reagan; dazu die verfremdete Titelmusik von Fargo. Ein Indianerhäuptling/Schauspieler schaut ungeduldig über eine Fläche mit toten Soldaten. Wie lange das noch dauere? Man stecke noch die Pfeile in Ronald Reagan! Die Illusion von einer Dokumentation, ein Eindruck, den vielleicht das Motto hätte erwecken können, weicht sofort einer immanenten Poetologie (wenn ich das so nennen darf), welche die Serie ständig in ihrem Verlauf performativ inszeniert, denn jede Dokumentation ist ja nichts anderes als eine Konstruktion – das scheint nicht neu, aber keineswegs immer selbstverständlich. Die Rezeption der vorgestellten Ereignisse öffnet sich gleichzeitig vielfältigen Applikationen: eine Geschichte, die ein ganzes Bündel von Geschichten aus der Vergangenheit bis in unserer Gegenwart hinein verknüpft und entfaltet – ein Verfahren, welches wiederum ständig auf das Design der Narration zurückwirkt. PS: Und die Moral von der Geschicht’? Verzicht’ auf Ethik nicht (denn es gibt keine Moral!).
Krankheiten zum Tode
Kurze Handlung von ‚Fargo Staffel 2‘, dieser seltsamen Mischung aus Gangsterstory, Ehedrama, Akte X, gesellschaftlichem Kollaps, Politik und beziehungsweise Hollywood als Fiktionenproduktionsmaschinerien mit Placebo- oder (je nach Wahl) mit Narkose-Effekt. 1979: ein Bandenkrieg flammt zwischen der Familie Gerhardt (Fargo) und einem expandierenden Syndikat (Kansas City) auf – ein Konflikt zwischen Tradition und professionell gesteuerter Profitoptimierung. Die Familie, grausam, aber intellektuell wenig herausragend, wird eher durch eigene Inkompetenz und durch das Ehepaar Ed und Peggy Blumquist, das sich zufällig in diese Tragödie verstrickt, und durch die verräterische Simone, die gegen ihren schwachsinnigen Macho-Vater Dodd rebelliert und mit der Gegenseite nicht nur metaphorisch ins Bett steigt, sukzessive und nachhaltig in teilweise aberwitzigen Situationen ausgelöscht. Thomas Wörtche zum Thema Familie in Krimis: „Familienstrukturen, zumal sie im Organisierten Verbrechen ihre Zwecke haben, sind leicht korrumpierbar – sie reagieren auf Gewalt, indem sie sie zulassen.“[2]
Hinzu kommen zwei Wanderer zwischen den Welten: Milligan, ein Gangster, der im Auftrag des Syndikats agiert, und Hanzee, ein Indianer, der zwar zur Familie zu gehören scheint, aber dann die Seiten wechselt: nämlich auf die seinige! Das finale (Hanzee-Indianer)Massaker wird auch von einem Ufo beobachtet. Dieses hatte schon in der ersten Folgen seinen Auftritt, als nämlich Rye, einer der dämlichen Gerhardt-Söhne, drei Menschen eher aus Versehen und Gangstergetue – aber hier hat ja jeder Idiot und Psychopath eine Knarre, und wehe den armen Statisten, die im Weg stehen oder helfen wollen! – brutal erschossen hat und der auf der Flucht, von einem Ufo geblendet, in Peggys Auto rannte. Deren Mann, brav, bieder, Metzgergehilfe, entdeckt das kaputte Auto in der Garage, mit einem großen Loch in der Windschutzscheibe, und bringt in Notwehr Rye um, der, erstaunlich genug, die Fahrt mit Peggy überlebt hat – mit freundlichen Grüßen an die Gefriertruhe. Übrigens: sie erzählt ihrem Mann nichts von dem Unfall und hat ganz gemütlich das Abendessen zubereitet. Ed möchte nur ein normales Leben führen. Peggy möchte authentisch Frau sein, ohne zu begreifen, dass sie sich wiederum nur in gesellschaftliche Rollenmuster einschreibt: „Anthropologisch ist das […] Irrsinn, denn der Mensch ist bereits seiner Natur nach ein Kulturwesen, doch lässt dies der Authentizitätsdiskurs weitgehend außer Acht, der voraussetzt, dass sich unser unverfälschtes Ich in uns selbst findet und sich nicht in unserem Zusammenspiel mit Kultur und Gesellschaft entwickelt.“[3]
Mit diesem Zwang zur Authentizität avanciert Peggy zur gefährlichsten, unberechenbarsten Person dieses Dramas, weil sie Kollateralschäden am laufenden Band/Mann produziert, und das ohne jegliche Empathie. Sie schaltet die bösen Jungs aus, nebenbei. Dodd, der Gerhardt-Obermacker, ist nach der Begegnung mit ihr nur noch ein Wrack und Trümmerfeld, stufenweise destruiert. Als ihr Gefangener zeigt er keine Manieren: also piekst/foltert sie ihn ein bisschen mit dem Küchenmesser.
Die Krankheit zum Tode
Eine Folge spielt via Titel auf „Furcht und Zittern“ an, ein Werk des dänischen Theologen, Philosophen und Schriftstellers Sören Kierkegaard (1813-1855). Kierkegaard spielt die fürchterliche Situation Abrahams durch, der auf Befehl Gottes seinen Sohn opfern soll – was Gott aber am Ende verhindert. Als Verweis auf diese Situation kann man auch die Hinrichtung der Verräterin Simone durch ihren eigenen Onkel verstehen (… oder als Judas-Motiv?): außerhalb der Gesellschaft, in einem winterlichen Wald, der Familienehre geopfert. Kein Gott rettet. In einem anderen Buch „Die Krankheit zum Tode“[4] entfaltet Kierkegaard tiefe theologisch-philosophische Analysen, die immer auf psychologische Implikationen zielen, zum Wesen der Verzweiflung: „Wenn also der Herrschsüchtige, dessen Losung »Cäsar oder nichts« lautet, nicht Cäsar wird, dann verzweifelt er darüber. Das aber bedeutet etwas anderes: Gerade weil er nicht Cäsar wurde, ist es ihm jetzt unerträglich, er selbst zu sein.“[5] Oder: „Er lernt das Leben nun ein wenig kennen, er lernt es, die anderen Menschen, ihre Art zu leben, nachzuäffen – und so lebt er nun auch. Gleichzeitig ist er Christ in der Christenheit, geht jeden Sonntag in die Kirche, hört und versteht den Pfarrer, ja sie verstehen sich beide; er stirbt, der Pfarrer führt ihn für zehn Reichstaler in die Ewigkeit ein – doch ein Selbst war er nicht, ein Selbst wurde er nicht.“[6] Für Peggy ließe sich Kierkegaards Text in etwa so umformulieren: Sie lernt das Leben nun ein wenig kennen, sie lernt es, die modernen Frauen (vor allem ihre lesbische Kollegin, die im Grunde Peggy nur verführen möchte), ihre ‚revolutionäre‘ Art zu leben, nachzuäffen – und so lebt sie nun auch. Gleichzeitig ist sie Ehefrau in der Gesellschaft, erfüllt ihre ehelichen Pflichten, tut so, als verstünde sie ihren Mann (und versteht ihn überhaupt nicht, bis sie ihn endgültig verlieren sollte). Das Ehepaar tut so, als ob sie sich beide verstünden; sie sitzt am Ende in einem Polizeiwagen; und für ein paar Hundert Dollar hätte sie ein Selbstfindungsseminar bekommen können – doch ein Selbst war sie nicht, ein Selbst wurde sie nicht.[7]
Peggys Performanz, in Variation von Kierkegaards Diagnose, verzweifelt selbst sein zu wollen,[8 ]zerstört das Leben ihres Mannes, lässt sie kein Selbst finden und treibt sie in eine fatale, verantwortungslose, geradezu mörderische Verdrängung von dem, was ist. Und dies scheint in der Serie zu einem Problem der US-amerikanischen Gesellschaft im Jahr 1979 überhaupt erhoben zu werden: Der Schauspieler/Politiker Ronald Reagan – pars pro toto für die nukleare Aufrüstung – evoziert in einer Wahlkampfrede für die Präsidentschaft das Bild eines patriotischen Neubeginns; und parallel dazu ballern sich die Gangster ab. Auf der Herrentoilette trifft Reagan auf den ihn begleitenden State Trooper Solverson und schwärmt (mit Erinnerungslücken!) von seinen filmisch-imaginierten Kriegserlebnissen (während der Nazi-Zeit), während der State Trooper tatsächlich in einem realen Krieg (Mekong Delta) involviert war. Solverson vermutet, die Krankheit der Zeit sei auf seine Frau übergegangen. Sie leidet nämlich an Krebs! Und: wie komme man aus diesem Schlamassel? Reagan, sinngemäß, ein Amerikaner könne jede Herausforderung bewältigen. Solverson: „Nur wie?“ Der Präsident-in-spe verlässt schweigend den Raum. Interessanterweise wird später ein Reagan-Film für Peggy zur Folie, in einer dramatischen Situation die Geschehnisse zu deuten – absolut an dem vorbei, was war. Der Film ersetzt Realität bzw. fungiert als vorgefertigtes, Gewalt als Spiel inszenierendes Konsumprodukt, das Wirklichkeiten erst konstituiert.
„Und wenn Sie mir gestatten, mein Herr, ich mag Ihren Stil.“
Betsy, Solversons Frau, eine tapfere, große Persönlichkeit, kämpft gegen ihren Krebs, nimmt deshalb an einer medizinischen Studie teil – weiß aber nicht, ob das Medikament nur ein Placebo sei. Dies liest sich auch metonymisch für jene Gesellschaft und ihre (vielen) Krankheiten zum Tode. Waffen, die einen Kerl zum Gangster machen; Waffen, die Unschuldige einfach ausradieren. Waffen, die wie selbstverständlich im Schrank stehen, es könnten ja ungebeten Besucher kommen. Waffen für Kriege … Die Ufos scheinen regelrecht von menschlicher Gewalt angezogen zu werden. Oder sind wir als Zuschauer(innen) eben diese außer-filmischen Voyeure, die den schwer bewaffneten Ratten im Laboratorium USA zuschauen?
Was hier in Fargo 2 oft salopp-ironisch rüberkommt, fühlt sich gleichzeitig nur makaber an; was wie blanker Zynismus wirkt, rutscht haarscharf an Situationskomik und Slapstick vorbei. Diese Ambivalenzen und Ambiguitäten sind schwer auszuhalten und machen es einem doch gleichzeitig sehr leicht, frech in sich hineinzuschmunzeln. Ed möchte beispielsweise Dodd an Milligan ausliefern; am Telefon: also er sei der Fleischer von Luverne. (Ed übernimmt hier die ihm zufällig extern zugewiesene Rolle eines Serienkillers, was urkomisch wirkt, weil der harmlose Kerl, der er gar nicht ist, wenn es um Notwehr geht, richtig gefährlich wirken will.) Darauf Milligan bewundernd: „Und wenn Sie mir gestatten, mein Herr, ich mag Ihren Stil.“
Der richtig coole Gangster Milligan hat für seinen Boss das Problem mit dem rückständigen Familienunternehmen gelöst (eigentlich haben das Ed, Peggy und Hanzee für ihn getan) – und er steigt jetzt in der Hierarchie auf und wird somit selbst Opfer der Modernisierung. Er bekommt ein kleines Büro zugewiesen und ein Einführung in profitsteigerndes Wirtschaften. Es gehe um Infrastruktur! Und dann erst das beindruckende Beispiel von eingesparten Portokosten! Und er solle zum Friseur gehen, die 70er wären nicht mehr angesagt! Und weg mit dem Wildwestgehabe. Dafür: Verwaltung, Golf, Buchhaltung, Einsparungen beim Schmiergeld … Der coole Obergangster, der vorher noch König über Leben und Tod spielen durfte und der dem Sensenmann gerade noch so von der Schippe gesprungen ist, avanciert zum Wirtschaftsfachmann. Oder wird hier die Grenze zwischen Organisiertem Verbrechen und Wirtschaft langsam, aber unaufhaltsam aufgehoben?
In ihrer Einführung zu „Crime & Money“ beobachten Tobias Gohlis und Thomas Wörtche: „Bestraft werden Einbruch, Raub und Mord. Kapitalistische Großverbrechen wie der hemmungslose Schwindel und die wahnhafte Zockerei mit Subprime-Hypotheken, die zur Finanzkrise geführt haben mit Firmenzusammenbrüchen, Obdach- und Arbeitslosigkeit, Selbstmorden und massenhaften Körperverletzungen in Form von Erkrankungen [,] bleiben unsanktioniert.“[9] Und die beiden Autoren mit Blick auf einen Essay von Thomas Adcock: „Adcock zeigt, dass mit den Möglichkeiten des zeitgenössischen Finanzkapitalismus das Verbrechen endgültig von der Straße in die Eckbüros der Hochhäuser aufgestiegen ist, subventioniert von einem willfährigen Staat […].“[10] Und Martin Burkhardt analysiert in demselben Buch eine neue Stufe der Eskalation: „Cybercrime“[11].
Epilog
Ein Sprung noch einmal zu Thomas Wörtche – ein Lektürehinweis: „Die Rede ist von Jerome Charyns elfbändiger Saga um Isaac Sidel, den Cop aus der Bronx, der sich bis zum Präsidenten der USA hinaufmorden kann und der aufsteigt, weil er kapiert, dass alles zusammengehört: Die Clans der Dealer, die Mafia, das Rathaus, das FBI, das Weiße Haus, die guten, alten Gangster, die Kirche, das Militär, die Banken, die Justiz, die Polizei, Chinatown und Little Italy; die Wahlverwandtschaften unter den Menschen.“[12] Solverson ist eine Figur des Übergangs, denn er hat diese Einsicht noch nicht in ihrer Radikalität vollzogen, sonst könnte er kaum folgende für ihn existentielle, für uns rhetorische Frage stellen: „Die moralische Instanz … Wo?” Solverson, ein siegreicher Held? Er hat Peggy festgenommen, gut und schön. Hanzee konnte dennoch fliehen und das Syndikat macht weiter. Reagan wird Präsident. Solverson kommt mittels seiner exekutiven Funktion in Kontakt mit Ed und Peggy, dem Organisierten Verbrechen und der Politik, ohne damit identisch zu werden. Die moralische Instanz liegt in ihm selbst, und nur da, und baut eine Differenz und Distanz zu seiner Umgebung auf. Gleichzeitig ringt er um seine vom Tod bedrohte Ehefrau, ein moderner Sisyphus, der gleichzeitig um die Krankheiten seiner Gesellschaft ringt. Während Hanzee einen (vergangenen Indianer)Rachefeldzug reinszeniert, dessen Ende auch nach der letzten Episode unversöhnlich offen bleibt, ein ewiger Krieg gewissermaßen, und während Milligan die Metamorphose des zukünftigen modernisierten Verbrechens durchläuft, repräsentiert Solverson eine Gegenwart im Umbruch. Er stellt die notwendigen Fragen, ohne je Antworten zu erhalten. Und die weitere Geschichte der USA lässt ihn für uns zurück als ein Relikt, als eine Erinnerungen an einen Weg, der hätte eingeschlagen werden können.
Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg. Seine Texte bei CrimeMag hier.
[1]Alle direkten und indirekten Zitate in diesem Text sind entnommen der DVD-Box: Fargo. Season 2, © 2015 und 2016 MGM und Twentieth Century Fox.
[2]T. Wörtche: Penser Polar, Hamburg 2015, 112.
[3]T. Bauer: Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt, 2. Aufl., Stuttgart 2018, 67.
[4]Vgl. dazu Markus Pohlmeyer: „Die Krankheit zum Tode“ – Aporien des Selbstbewusstseins. Fichte, Kierkegaard und Dieter Henrich, in: M. Bauer – M. Pohlmeyer (Hg.) Existenz und Reflexion. Aktuelle Aspekte der Kierkegaard-Rezeption, Schriften der Georg-Brandes-Gesellschaft, Bd. 1 Hamburg 2012, 168-198. Und Ders.: True Detective: mit Kierkegaard vorwärts-zurück in die Hölle? GesellschaftsBILDER. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-true-detective/83489, Zugriff am 13.10.2014.
[5]S. Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode. Eine christlich-psychologische Darlegung zur Erbauung und Erweckung von ANTI-CLIMACUS, übers. v. G. Perlet, Stuttgart 2009, 20.
[6]Kierkegaard, Krankheit (s. Anm. 5), 59f.
[7]Kierkegaard, Krankheit (s. Anm. 5), 59f.
[8]Vgl. dazu Kierkegaard, Krankheit (s. Anm. 5), 13: „Verzweiflung ist eine Krankheit im Geist, im Selbst, und kann so ein Dreifaches sein: verzweifelt nicht sich bewusst sein, ein Selbst zu haben (uneigentliche Verzweiflung); verzweifelt nicht man sich selbst sein wollen; verzweifelt man selbst sein wollen.“
[9]T. Gohlis – T. Wörtche: Crime & Money, in: T. Gohlis – T. Wörtche (Hrsg.): Crime & Money, München 2006, 9-19, hier 11.
[10]Gohlis – Wörtche: Crime (s. Anm. 9), 18.
[11]M. Burckhardt: Cybercrime, in: T. Gohlis – T. Wörtche (Hrsg.): Crime & Money, München 2006, 215-238.
[12]Wörtche: Penser (s. Anm. 2), 115. Vgl. dazu auch das Beispiel Großindustrie und Drittes Reich in: É. Vuillard: Die Tagesordnung, übers. v. N. Denis, 2. Aufl., Berlin 2018. Oder Kierkegaard, der in seiner Zeitschrift Der Augenblickmit ironischer Schärfe und analytischer Härte die Verkapitalisierung des Christentums offenlegt.











