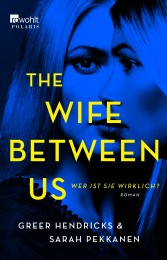 Der Feind in meinem Bett
Der Feind in meinem Bett
Während mit dem „Unknown Girl“ und den „Final Girls“ im Titelwesen der Krimineuerscheinungen weiterhin „gegirlt“ wird, CrimeMag hat sich mit diesem Unwesen schon mehrfach beschäftigt (siehe hier und hier), sind mittlerweile auch die – gewissermaßen – erwachsenen Varianten auf dem deutschsprachigen Krimimarkt vertreten. Im vorigen Jahr gab es bereits „The Women in Cabin 10“, in diesem Frühjahr „The Women in the Window“ und „The Wife Between Us“. Obwohl ganz ohne Frau im Titel, passt auch Karen Clevelands „Wahrheit gegen Wahrheit“ hervorragend in diese Reihe. Gerät doch in allen diesen Büchern mindestens eine Frau in eine Notlage – und wird ihre Wahrnehmung angezweifelt. Sonja Hartl exemplarisch über The Wife Between Us, The Woman in the Window und Wahrheit gegen Wahrheit.
Ehe-Frauen
Spannend ist der Anfang von Greer Hendricks und Sarah Pekkanen „The Wife Between Us“. Scheinbar zwei Frauen erzählen vom selben Mann: Da ist Vanessa, die von Richard getrennt lebt. Eine verzweifelte, emotional traumatisierte Frau. Sie trinkt zu viel, hat Mühe, überhaupt aus dem Bett zu kommen und es zu ihrem Job als Verkäuferin zu schaffen. Die andere Frau ist Nellie, 27 Jahre alt und eigentlich zufrieden mit ihrem Leben als Erzieherin in einem Vorkindergarten. Sie hat nette Freunde, kommt zurecht und hat nun mit Richard den perfekten Mann gefunden. Er sieht gut aus, ist reich und fürsorglich. Gerade sein Beschützerinstinkt, seine Sorge um sie gefällt Nellie, ist sie doch seit einem Vorfall während ihrer Collegezeit ein wenig ängstlich. Bald ist klar: Vanessa ist Richards Ex-Frau, Nellie ist kurz davor ihn zu heiraten.
Schon in diesem ersten Drittel gibt es zu viele Andeutungen im Stile von „Ich war nie die Frau, die er zu heiraten glaubte“, zudem zeichnet sich hier bereits ab, dass Richards und Nellies Beziehung beispielhaft für eine Beziehung mit psychischer Gewalt ist, in der der Mann die Frau zum Schweigen bringt: Er nimmt sie vollkommen in Beschlag, beeinflusst ihre Sozialkontakte außerhalb der Beziehung mit dem Ziel, dass Nellie sie beendet. Er taucht an Orten auf, an denen sie ihn nicht vermutet. Ein wenig zweifelt sie auch an seinem Verhalten, erklärt und verteidigt es gegenüber ihrer Mitbewohnerin und sich selbst aber stets mit seiner Fürsorge und dem vermeintlichen Neid, den ihre Freundinnen empfinden. Dann kommt ein erster Twist, der das zuvor Gelesene in einem neuen Licht erscheinen lassen. Diese Wendung lässt die Folgen der psychischen Gewalt erkennen, macht deutlich, dass der weitere Verlauf der Beziehung dahin führen wird, Nellie ihre Privatsphäre, ihre Selbstachtung und Autonomie zu nehmen. Richard hat einen zwanghaften Kontrollwahn und weigert sich, in Nellie eine Frau mit Fehlern zu sehen. Für Richard ist sie ein „Engel“, der ihn retten soll – natürlich vor ihm selbst.
Diese Entwicklung wird im ersten Drittel des Buchs interessant geschildert. Aber im weiteren Verlauf wird es zunehmend ärgerlich. Die einzige Methode, um Spannung zu erzeugen, besteht in Andeutungen, Andeutungen und noch mehr Andeutungen, die überwiegend noch nicht einmal mysteriös sind. Dazu kommen dann Wendungen, die abermals überraschen sollen, es aber nicht tun. Keine der im Buch auftretenden Frauen – es kommen noch weitere hinzu – befreien sich aus ihrer Opferrolle, versuchen sie es wenigstens, ist der einzige Weg, der ihnen einfällt, eine andere Frau zu einem Opfer zu machen. Ihr Verhalten wird einzig von den Männern in ihrem Leben bestimmt, aber egal, was der Mann auch tut, es gibt immer eine Frau, die noch ein wenig gemeiner erscheint. Damit bleiben die Figuren letztlich Reaktionen auf Betrug, Gewalt und Kontrolle; einzig die mütterlichen Frauen, die Freundinnen und Tanten, kennen einen anderen Weg. Und schlussendlich wird dann sogar die Kontrollsucht des Mannes mit einem Kindheitstrauma erklärt.
Die Frau am Fenster
„The Wife Between Us“ will an den Erfolg des Domestic Thriller anknüpfen, indem das Muster aus traumatisierter und unzuverlässiger Erzählerin, großem Twist und Bedrohung innerhalb einer Beziehung im Schöner-Wohnen-Haus bedient wird. Jedoch ist es am Ende allzu mechanisch. Das ist bedauerlich, denn im gelungenen ersten Drittel wird deutlich, dass es innerhalb dieses Subgenre grundsätzlich möglich ist, (weibliche) Erfahrungswelten aufzugreifen und spannend zu verpacken.
Diese Deutungsrichtung greift Joyce Carol Oates in ihrer Besprechung von A.J. Finns „The Woman in the Window“ im New Yorker auf, indem sie in diesem Buch einen Kommentar auf die #Metoo-Ära sieht. Tatsächlich spricht erst einmal sehr vieles dafür: Anna Fox hat seit Monaten ihre Wohnung in ihrem schicken Haus in New York nicht mehr verlassen. Ihre Zeit verbringt sie vor ihrem Rechner, mit alten Filmen und einigen Flaschen Merlot. Dann glaubt sie, in der gegenüberliegenden Wohnung einen Mord gesehen zu haben. Aber die Polizei glaubt ihr nicht. Dass die Aussage einer Frau wertlos und unglaubwürdig ist, ist ein Produkt der „Rape Culture“. Und ja, auch bei #Metoo wurden und wird vielen Frauen nicht geglaubt. In diesem Thriller kommt jedoch mehr hinzu: Anna Fox ist panisch. Sie ist nicht ansprechbar. Und sie ist sehr betrunken.
Aber „The Woman in the Window“ als Kommentar auf #Metoo zu lesen ist nur eine Lesart – und vermutlich von diesem Buch noch nicht einmal intendiert. Es ist im besten Sinne ein Schmöker, erstaunlich unterhaltsam und sehr geschickt gemacht. Kurze Kapitel, knapper Erzählstil, voller Anspielungen vor allem auf die alten Filme, die KrimileserInnen gerne sehen. Die sich aufdrängende Parallele zu Hitchcocks „Das Fenster zum Hof“ wird im Buch direkt angesprochen.
Die Kurzweiligkeit lässt im ersten Moment auch über die Vorhersehbarkeit einiger Entwicklungen und des Endes hinwegsehen. Nur eines ist dann doch allzu auffällig: Zwar wird alles aus Annas Perspektive geschildert, aber offenbar denkt sie niemals an Sex. Außer einmal, als sie ihn hat. Abgesehen davon ist ihr Innenleben erstaunlich handlungsorientiert. Vielleicht macht sich hier dann doch bemerkbar, dass hinter A.J. Finn ein Mann steckt.
Die Frau, die Spionin
Gleichermaßen Potential wie Kritikpunkt am Domestic Thriller ist, dass er sich ganz auf die häusliche Sphäre seiner Protagonstinnen konzentriert. Hier liest sich Karen Clevelands „Wahrheit gegen Wahrheit“ nun wie ein Versuch, die Vorzüge des Domestic mit dem des Polit-Thrillers zu vereinen: Viviane Miller ist Spionageabwehr-Analystin bei der CIA. Seit einiger Zeit arbeitet sie an einem Algorithmus, mit dem russische Schläfer in den USA enttarnt werden sollen. Dann kommt der große Tag – und sie entdeckt ein Foto, das ihr allzu vertraut erscheint: ihr Mann. Damit wird für sie alles auf den Kopf gestellt, sie sieht ihre Ehe, ihre Familie, ihre vier Kinder in Gefahr. Abends spricht sie mit ihrem Mann und er gibt unumwunden zu, dass er ein russischer Spion ist. Und dann macht Vivian, was ausgewählte und ausgebildete Menschen tun, die bei der CIA arbeiten: Sie meldet, dass sie mit einem russischen Spion verheiratet hat. Nein, das macht sie leider nicht. Stattdessen glaubt sie dem Mann, der sie jahrelang betrogen und belogen hat, jede noch so hanebüchene Erklärung, die er ihr auftischt, denn dieses Buch soll ja von dem Kampf einer Frau erzählen, die ihr Land und ihre Familie retten will. Doch sie kämpft niemals selbst, vielmehr ist sie lediglich ein Spielball, aber sie – und eventuell auch die LeserInnen – sollen in dem Glauben gelassen werden, dass sie über irgendetwas die Kontrolle hat. Da stellt sich höchstens die Frage, wie die CIA eigentlich ihre Mitarbeiter auswählt.
Daher zeigt „Wahrheit gegen Wahrheit“ vor allem, dass die Verbindung aus zwei Subgenres nicht immer etwas gelingt: Die häusliche Bedrohung mit einer Spionagegeschichte zu verbinden, führt letztlich im Grunde genommen zu einem Politthriller, bei dem der Agent/Spion nicht mehr nur sein Leben verlieren kann. Das ist dann eigentlich schon wieder recht typisch – und der Versuch, dennoch immer wieder die Bedrohung von innen herzustellen, ist unglaubwürdig, langweilig und führt dann zu einem ebenso vorhersehbaren wie absurden Ende. Und noch dazu ist es einfach ein weiteres Beispiel dafür, dass eine Frau offenbar als Handlungsmotivation lediglich ihre Ehe oder Familie haben kann. Das Land zu retten ist da wohl weniger wichtig.
Sonja Hartl
Greer Hendricks/Sarah Pekkanen: The Wife Between Us. Übersetzt von Alice Jakubeit. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2018. 448 Seiten, 12,99 Euro. Verlagsinformationen.
A.J. Finn: The Woman in the Window. Übersetzt von Christoph Göhler. Blanvalet, München 2018. 544 Seiten, 15 Euro. Verlagsinformationen.
Karen Cleveland: Wahrheit gegen Wahrheit (Need to Know, 2018). Übersetzt von Stefanie Retterbush. Verlag btb, München 2018. 352 Seiten, 12 Euro. Verlagsinformationen.
Siehe auch Alf Mayers KickAss ohne Worte vom Januar 2017.













