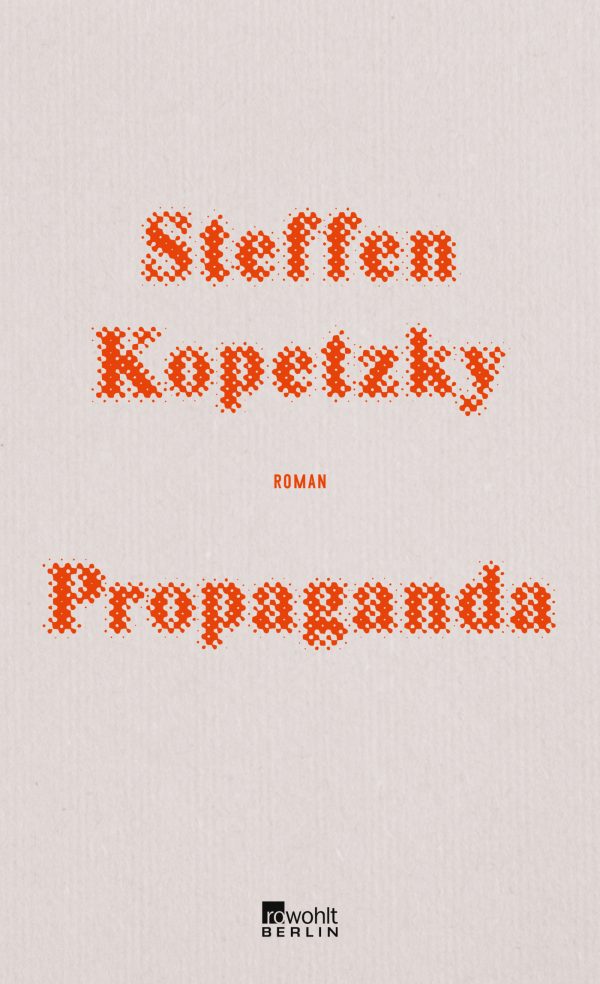
Desillusionierter Freiheitskämpfer wird erbitterter Regimekritiker
John Glueck kämpft 1944 als Leutnant der US- Propaganda-Einheit „Sykewar“ in der mörderischen Hürtgenwald-Schlacht in der Eifel gegen die Wehrmacht. Sein Bild vom hehren Freiheitskampf gegen Nazi-Faschisten wird aber angesichts der Inkompetenz und Gleichgültigkeit der Generäle und der US-Politkaste brüchig und führt zur großen Desillusion. – Rezension von Peter Münder.
An der New Yorker Columbia University hatte er einen Kurs in „Creative Writing“ belegt und sich auf Short Stories kapriziert, dann war John Glueck nach dreimonatiger militärischer Ausbildung aufgrund seiner exzellenten Deutschkenntnisse von der Propaganda-Einheit „Sykewar“ übernommen worden. Gluecks Familie hat deutsche Wurzeln, er fühlt sich mitunter noch wie ein Kölscher Jung. Und das urige „Pennsilfaanien-Deitsch“ ist so etwas wie ein Glückshormon für ihn: „Bischd ei ganz gescheids Yingschi“ etwa –drückt sich darin nicht pure Harmonie und eine überwältigende Freundlichkeit aus? Beim Einsatz auf dem europäischen Kriegsschauplatz ist Deutschland daher für ihn immer noch „das mythische Land meiner Vorfahren“. Eigentlich wollte Glueck für das Propagandablatt „Sternenbanner“ nur ein Porträt seines verehrten Hemingway anfertigen. Und ihn möglichst auch als heroischen Kämpfer in Aktion beschreiben. Nach Saufgelagen mit Hem in einem französischen Hotel auf dem Land, bei dem es auch zum Boxkampf mit einem Reporter kam und nach nächtelangen spannenden Diskussionen und Lesungen mit dem alten Haudegen Hem und dem Nachwuchsautor Salinger im Pariser „Ritz“ wäre so ein realistisch-optimistisches Hemingway-Porträt der perfekte Scoop gewesen. Aber dann wurde Hem zu einem Verhör (wegen allzu wilder Saufgelage und unorthodoxer Umtriebe) vorgeladen und war verschwunden.
Stattdessen findet sich der Sykewar-Reporter bald im unheimlichen Hürtgenwald in einem brutalen Gemetzel gegen die „kampferfahrensten Truppen der Wehrmacht“. Dagegen sind die jungen Gis eher als unerfahrene Pfadfinder-Truppe einzuschätzen, während die Generäle ohne jeden Plan konfus agieren. Glueck entdeckt auf veralteten Reiseführer- Landkarten der Offiziere obendrein, dass der gigantische Staudamm in der Nähe auf ihren Karten nicht eingezeichnet ist. Allmählich dämmert es ihm, dass die reibungslos laufende Versorgung mit Lebensmitteln und Munition durch kilometerlange Lkw-Schlangen all die Defizite einer schlampigen Kriegsführung nicht kompensieren kann. Auch wenn der auf amerikanischer Seite kämpfende geheimnisvolle Irokese mit dem subtilen Gespür für vermintes Gebiet und lebensgefährliche Extremgefahren so erfolgreich deutsche Landser tötet und ihre Skalps als Siegestrophäen ins Lager bringt. Ja, typisch Kopetzky, dieser unerwartete Schlenker: Monotone Erzählstränge sind seine Sache nicht – es gibt regelmäßig einen Stimmungsaufheller, exotische Einschübe, mit denen ein stimulierender oder auch schockierender Kontrast auf neue Aspekte hinweist. Nachdem er den Krieg knapp überlebt hat, charakterisiert sich Glueck dann als „Snakeman“ – da ist er nach einem Unfall mit verseuchten Agent Orange Chemikalien aus Vietnam in die USA zurückgekehrt und leidet an einer chronischen Hautkrankheit, die dem Abstoßen von Hautpartikeln einer Schlange ähnelt. Aber wir wollen den späteren Ereignissen nicht vorgreifen.
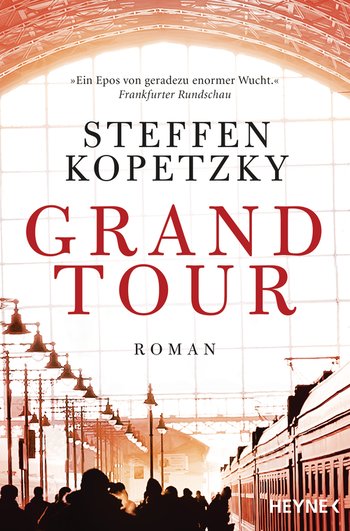
Europäische Eisenbahntouren, kaiserliche Hindukusch-Expedition und nun Hürtgenwald sowie Vietnam-Erfahrung
„Es ist ganz egal, welchem der Schienenstränge wir folgen“, lautet einer der ersten Sätze in Steffen Kopetzkys großartigem Schelmen-Entwicklungs-und Detektiv-Roman „Grand Tour“ (2002) in dem er den studentischen Schlafwagenschaffner Leo Pardell auf seine abenteuerlichen Touren quer durch Europa schickt. „Sie führen fort, verzweigen sich immer weiter und weiter, bis sie in der selbstbewusst aufragenden Südostseite des Genfer Hauptbahnhofs enden, in der theatralischen Kulisse des Bahnhofs von Straßburg, in Genuas orientalischer Phantasmagorie …“.
Der Romancier, Hörspiel-Autor, Theatermann und jetzt auch Kultur-Referent Kopetzky, 47, war immer für kreative Schübe und originelle Einfälle gut. Ihm war es eben auch ziemlich egal, welchem Erzählstrang man als Leser folgte, sie führten einen manchmal in die Irre, verzweigten sich weiter und weiter und führten dann zu einem mehr oder weniger plausiblen Schluss. Was seine Kritiker aber auch leicht auf die Palme brachte, weil Kopetzkys Romane und sein Fabuliereifer einfach nicht in die von Schubladen-Fetischisten bereit gehaltenen, feinsäuberlich mit hübschen Etiketten beklebten Kisten passen wollten. Anstatt sich am Zauber und der Leichtigkeit des „Grand Tour“-Schelmenromans zu erquicken, nörgelten oberschlaue Gutachter im apodiktischen Oberlehrer-Duktus über angeblich allzu irritierende Eskapaden der Roman-Figuren oder über den ins Krimi-Genre abdrehenden Plot um den exzentrischen Uhrensammler Baron Reichhausen und dessen Suche nach dem legendären Super-Chronographen mit der Anzeige für den ach so heiklen Jahreswechsel 1999-2000. Kopetzkys Begeisterung für die Geheimnisse faszinierender Subsysteme dieses Bahn-und Schlafwagen-Systems sind offensichtlich: Er hatte ja selbst wie sein Romanheld Leo Pardell als studentischer Aushilfs-Springer bei der „Compagnie“ gejobbt und so die aufregende Welt hinter dem Schienen-System kennengelernt.
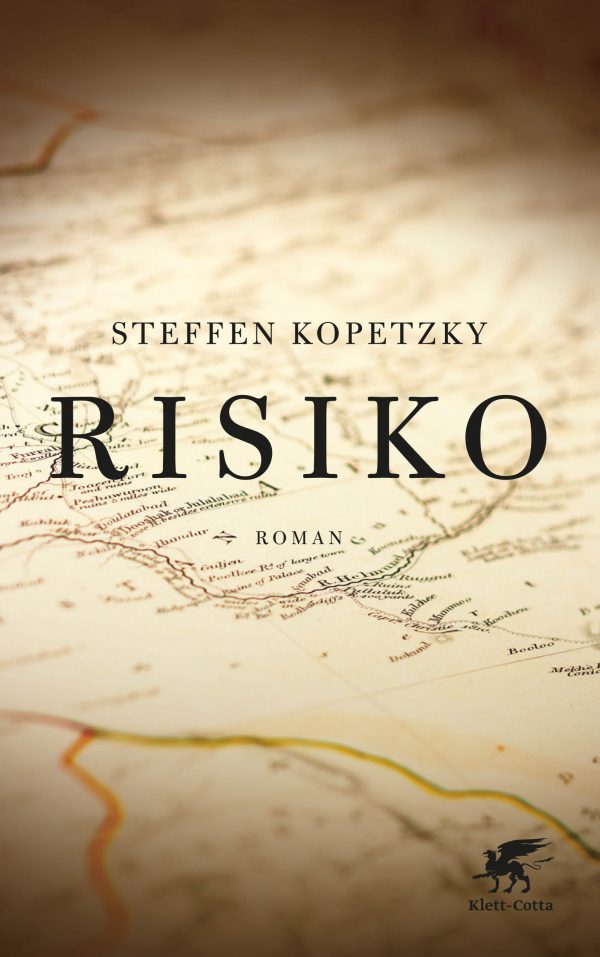
In „Risiko“ (2015) beschrieb Kopetzky die geheime kaiserliche Expedition an den Hindukusch, mit der Orientalisten um Freiherr Max von Oppenheim zusammen mit Militärs während des Ersten Weltkriegs einen islamistischen Aufstand gegen die Briten anzetteln wollten. Nicht nur der junge Marinefunker Stichnote ist in diesem Roman eine besonders faszinierende, einfallsreiche und keinem Abenteuer abgeneigte Figur. Bestechend ist auch Kopetzkys Talent, Themen wie etwa die Spieltheorie inklusive strategischer Brettspiele (als Vorübung für tatsächliche militärische Manöver) mit der aktuellen Problematik einer Instrumentalisierung des Islam für imperialistische Eroberungspläne unter einen Hut zu bringen. Einerseits liefert Kopetzky also pure Karl May-Romantik mit entsprechender Abenteuer-Dramatik, andererseits kann er auch historische Konflikte mit ihren diplomatisch militärischen Strategien auf den Grund gehen. (Siehe dazu auch, von Koeptzky im Verlag Das kulturelle Gedächtnis herausgegeben, Max Freiherr von Oppenheim: Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde, in CrimeMag hier besprochen.)
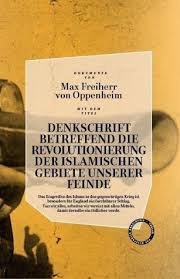
Auch in „Propaganda“ finden sich einige dieser Lieblings-Themen des Autors: Kurz vor der mörderischen Schlacht im Hürtgenwald simuliert der Wehrmachtsgeneral Model in einem Brettspiel die möglichen strategischen Manöver des Gegners und versucht, die Attacken der Amerikaner zu antizipieren. Das Kartenspiel ist für Kopetzky ein weiteres Lieblingsthema (auf alten amerikanischen Pokerkarten prangt eine Freiheitsstatue), außerdem hat er sein Faible für das Seilspringen entdeckt: Im Missouri- Knast, in dem Glueck nach seinem wilden Ablenkungsmanöver (wüste Autofahrt mit maximalem Speed, Griff zur Pistole bei seiner Verhaftung) monatelang eingesperrt wird, kann er sich nur mit Hilfe seiner intensiven Fitness-Übungen mit Seilspringen physisch und mental stabilisieren. Allmählich stellt sich heraus, dass der Sykewar-Kämpfer zum Systemgegner mutierte und dabei behilflich war, die geheimen „Pentagon Papers“ zusammen mit anderen Kriegsgegnern an die Öffentlichkeit zu bringen.
Ganz so flüssig und elegant, wie sich Figuren, historischer Hintergrund und der brisante Plot in „Grand Tour“ und „Risiko“ miteinander verzahnten, funktioniert dies in „Propaganda“ jedoch nicht. Der begeisterte Archivar Kopetzky streut in die laufende Handlung gern historische Exkurse ein- etwa zur kritischen Canaris-Denkschrift über die unmenschliche Behandlung deutscher Kriegsgefangener oder über Stauffenbergs Traum einer großen eurasischen Armee – um zu illustrieren, dass am Ende des Krieges jeder dritte auf deutscher Seite kämpfende Soldat ein Nichtdeutscher war. Und beim Stichwort Eurasien zieht Kopetzky dann die Orwell-Karte: Eurasien gab es ja schon in Orwells 1984… Daher erscheint dann der Bezug zur RAND-Analyse in Vietnam , die aus der Vita des Harvard-Absolventen und „Pentagon Papers“-Lieferanten Daniel Ellsberg bekannt ist, ziemlich überraschend vom Fabulierer Kopetzky aus dem Hut gezaubert . Aber sein Hinweis auf Ellsberg (im Nachwort) ist natürlich wichtig, gerade wenn es um die Auseinandersetzung mit immer noch unbewältigten historischen Kapiteln der amerikanischen Geschichte geht.
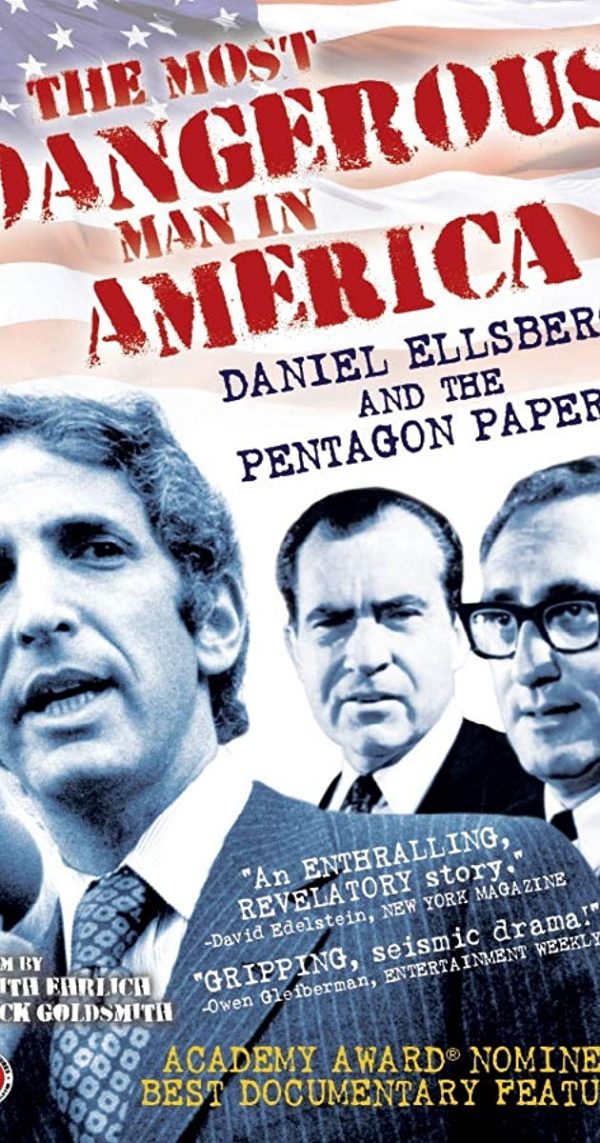
Blick zurück durch die toxische Napalm- und Chemie-Brühe
Streckenweise scheint Kopetzky jedoch abzudriften in eine moralische Beweisführung, die sich auf Daniel Ellsbergs Veröffentlichung der „Pentagon Papers“ im Mai 1971 und auf dessen Vortrag in der Community Church Boston („Ich erkläre den Krieg“) beruft. Wer Ellsbergs Enthüllungsbuch über seine Analyse-Tätigkeit beim Think Tank RAND („Secrets“, 2002) oder die schockierende Studie über Nuklearwaffen „The Doomsday Machine“ (2017/ darüber demnächst mehr auf CrimeMag) gelesen hat, weiß genau, wie erschüttert, wütend und frustriert Ellsberg war, als er all die jahrelangen, systematisch abgesonderten Lügen des Militärs und der Politkaste mitten im Vietnamkrieg registrierte und streckenweise auch als Mitarbeiter von Verteidigungsminister McNamara mitverbreitete („Wir haben zehn Minuten für sechs Lügen“). Selbst nach der martialischen Tet-Offensive von 1968, die einen desolaten militärischen Zustand der US-Truppen offenbarte, erdreistete sich McNamara, auf Pressekonferenzen eine optimistische Lage mitsamt einem bevorstehenden Sieg zu suggerieren. Diese Strategie systematischer Lügen und Beschönigungen war jahrzehntelang von US-Präsidenten und hohen Militärs praktiziert und in den Analysen der RAND-Corporation festgehalten worden. Nixons Lügen und Kissingers Täuschungsmanöver hinsichtlich der Bombardierung von Laos und Kambodscha gehörten ebenso dazu wie der aufgebauschte nordvietnamesische Angriff vom 4. August 1964 auf das US-Patrouillenboot USS Maddox im Golf von Tonkin. Dieser Zwischenfall wurde vom Militär und vom Präsidenten LBJ Johnson als Vorwand zur Ausweitung der Kampfzonen in Vietnam instrumentalisiert und als offizielle nordvietnamesische Kriegserklärung interpretiert. Ellsberg war damals einer der ersten Empfänger der Maddox-Telegramme in Washington und konnte sich als RAND-Analytiker von den manipulierten US-Darstellungen überzeugen. Daher reagierte er dann auch so empört auf Präsident Bush und dessen Irak-Invasion, die auf den Lügen über angebliche irakische Massenvernichtungswaffen basierte. Ellsberg organisierte 2003 Protest-Demos, auf denen er auf die Parallelen zur Instrumentalisierung der Tonkin-Lüge für einen Angriffskrieg hinwies.
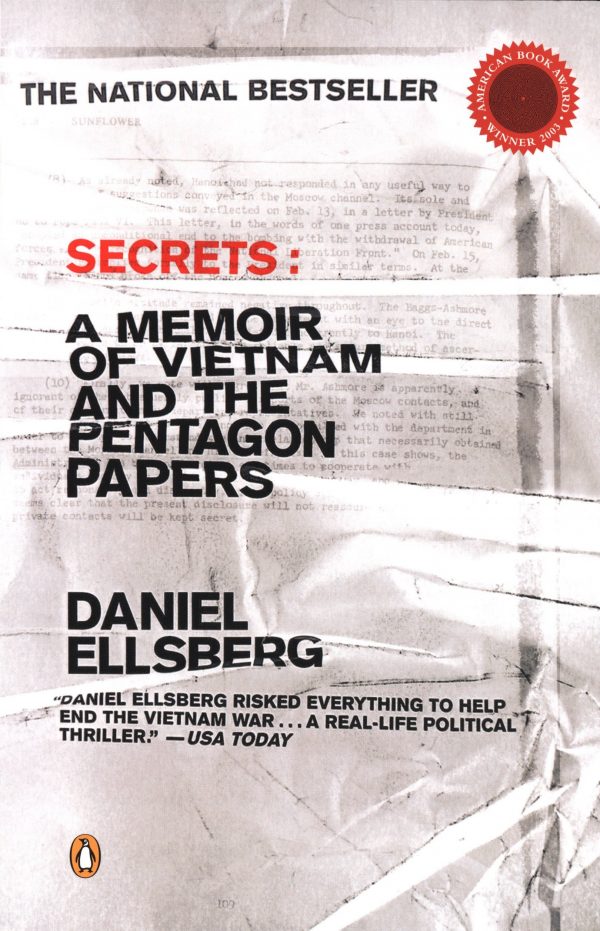
Die von Ellsberg betriebene Veröffentlichung der Pentagon Papers durch die „New York Times“ und „Washington Post“ hatte die US-Öffentlichkeit zwar aufgerüttelt, aber Ellsberg wies in „Secrets“ auch darauf hin, dass es ihm nicht so sehr um diese Publicity ging, sondern primär um die Bedrohung durch Nuklearwaffen. In den Rand-Szenarios zum Vietnamkrieg wurde regelmäßig über die Zahl der Opfer spekuliert wenn China oder auch die Sowjetunion mit in den Vietnamkrieg hineingezogen würden: Die Zahlen lagen zwischen 275 Millionen Toten (das Minimum) und 325 Millionen (Maximum). Und Nixon und die anderen Präsidenten setzten einfach weiter auf die „Nuke“-Karte – das war der entscheidende Impuls für Ellsberg, gegenüber diesem Polit-Establishment einen extremen Konfrontationskurs einzuschlagen und eventuell auch hundert Jahre Knast (wie es Juristen damals androhten) in Kauf zu nehmen. Bekanntlich wurde die Anklage gegen Ellsberg ja wegen illegaler Abhörpraktiken staatlicher Instanzen abgeschmettert: „Die Presse hat den Regierten und nicht der Regierung zu dienen“, konstatierte damals der Richter – wahrlich ein großes Wort, so lässig verkündet! Können wir ähnliche Verdikte auch in diesen turbulenten Twitter-Zeiten erwarten?
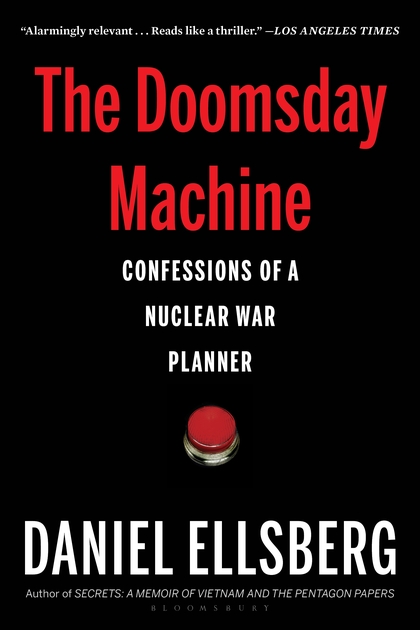
Inzwischen hat der 88jährige, immer noch sehr aktive Leak-Unterstützer Ellsberg nun nach Trumps Amtsantritt dessen explizite Aufforderung zur Aufstockung von US- Nuklearwaffen um das Zehnfache (!!!) in „The Doomsday Machine“ scharf kritisiert und gleichzeitig nochmal die menschenverachtenden Zahlenspiele der Militärs und der US-Politkaste hinsichtlich zukünftiger Atomwaffen-Einsätze (mindestens 400 Millionen Tote) beschrieben. Die hatte der Zukunftsforscher Hermann Kahn schon vor Jahrzehnten „Wargasm“ genannt.
Steffen Kopetzky ist in „Propaganda“ wohl auch angesichts dieser beängstigenden Doomsday-Entwicklung auf diese seit dem Vietnamkrieg grassierende Lern-Resistenz einer mächtigen Militär- und Politkaste eingegangen. Und wahrscheinlich hat diese düstere politische Phase der letzten Jahre – speziell das irre Treiben eines größenwahnsinnigen Dealmakers im Weißen Haus – den Romancier Kopetzky zu einem weniger überschwänglichen Fabulier-Stil als in „Grand Tour“ oder „Risisko“ geführt. Den Bogen vom Hürtgenwald-Gemetzel und vom Binge-Säufer Hemingway bis zum Vietnam-Trauma mit Napalm und Agent Orange schließt der Erzähler übrigens mit den Stammtisch-Thesen eines unverbesserlichen Generals, der verkündet: „Wir müssen einfach nur die Bombenlast steigern, das Ganze ist einfach nur eine Frage der Quantität. Mehr Bomben, Mehr tote Feinde. Ganz einfach“.
Keine Frage: Kopetzky macht es einem nicht leicht mit Episoden, in denen Hemingway, Salinger oder sogar Bukowski wie in einem Name-Dropping-Seminar auftauchen und dann blutige Weltkriegs 2-Gemetzel in der Eifel im gnadenlosen Tarantino-Stil ablaufen, bis der Snake-Man schließlich seinen Unfall in Vietnam erklärt und seine spezielle Umwertung aller Werte offenbart. Kopetzky braut eben immer noch seine ganz eigene, spezielle Kombination von „Light“ und „Düster“ zusammen – literarische Mainstream-Anbiederung war noch nie seine Sache. Und das ist auch gut so!
Peter Münder
- Steffen Kopetzky: Propaganda. Rowohlt Verlag, Hamburg 2019. 495 Seiten, 25 Euro.
Vgl. dazu: Daniel Ellsberg: Secrets. A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers. Viking Penguin New York 2002, 498 Seiten.
ders.: The Doomsday Machine. Confessions of a Nuclear War Planner. Bloomsbury 2017, 420 Seiten.











