
Mundus vult decipi
Der „klassische“ Polit-Thriller scheint ein bisschen an Boden zu verlieren. Aber ist das verwunderlich? Ein paar ungeordnete, unsystematische und sehr vorläufige Überlegungen von Thomas Wörtche.
I
Schlechte Zeiten für Paranoia, sie hat keine gute Presse, im Moment. Dem ollen Kalauer: Being paranoid doesn’t mean they are not out to get you droht die Gefahr, albern zu werden. Die gute, alte Paranoia ist in die falschen Hände gefallen. Vermutlich muss man jetzt sogar erwähnen, dass man mit „Paranoia“ keinen klinischen Befund meint, sondern eine soziopolitische Denkfigur, die hinter dem Konsensualen, dem Offiziellen, dem Verlautbarten stets eine andere Wahrheit vermutet- oder zumindest andere Wahrheitsoptionen. So gesehen war Paranoia ein durchaus sinnvolles, wenn auch ein wenig exaltiertes Instrument aufklärerischen Denkens. Ein ähnliches Schicksal hat auch ihre Schwester, die Verschwörungstheorie, erlitten. Der literarische Ort der Paranoia war vor allem der Polit-Thriller, der mehr umfasst als nur den klassischen Spionageroman. Der Polit-Thriller, nicht nur erst seit Corona, hat es schwer.
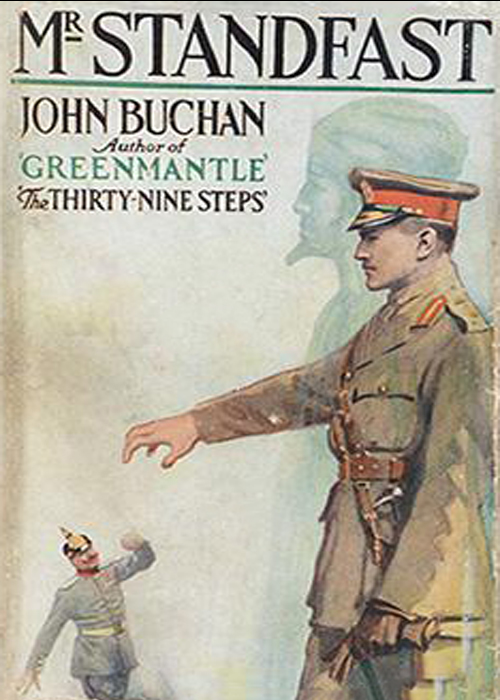
II
Eine grimmige Ironie liegt darin, dass die literarischen Anfänge des Polit-Thrillers (John Buchan, Erskine Childers) stramm patriotisch, gar national-chauvinistisch waren. Der lasche Staat, das demokratische United Kingdom musste von wackeren Einzelkämpfern gerettet werden, die den 1. Weltkrieg gegen die Hunnen kommen sahen. Wobei eher nicht der dekadent gewordene Staat rettungsbedürftig war (denn der war von moralisch dubiosen Eliten heruntergewirtschaftet), sondern eher das aufrechte, gesunde Volk, das die traditionellen Werte aufrechterhielt, notfalls gegen den Staat. Der Polit-Thriller kam zunächst von rechts. Vor allem da, wo er kommerziell erfolgreich war. Er schwamm in der Zeitströmung mit.
Die neuen Bedrohungen in der Zwischenkriegszeit, also der italienische Faschismus und der deutsche Nationalsozialismus (in wenigen Fällen auch der Stalinismus) zeitigten eine kapitalismuskritische Wende – vor allem bei Eric Ambler. Graham Greene und Geoffrey Household gingen in eine ähnliche Richtung. „Paranoides“ Denken wurde ein Instrument linker Aufklärung.
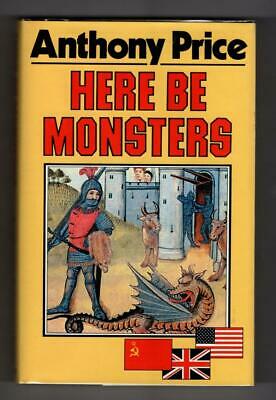
Im Kalten Krieg kam es zur nächsten Bifurkation. Right or wrong, my country – bei Ian Fleming oder Anthony Price (siehe zu ihm auch unseren Klassiker-Check), dann bei Tom Clancy oder Patrick Robinson wird dieses Prinzip erkenntnisleitend, während die Skeptiker wie John le Carré, Ross Thomas, Brian Freemantle oder Robert Littell, die kritischen Potentiale der Paranoia literarisch zu nutzen wussten. James Gradys „Sechs Tage des Condors“ wies die Hegemonialmacht der „Dienste“ vor allem als Feind ihrer eigenen Leute aus. Von „links“. Der Kalte Krieg war noch Vorwand für ein möglichst unkontrollierbares Treiben der „Dienste“, notfalls im privatwirtschaftlichen Interesse. Oder im Interesse einer nicht mehr als solche rational vermittelbaren Staatsraison, wie viele Polit-Thriller aus dem Vietnam-Krieg betonten („Operation Phoenix“ von Nicholas Proffitt). Egal wie, die Rhetorik der „Anschuldigung“ (Luc Boltanski) richtete sich gegen die real Herrschenden, ob damit nun ein „tiefer Staat“ gemeint war oder der „militärisch-industrielle Komplex“ oder ganz allgemein der sich über die Jahrzehnte immer stärker formierende Neoliberalismus.

III
Nicht das Ende des Kalten Krieges hat den Polit-Thriller (vor allem in seinem Spezialbereich Spionageroman) beschädigt, auch nicht, dass die Welt zu unübersichtlich geworden wäre, um zu erzählen, wie es „wirklich auf ihr zugeht“ (das war schon immer argumentativer Unfug). Sondern das kreative und ludistische Zerschreddern von verordneten Gewissheiten, das den Polit-Thriller einst zum intelligenten Vergnügen – und damit zur Königsklasse der Crime Fiction – gemacht hat, ist prekär geworden.

Das Zerschreddern von Gewissheiten ist im Zeitalter der neuen, globalen Rechtspopulisten zu deren bevorzugter medialen Technik geworden. Trumps Hetze gegen „Eliten“ meint nicht mehr die Hegemonie der Finanzwirtschaft, sondern eher die gesellschaftlichen Formationen, denen es um eine Einhegung genau dieses neoliberalen Konzeptes geht. Auch die AfD insinuiert hinter der „Realität“, repräsentiert von der „Lügenpresse“ eine andere, tiefer liegende Realität („Umvolkung“). Das tangiert auch die Literatur: Da wo der klassische „linke“ Polit-Thriller der Ambler/Thomas/Grady-Tradition die Faktizität des Faktischen zersetzt und verätzt hat, Subversion betrieben, offizielle Verlautbarungen, offizielle Konsense, offizielle Ideologien „hinterfragt“, sie notfalls der Lächerlichkeit preisgegeben und sie dekonstruiert hat, setzen die rechten Narrative an. Allerdings mit einem signifikanten Unterschied: Die postfaktischen Narrative (jetzt gerne „Verschwörungstheorien“ genannt) synthetisieren die zerstäubten Splitter offizieller Verlautbarungen zu etwas lediglich „innerlich“ konsistenten Neuen. Egal wie bescheuert und bekloppt solche Narrative sind – Reptiloide, Pizzagate etc. -, sie sind Gegenkonzepte, deren Plausibilitätsdefizite keine Rolle mehr spielen, sowenig wie bei den ganzen weltmachtheischenden Superschurken von Ian Fleming, ohne dass sie deswegen rein metaphorisch aufgefasst werden könnten, wie das bei den Superhelden-Comics (und deren medialen Spin-Offs) gerade noch interpretativ hinzubiegen wäre.

IV
Wo aber liegen die Ursachen für diesen Umkehrschub? Die geostrategische Legitimation des Vietnamkrieges (Eindämmung der kommunistischen Gefahr) war evident zu Farce geworden, die Aktivitäten der USA in Mittel- und Südamerika mit einer analogen Rechtfertigungsrhetorik (War on Drugs aus durchaus imperialistischen Gründen) waren durchsichtig, das Fallenlassen des afghanischen Widerstand gegen die sowjetische Besetzung ein offen liegendes politisch-moralisches Desaster – alles Vorgänge, hinter denen man nicht mehr eine noch ungeheuerlichere Realität vermuten musste. Man konnte nur noch die Legitimationsstrategien angreifen, die immerhin zumindest theoretisch noch ein Gran benevolent gemeinter Intention haben konnten (wenn das auch de facto sehr unwahrscheinlich war). Allerspätestens mit Colin Powells Uno-Rede über Massenvernichtungswaffen als Legitimation für den Irak-Krieg war die Lüge offensichtlich offiziell geworden. Sie war nicht mehr hinterfragbar, sie bot keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten an. Das Komplott – eine Zentralkategorie des Polit-Thrillers – hatte sich selbst veröffentlicht. Und das hat fatal gut funktioniert. Fortan war die Botschaft in der Welt, dass nichts zu irrsinnig oder zu schamlos ist, um geglaubt zu werden. Die neuen Potentaten à la Trump, Erdogan, Lukaschenko & Co. suhlen sich nachgerade in dieser Lehre. Die Literatur aber, die von der fiktiven Enthüllung oder zumindest von der Enthüllbarkeit solcher Ranküne lebt, ist dann arbeitslos geworden.
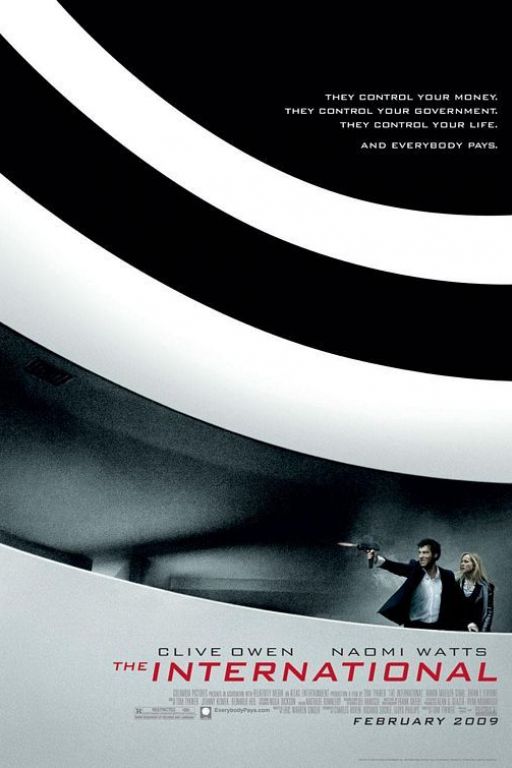
V
Liest man die „Klassiker“ des aufklärerischen Polit-Thrillers von heute, sieht man Zeitdiagnosen über Korruption, Werteverfall, Staatsverbrechen, moralischer Indolenz der Herrschenden, Primat des Profits über Menschenrechte, also sozusagen ein Gruselpanoptikum der neoliberalen Moderne (zu der noch der widererstarkende Sexismus und Rassismus konstitutiv hinzugekommen sind). Eine Diagnose, die sich die neue Rechte angeeignet hat, nur mit umgekehrter Stoßrichtung und umgekehrter politischer Agenda.: Die Missstände der Demokratien sind nicht durch mehr Demokratie, sondern durch weniger Demokratie zu beheben. Die Verfasser der „subversiven“ Narrative sind zu Nestbeschmutzern geworden. Ihr Verzicht auf Gegenbildlichkeiten ist ihre realpolitische Achillesverse, aber er bleibt eine literarische Tugend. Der Verzicht auf Sinnstiftung und Gegenbildlichkeit, ihre oft ironische Grundhaltung werden zum Grund der Ablehnung, worin sich reaktionäre und „menschenfreundliche“ Positionen oft unbehaglich einig sind: „Ich mag keine Polit-Thriller“ ist ein oft gehörtes Statement, das, wie alle reinen Geschmacksurteile, keineswegs so unschuldig ist, wie sie oft dahergeplappert kommt, denn das Bedürfnis nach „Sinn“, und sei er noch so krude, spielt denen in die Hände, die „Sinn“ verkaufen – je einfacher und unterkomplexer, desto erfolgreicher. Nichts scheint homo sapiens fürchterlicher zu sein als Kontingenz. Das ist extrem beunruhigend.
VI
Ich rede hier ziemlich vermischt über Realpolitik und Fiktionen. Das hat mit der Doppelbindung des Polit-Thrillers zu tun. Seine Impulse empfängt er einerseits aus seiner literarischen Reihe (Ambler z.B. hat explizit als Replik auf John Buchan angefangen), aber er ist andererseits immer an die politische Großwetterlage gebunden, die, will er ernstgenommen werden, immer reflektiert, wie vermittelt auch immer. Einen l´art pour l´art-Politthriller kann es höchstens als albernes Surrogat geben. Und selbst das würde Realien transportieren, nolens volens.

Wenn die literarische Methodik des Polit-Thrillers zur Blaupause für rechte Agitation werden kann, haben wir ein Problem. Es kann nicht wirklich trösten, dass es kaum ernstzunehmenden Polit-Thriller von „rechts“ gibt (grundsätzlich: Kann es sowas überhaupt geben, auf Niveau?), und erst recht nicht, dass die schwindende Akzeptanz des Polit-Thrillers darin liegen mag, dass nicht nur bei der Produktion, sondern auch bei der Rezeption Kenntnisse und Kompetenzen von Nöten sind, die einer einfachen „Lesbarkeit“ zunehmend im Wege stehen, weil Komplexion einer gewünschten Sinnstiftung (und einem gewünschten „Identifikationspotential“) eher hinderlich zu sein scheinen. Ein zusätzliches Problem liegt auch darin, dass der Polit-Thriller im großen Ganzen einer Männerdomäne zu sein scheint – Ausnahmen wie etwa Dominique Manotti oder Jenny Siler bestätigen eher die Regel, was allerdings dann nicht gilt, wenn man den gesamten Komplex „politische Kriminalliteratur“ betrachtet, wo Autorinnen von Sara Paretsky bis Merle Kröger eine starke Position haben. Vielleicht liegt darin sogar eine gewisse List der Vernunft und damit Hoffnung: Die Verschiebung des Politischen in allgemeinere Formen der Kriminalliteratur – kein neues Phänomen seit Hammetts „Red Harvest“, aber doch bemerkenswert.
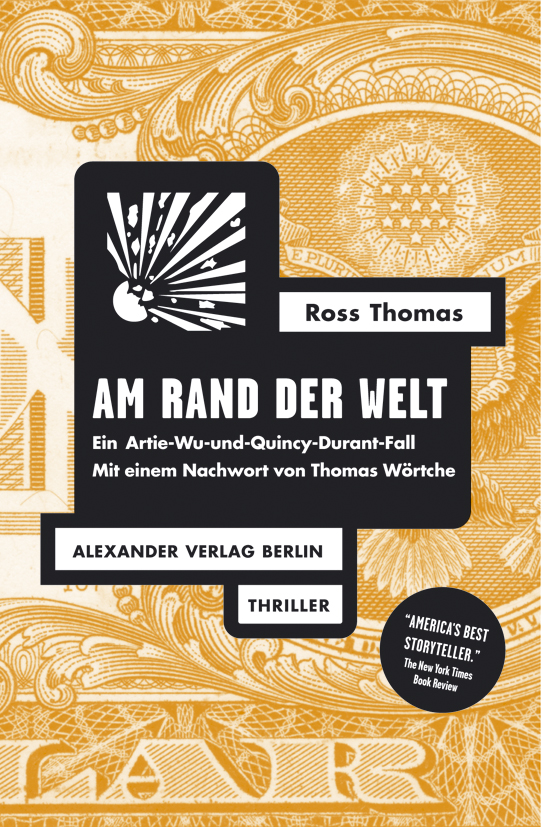
Klar, alle Kriminalliteratur ist politisch, aber abseits dieser ehernen Binse, ist doch interessant, dass ein Antidot gegen die Vereinnahmbarkeit aufklärerischer Konzepte von der Gegenaufklärung die literarische Form sein könnte. Auch das ein Argument mit historischer Dimension und einem Schuss Ernüchterung: Die Megaseller ihrer Zeit, also Ian Fleming, Tom Clancy oder Frederick Forsyth unterschieden sich nicht nur in ihrer politischen Grundhaltung von ihren „liberaleren“ Konkurrenten (John le Carré vielleicht ausgenommen, aber der hat einen gewissen Wandel durchgemacht: vom skeptischen Kalten Krieger zu einem wütenden Kritiker des globalen Neoliberalismus), sie unterscheiden sich auf jeden Fall im Grad ihrer Literarizität, die etwa bei Ross Thomas oder Robert Littell oder beim späten James Grady wesentlich höher einzuschätzen ist, als die ihrer literarisch eher einfachen Opponenten. Das ist kein snobistisches Werturteil, sondern eine Beschreibung und ein Hinweis auf die Mechanismen von Populärer Kultur.
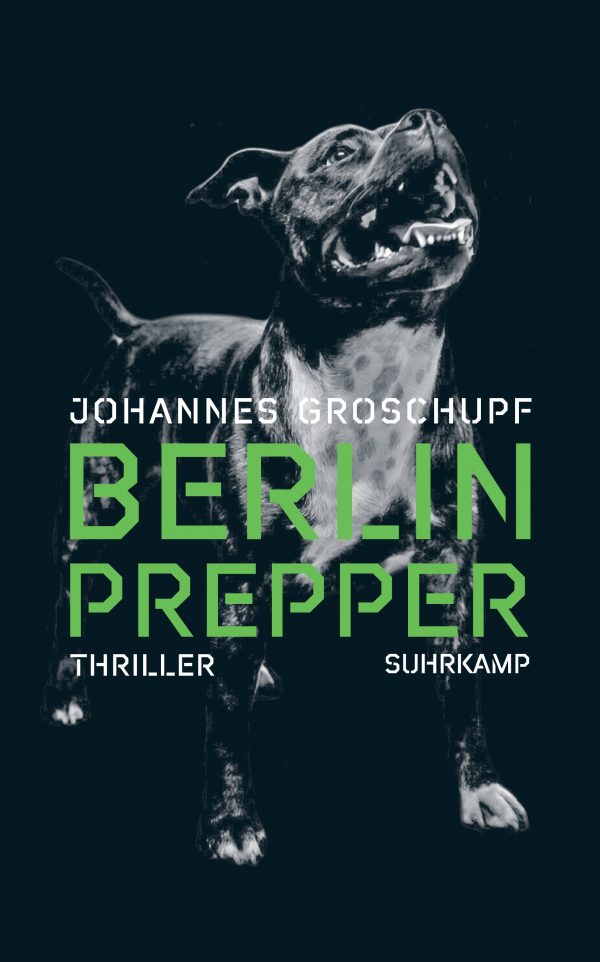
VII
Aber es ist auch schon gar kein Aufruf, einfache Formen mit „fortschrittlichen“ Elementen zu füllen. Weltbilder in der Literatur korrelieren nun mal mit ihrer ästhetischen Inszenierung. Auffällig ist auf jeden Fall, dass „Polit-Thriller“, die einen gewissen Impact beim Lesepublikum haben wollen und sollen, sich noch mehr von Erzählkonventionen lösen müssten. Das kann dystopisch sein wie bei Max Annas‘ „Finsterwalde“, kalkuliertes Understatement betreiben wie Johannes Groschupfs „Berlin Prepper“, Montagetechniken benutzen wie Merle Körgers „Havarie“, anhand purer Action Strukturen darlegen wie Andreas Pflügers Jenny-Aaron-Trilogie oder parodistisch überzeichnen wie Christian von Ditfurths Bodt-Romane, oder die „gegnerische Position“ so exaltieren, dass sie in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit sichtbar wird, wie Aidan Truhens „Fuck you very much“. Solche Narrrative sind dann von ihrer Ästhetik derart geschützt, dass sie nicht mehr zu kapern sind.
VIII
Auf jeden Fall scheint das alte „Realität hinter der Realität-Spiel“ ausgereizt, wenn Fakenews die Akzeptanzschwelle längst überrollt haben, die einst den Anreiz gegeben hatte, hinter die Realitäten kommen zu wollen – und sei´s auf fiktionalem Weg. Es gibt hinter der „Realität“ und der Offenheit der Intentionen keine „andere“ Realität mehr, außer dem Offensichtlichen. Sei es Schwachsinn (Verschwörungstheorie) oder beinharte, skrupellose politische Agenda, die das Prinzip mundus vult decipi bis zur Perfektion verstanden hat. Was wiederum eine neue Variante in der Dialektik der Aufklärung bedeuten würde.

Auch wenn das heißt, dass sich der Polit-Thriller oder die politische Kriminalliteratur mit ihren literarischen Mitteln neuen Konsensen und neuen politischen Formationen stellen muss – Popularitätsverlust einkalkuliert, ihn aber nicht als notwendig und alternativlos akzeptiert. Die Avantgarden von heute sind vielleicht dann doch der Mainstream von morgen, so wie es der feministischen Kriminalliteratur gerade zu gelingen scheint. Auf dem Schirm sollte man diesen Wandel auf jeden Fall haben.
© 05/2020 Thomas Wörtche











