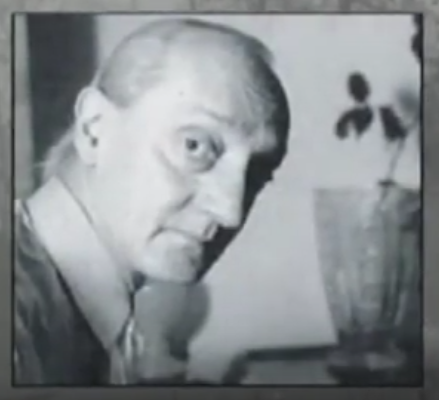 Mit dem Skalpell
Mit dem Skalpell
Er ist einer der großen Kriminalautoren des 20. Jahrhunderts. Seine vier Romane mit dem illusionslosen Ermittler Duca Lamberti werden nun bei Folio wieder aufgelegt, jeder Band mit einem Nachwort ausgestattet. Wir präsentieren Ihnen hier das aus „Die Verratenen“, weil es – über das Buch hinaus – dessen Lektüre hiermit nicht erlassen wird – ein aktualitätstüchtiges Porträt von Giorgio Scerbanenco zeichnet.
Von Tobias Gohlis
Giorgio Scerbanenco. Vergessen? Bevor ich die vier Romane um Duca Lamberti wieder und neu las, löste der Name des vor fast fünfzig Jahren verstorbenen Autors Assoziationen bei mir aus, die eher ins Museale wiesen. Da gab es doch diesen Premio Scerbanenco für Kriminalliteratur, Reminszenz an einen italienischen Gründervater. So wie der deutsche Glauserpreis an einen Gründervater gemahnt, den kaum ein lebender Autor gelesen hat. Aber wie bei Friedrich Glauser ging es mir auch mit Scerbanenco: Nix Museum, da ist Power drin.
Als Erstes, noch vor den ersten Leichen, nimmt man den knochentrockenen, in Ironien verschiedener Art eingelegten Ton Scerbanencos wahr. „Es ist schwer, zwei Menschen gleichzeitig umzubringen.“ Achtung, hier spricht ein Skeptiker. Und statt dem aufgeweckten Leser zu erklären, wie die Täterin, den Schwierigkeiten zum Trotz, ihren Doppelmordplan realisiert, macht sich der Erzähler, ihre Perspektive ein wenig teilend, lustig über die Opfer. Erzähler und Täterin beobachten sie, wie sie fett und müde auf dem Rücksitz abhängen. Das Gesicht der Frau „erinnerte an einen großen Frosch, obwohl sie doch einst, vor Millionen von Jahren, der Krieg, der Zweite Weltkrieg, war noch nicht vorüber, sehr schön gewesen war, wie sie selbst behauptete“.
Alle Todesarten der Menschheit
Zwei Menschen gleichzeitig umbringen? Nichts leichter als das! Im „vor Millionen von Jahren“ beendeten Zweiten Weltkrieg war das tagtäglich bewiesen worden. Und in gewisser Weise ist er jetzt, im Jahr 1965, immer noch nicht vorüber. Ganz praktisch: Der Mord an Adele Terrini, der Hure, von einem Trottel auch „die Hoffnung“ genannt, und ihrem Freund, die unter Hinterlassung einiger Luftblasen im Naviglio Pavese verschwinden, ist in gewisser Weise einer der letzten Akte dieses Krieges. Doch das wissen wir Leser noch nicht, können es aber ahnen. Denn die Amerikanerin, die den Mord begeht, wird uns, die wir diesen Roman mehr als fünfzig Jahre nach seinem Erscheinen lesen, als jemand vorgestellt, der mit allen Todesarten vertraut ist, die die Menschheit sich ausgedacht hat.
Als Giorgio Scerbanenco mit dem Satz über die Schwierigkeit, zwei Menschen gleichzeitig umzubringen, den zweiten Duca-Lamberti-Roman begann, machte er nicht nur einen kleinen sarkastischen Witz. In dem er anklingen ließ und lässt, dass für ihn Mord kein Rätselspiel ist, bei dem es um die Auswahl der besten CurareSorte geht, sondern um Totschlag im Wortsinn, um richtiges und nicht um Theaterblut, bezog er Stellung in einer poetologischen Debatte. Für Chandlers Realismus, gegen Christies Rätselspielchen.

Als Giorgio Scerbanenco im Alter von 54 Jahren die Tetralogie um den Arzt, Detektiv und Polizisten Duca Lamberti begann, war er bereits ein äußerst erfahrener Schriftsteller. Der Literaturwissenschaftler Roberto Pirani kam 2011 zu der „unvollständigen“ Liste von 92 Romanen, 1380 Kurzgeschichten, 17 Sammelbänden mit Erzählungen, 3 Essays, 2143 kleinere Prosastücke und Reflexionen, 296 Artikeln in Zeitschriften und Zeitungen, 40 FotoLoveStories, 7 Radiodramen und 2 Gedichten, die Scerbanenco zwischen 1932 und 1969 veröffentlicht hat.
Neben vielen, vielen Krimanalgeschichten und -erzählungen hat sich Scerbanenco in seinem Schriftstellerleben zweimal auf den „Giallo“, den Kriminalroman, eingelassen. In beiden Fällen suchte er nach neuen Wegen. In der 1940 bis 1942 erschienenen fünfteiligen Serie um den Bostoner Polizeiarchivar Arthur Jelling wählt er keine klassische Ermittlerfigur, sondern einen an psychologischen Motivlagen interessierten Außenseiter der Polizeipraxis, der zudem auf fremdem amerikanischem Terrain ermitteln muss, weil Mussolinis Zensur fast keine Kriminalromane zuließ, die in Italien spielten.
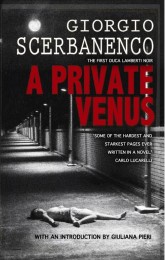 Das verborgene Innenleben der italienischen Gesellschaft
Das verborgene Innenleben der italienischen Gesellschaft
In den vier vollendeten Romanen um Duca Lamberti schuf Scerbanenco, der das amerikanische Hardboiled-Modell gut kannte, 1966 bis 1969 einen originär italienischen Detektiv. Der zunächst einmal das war, wie sich Scerbanenco zeitlebens fühlte: ein Außenseiter.
Scerbanenco wurde 1911 als Vladimir Šerbanenko in Kiew geboren. Seine Mutter war Italienerin, sein Vater Ukrainer. Als er sechs Monate alt war, floh seine Mutter nach Rom. Als sie 1920 auf der Suche nach dem Vater nach Kiew zurückkehrten, entdeckten sie, dass der Vater von Rotgardisten ermordet worden war. 1927 übersiedelten Mutter und Sohn von Rom nach Mailand, wo er – schon des muttersprachlichen römischen Dialekts wegen – als Außenseiter galt. Da Scerbanenco keinen Schulabschluss hatte, schlug er sich unter anderem als Rettungsfahrer und Buchhalter beim Roten Kreuz durch, das sind Quellen der medizinischen Kenntnisse Duca Lambertis. Neben seiner Tätigkeit als Romancier, darunter finden sich eine Menge Liebes und Frauenromane, aber auch ScienceFiction und Western, war er sehr erfolgreich als Gründer und Leiter von Frauenzeitschriften. Berühmt war er als Briefkastenonkel „Adrian“. Er kannte das Leben der Frauen in seinen sozialen und intimsten Einzelheiten. Und damit das verborgene Innenleben der italienischen Gesellschaft.
Das kennt Duca Lamberti auch. In der Auswahl des Vornamens seines Protagonisten zeigt sich Scerbanencos ganzer Sarkasmus. Er funktioniert wie ein Skalpell. Duca bedeutet Herzog und ist Ausdruck all der Hoffnungen, die Lambertis Vater in seinen Sohn setzte. Er finanzierte ihm das Medizinstudium und anschließend die feine Praxis, obwohl er nur ein kleiner Polizeibeamter war. Umso furchtbarer war dann Lambertis Untergang: Weil er einer sterbenskranken Frau das Leiden verkürzt hatte, wurde ihm die Approbation entzogen, der Vater starb nach einem Besuch des Sohnes im Knast an gebrochenem Herzen. Duca, der eingebildete Wunsch-Herzog, ist nicht nur mittellos, sondern überdies verpflichtet, nach seinem Gefängnisaufenthalt irgendwie für seine Schwester und deren uneheliches Kind zu sorgen, weil diese sonst auf „Almosen angewiesen“ wären. Der schöne Traum einer bürgerlichen Existenz (für deren Erhalt sein Schöpfer Scerbanenco schuftete bis zum frühen Zusammenbruch mit 58 Jahren) war in einem Akt gesetzwidriger Nächstenliebe zerstoben. Und, was die Schwester betrifft: Ihre Liebe fand auch keinen Hafen in der bürgerlichen Ehe. „Alles von vorn bis hinten falsch.“
Erklären hilft nichts
In allen vier LambertiRomanen wird offenkundig, dass nichts mehr zusammenpasst. Alles ist im Fluss, in Zersetzung, als Erstes die Moral. Dieser Lamberti ist eine faszinierende Figur, weil er selbst den Boden unter den Füßen verloren hat. Im Unterschied zum räsonierenden Papiermenschen Jelling steht er mitten im Leben. Lamberti muss handeln, das heißt, sich ständig zu entscheiden zwischen Moral und Gesetz, auf dem schmalen Grat zwischen Überleben und Anstand.
Und das ist, gelinde gesagt, nicht einfach. Mit großartigem Gespür für tragische Zuspitzung hat Scerbanenco seinen Protagonisten nicht wegen eines alltäglichen ärztlichen Vergehens, einer unerlaubten Abtreibung etwa, aus dem bürgerlichen Orbit gestoßen. Sondern weil er in einem moralischen Jahrhundert-Dilemma eine Entscheidung getroffen hat. Die Italiener nennen es eutanasia, Sterbehilfe. Ein Begriff, der durch die Massenmorde der Nazis an als „unwürdig“ deklariertem Leben im Deutschen unbrauchbar geworden ist. Brennend ist der Fall immer noch: Fast zehn Jahre wurde Piergiorgio Welby gegen seinen Willen künstlich am Leben erhalten, gerichtlich wurde passive Sterbehilfe untersagt, und als er 2006 nach Abschaltung seines Beatmungsgeräts starb, verweigerte ihm die Katholische Kirche die Bestattung unter ihrem Zeichen. Lamberti handelte nach einer anderen Moral als der der bedingungslosen Lebenserhaltung, als er Signora Maldrigati mit einer Spritze von der Todesangst erlöste, die sie jedes Mal befiel, wenn jener Arzt das Zimmer betrat, der ihren bevorstehenden Tod prophezeit hatte. Seine „Beweggründe waren humanitärer Art“, heißt es in dem Schreiben, das ihm sein Polizei-ÜberIch und Mentor Carrua vorlegt, um seine Rehabilitierung zu befördern. Lamberti konnte schlicht die Angst der alten Frau nicht mehr ertragen. Es sind pure menschliche Instinkte, die ihn leiten: Mitleid mit der armen Frau, blinde Aggression gegen Asoziale und Kriminelle. Rechtfertigungen, Erklärungen sind, so legt es Scerbanenco nahe, nachgeschobene Rationalisierungen.
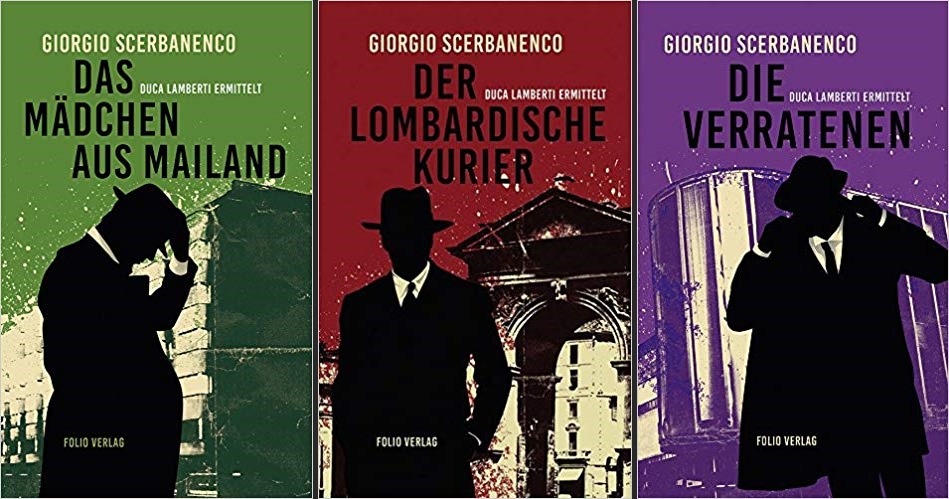
An die Vernunft glaubt Lamberti genau so lange, wie sie ihm in Gestalt einer vernünftigen Person begegnet. Zum Beispiel in Gestalt seiner rationalistischen Freundin Livia Ussaro, die die Konsequenzen ihres bedingungslosen Vernunftglaubens als zahllose Messerspuren im Gesicht trägt. In „Das Mädchen aus Mailand“, dem ersten Band der Serie, fiel sie beim Versuch, einen von der Mafia organisierten Prostitutions- und Pornoring aufzudecken, in die Hände eines Sadisten, der ihr Gesicht mit 77 Schnitten zerstört hatte. Während sie unter dieser Mafia-Folter schwieg, brach der Mafioso unter Lambertis Tritten und Fausthieben zusammen und verriet seine Organisation.
Der Duca prügelt gerne. Vor allem dumme, primitive Verbrecher wie diesen Sadisten (der wie andere üble Kerle vom Autor nicht einmal das Recht erhalten hat, einen Namen zu haben) oder den wahren Schlachter in „Die Verratenen“, den „Bison“ Claudino Valtraga. Von seinem Vater, dem Polizisten, den seine Unbedingtheit im Kampf gegen die Mafia zum Krüppel hat werden lassen, hat Lamberti gelernt, dass Verbrecher nur eine Sprache verstehen: Gewalt. „Du musst ihre Sprache sprechen. Du kannst schließlich nicht Französisch sprechen, wenn Dein Gegenüber nur Deutsch versteht.“ Das ist die Binse, mit der die Apologeten von Law and Order ihr primitives Vorgehen zur Notwendigkeit verklären.
Anflüge von Weltekel
Unzweifelhaft trägt Lamberti äußerst unangenehme Züge: Er ist durchtränkt von Verachtung gegenüber den Primitivlingen der Verbrecherwelt, seine Rhetorik trägt faschistoide Züge. Das hat Scerbanenco den Vorwurf eingebracht, er rede dem Faschismus und einem reaktionären Herrenmenschentum das Wort. Carlo Lucarelli, einer seiner Bewunderer unter den heutigen Kriminalschriftstellern, antwortet darauf 1999 in seinem berühmten Brief an das Vorbild Scerbanenco: „Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, das ist die Wut und die Verzweiflung eines Menschen, der ‚zu viel Elend‘ gesehen hat, wie Sie schreiben.“
Und eine Art von Weltekel. Jedenfalls wäre Weltekel eine Erklärung dafür, warum Scerbanenco die schon genug Schrecken erregende Szene, in der der Mafioso Valtraga den Metzger, Drogenkurier und Waffenschmuggler Ulrico Brambilla in seinem Kühlhaus foltert, durch einen Einschub über die Foltermedizin der Nazis verdoppelt. Scerbanenco war offensichtlich mit den Ergebnissen der Nürnberger Ärzteprozesse und den „Forschungen“ zu Überdruck und Unterkühlung vertraut, die im KZ Dachau durchgeführt und deren Ergebnisse schon kurz nach 1946 von der US-Militärmedizin weiter genutzt worden waren. Auch wenn die kolportierte Idee, unterkühlte Männer durch Sex aufzutauen, wohl schwarzer Humor zu sein scheint – mit dieser Groteske unterstreicht Scerbanenco die Zeitdiagnose, die „Die Verratenen“ durchzieht. Moralische Erneuerung? Irgendwelche Lehren aus dem Faschismus? Pustekuchen.
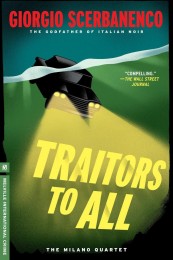 Das Italien der 1960er Jahre war fasziniert von einem Wirtschaftswunder, das das deutsche in seinen sozialen Auswirkungen übertraf. Die Deutschen staunten, dass es ihnen als Kriegsverlierern so gut ging und knüpften nach der kurzen Zäsur der Nürnberger Prozesse verhältnismäßig reibungslos an die alten Herrschaftsstrukturen an, allerdings im Gewand demokratischer Läuterung. Italien verwandelte sich aus einem landwirtschaftlich dominierten Staat in ein Industrieland, und Mailand stand im Zentrum dieser Entwicklung. Valeria Gandus und Pier Mario Fasanotti resümieren in ihrer Geschichte der Verbrechen in Italien zwischen 1960 und 1970, „Kriminal Tango“:
Das Italien der 1960er Jahre war fasziniert von einem Wirtschaftswunder, das das deutsche in seinen sozialen Auswirkungen übertraf. Die Deutschen staunten, dass es ihnen als Kriegsverlierern so gut ging und knüpften nach der kurzen Zäsur der Nürnberger Prozesse verhältnismäßig reibungslos an die alten Herrschaftsstrukturen an, allerdings im Gewand demokratischer Läuterung. Italien verwandelte sich aus einem landwirtschaftlich dominierten Staat in ein Industrieland, und Mailand stand im Zentrum dieser Entwicklung. Valeria Gandus und Pier Mario Fasanotti resümieren in ihrer Geschichte der Verbrechen in Italien zwischen 1960 und 1970, „Kriminal Tango“:
„Mailand, Italiens Hauptstadt der Effizienz und des Unternehmertums, war gleichfalls die Hauptstadt der illegalen Bordelle für die Mailänder Elite, des Gelegenheitssex und der schäbigen Nachtclubs, wo sich äußerlich respektable Personen treffen und ihre sexuellen Leidenschaften im Austausch gegen Geld und andere Güter befriedigen konnten.“
Und der Literaturwissenschaftler Marco Paoli konstatiert, dass „Drogen und Waffenhandel nicht zufällig im Fokus von Scerbanencos ‚Die Verratenen‘ stehen“.
Kenntlich gemacht: die historische Dimension der moralischen Korruptheit
In einem historischen Umfeld, in dem sich Italien öffentlich und nichtöffentlich (es war die Zeit des Aufbaus geheimer, teils faschistischer Militärorganisationen unter dem Schild der NATO) zum antikommunistischen Frontstaat mauserte, wurde einerseits die Resistenza bis zur Harmlosigkeit heroisiert und andererseits die Vergangenheit, sei es der Faschismus, sei es die Kooperation mit Nazideutschland, verharmlost.
Auf diese Entwicklung zum seichten Vergessen im Konsum reagierte Fellini mit seiner Gesellschaftssatire „La dolce vita“. Im Schlussbild des Films stolpert eine verkaterte Gesellschaft von Neureichen am Strand über den gestrandeten Leichnam eines monsterhaften Fisches und wendet sich irritiert ab. Zeitgenossen haben Scerbanencos Lamberti-Tetralogie als Auserzählung dieser Szene verstanden. Fellinis Fischleichnam war ein damals gemeinverständliches Symbol für den „Fall Montesi“, bei dem es um die Verquickung von Orgien der höchsten Kreise, Rauschgift, Vertuschung und Korruption ging. Das Opfer, eine junge Gelegenheitsprostituierte, wurde am Strand abgelegt. In „Das Mädchen aus Mailand“, dem ersten Roman der Serie, spielt Scerbanenco darauf an. Darüber hinaus können alle vier Lamberti-Romane als Auserzählung des von Fellini nur angedeuteten Syndroms gelesen werden. Besonders in „Die Verratenen“ macht Scerbanenco die historische Dimension dieser moralischen Korruptheit deutlich.
Der Roman heißt im Original „Traditori di tutti“ – „Verräter von allen“. Gemeint sind damit zunächst der Anwalt Turridu Samponi und seine Komplizin Adele Terrini. Aber auch ihre Komplizen im Waffengeschäft und Drogenhandel. Als die „Löwin“ auspackt, von der man auch nicht weiß, ob sie zur „Gattung Mensch“ gehört, obwohl – oder weil – sie empfänglich für Lambertis Geld ist, bricht es aus dem Erzähler heraus:
„Sie verrieten tatsächlich alle um sich herum, sie machten vor nichts und niemandem Halt: Sie waren imstande, ihre eigene Mutter noch auf dem Totenbett zu verraten und ihre Tochter in den Wehen, sie verschacherten ihren Mann oder ihre Frau, ihren Freund oder ihre Geliebte, ihre Schwester und ihren Bruder. Für tausend Lire waren sie bereit zu morden; um zu verraten, reichte schon ein Eis. Es war nicht einmal nötig, sie zu schlagen, nein, es genügte, im Bodensatz ihrer trüben Persönlichkeit zu rühren, und was herauskam, war Niedertracht, Schurkerei, Verrat.“
Alle Diskurse offen
Die 1960erJahre, in denen das geschrieben wurde, liegen so weit zurück, dass ohne tiefergehende Analyse nicht erschlossen werden kann, ob Verrat zur Superkategorie und zum Zentralausdruck seines Weltekels geworden ist, oder ob Scerbanenco meint, dass sich die Niedertracht aus der Kriegszeit fortgesetzt hat, dass also diejenigen, die um des Gewinns willen (den sie übrigens nirgendwo ausstellen, er manifestiert sich nur in der feisten Erschöpfung der beiden Todgeweihten auf dem Rücksitz) Freiheitskämpfer an die Nazis, Nazis an die Amerikaner, Amerikaner an die Nazis usw. verraten und verkauft haben, jetzt immer noch da sind, mächtig sind und ihre Spielchen treiben.
Nehmen wir an, dem wäre so, dass der Weltekel historisch begründet ist und keine misanthropische Haltung eines Erschöpften, dann enthielten „Die Verratenen“ eine wirklich groteske Pointe. Dass nämlich die Nation der Befreier, personifiziert durch den gutgläubigen Trottel von Vater Paany und seine Tochter, das Heft der Befreiung aus der Hand gegeben hat. Die Tochter, die alles Recht der Welt auf Rache hatte, als sie es ausübte, begibt sich aus engelhafter Anständigkeit und törichtem Moralismus zurück in die Hände einer Justiz, die die Mörder ihres Vaters aus Legalismus schützt und sie verurteilt – und die damit selbst unwillentlich zu den Verrätern von allen wird.
Aber dies ist eine Spekulation. Das ist das Großartige an den Lamberti-Romanen, dass sie zu diesen Spekulationen anregen, alle Diskurse offen halten. In ihrer Mischung von Skepsis, Groteske und nicht zugelassenem Mitleid sind sie einzigartig. Zudem voller Witz. Welches Bild würde die Heuchelei jener Zeit (in Italien und anderswo) drastischer und eindringlicher fassen als das des Zuhälters, der eine jungfräuliche Hure heiraten will, weil er der Einzige ist, der noch an den vergangenen Werten festhält wie an einer Millionen Lire teuren Vacheron-Armbanduhr? Und wer könnte ein zeitgemäßerer Held sein als Duca Lamberti, der am Ende des letzten Romans Livia, seiner Husarin, auf die Frage, warum er ein (so miesepetriges) Gesicht macht, antwortet:
„Weil ich weder ein guter Arzt bin noch ein guter Polizist. Als Arzt habe ich es fertig gebracht, mich aus der Ärztekammer ausschließen zu lassen. Meine wichtigste Operation war die Durchführung einer Hymenalplastik bei einer Prostituierten! Als Polizist habe ich es geschafft, dir dein Gesicht durch zig Schnitte verunstalten zu lassen.“
Mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Folio-Verlages. Tobias Gohlis ist Krimikolumnist der Wochenzeitung DIE ZEIT, Begründer und Jurysprecher der Krimibestenliste.
Giorgio Scerbanenco: Die Verratenen. Duca Lamberti ermittelt (Traditori di tutti, 1966). Aus dem Italienischen von Christiane Rhein. Mit einem Nachwort von Tobias Gohlis. Folio Verlag, Wien/Bozen 2018. Klappenbroschur, 256 Seiten, 18 Euro.











