
WebTV-Check: „House of Cards 2013“
Entzückte Geräusche von vielen Menschen, die „House of Cards“ lieben, ratloses Achselzucken und ein gemurmeltes „… aber ‚West Wing‘“ von anderen. Neues Erzählen oder the same old bullshit? CrimeMag schaut nach. Eine Analyse von Dirk Schmidt.
Buy Buy Cliffhanger
Carl Icahn twittert. Gefühlt im Minutentakt. Wer mag: unter @Carl_C_Icahn erklärt Mr. Icahn, Investor, Multimilliardär und „Chairman of Icahn Enterprises L.P.; etc., etc.“ die Welt und das Medium findet zu sich selbst. Kurze, schnelle Botschaften, wie man es anstellen könnte, ein bisschen mehr wie Carl etc. etc. zu werden. Was lesen, was gucken, was denken? Carl hat die Antwort. Wer sich über die fröhlich-brave Freiwilligkeit von plus minus 150.000 Followern wundert – das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie Carl kommuniziert, und er ist immerhin so nett, sein Geschäftsprinzip preiszugeben: „Some people get rich studying artificial intelligence. Me, I make money studying natural stupidity.“ Auch Twitter scheint zu Carl Icahns Studienfeldern zu gehören.
 Die Mozartkugel von Netflix
Die Mozartkugel von Netflix
Das alles hätte in der Betrachtung einer TV-Serie nicht viel zu suchen, wenn Icahn nicht vor Kurzem seinen neusten Coup in die Welt gezwitschert hätte: „Sold block of NFLX today. Wish to thank Reed Hastings, Ted Sarandos, NFLX team, and last but not least Kevin Spacey.“
Rund 800 Millionen Dollar soll Icahn an seinem Kurzzeitinvestment in das Video-on-demand-Unternehmen Netflix verdient haben, und das Flaggschiff, die Storefront, die Mozartkugel von Netflix, ist „House of Cards“, die erste Serie in dieser Liga, die ausschließlich im Web gezeigt und vertrieben wird.
Das ist zunächst mal eine feine Sache, weil der Umstand, dass man mit einer Webserie Gewinn machen kann, neue Freiheiten am Horizont aufscheinen lässt. Zudem trägt eine Webserie der neuen, sehr angenehmen Gewohnheit Rechnung, eine TV-Serie in der persönlichen Pace zu rezipieren, weil alle Folgen einer Staffel jederzeit und beliebig oft wiederholbar zur Verfügung stehen. Das hat im Gegenzug Auswirkungen auf die Art und Weise des Erzählens, und es gibt nicht wenige Menschen, die der Ansicht sind, dass wir, auch aufgrund dieser veränderten Rezeption, ein neues, Goldenes Zeitalter dessen erleben, was frühere Generationen als Fernsehen bezeichneten. Die New York Times nannte das erste Meisterwerk der Epoche „The Sopranos“ einen „großen amerikanischen Roman“, und es ist also nur folgerichtig, wenn das Ansehen eines solchen Kunstwerks dem Lesen eines Romans gleicht.
Package Deal
Um die Frage, ob „House of Cards“ ein solches Kunstwerk ist, soll es hier nur am Rande gehen. Der erstmögliche Einwand, dass der (eigentlich zu schön, um wahr zu seiende) „Package Deal“ aus Remake einer legendären BBC Serie plus Produktion/Regie: Fincher plus Hauptrollen: Spacey/Wright plus Finanzierung: Icahn, der wahren Kunst entgegensteht, greift zu kurz. Fernsehen ist immer ein Package Deal, die „Sopranos“ (zum Nachruf auf James Gandolfini bei CulturMag) und „Breaking Bad“ waren einer, und auch das ZDF überlegt sich bei seinen Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen sehr genau, ob man die Bücher Gabi Dohm, Thekla Carola Wied oder Valerie Niehaus auf den Leib schreiben lässt. Machen wir also den Sprung durch die Zeit und den Vergleich mit einer anderen US-Politikserie: „The West Wing“.
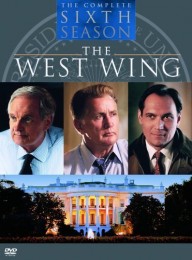 The Web Wing
The Web Wing
Die letzte Folge von „West Wing“ wurde vor gerade mal 8 Jahren ausgestrahlt, aber es könnten auch dreimal so viele sein. „West Wing“ hat ihn noch, den Cliffhanger. Monate kann er dauern. Einen ganzen Sommer lang kann die Frage in der Luft hängen, ob, je nach Staffel, der Präsident, sein Stabschef oder jener seiner Politikos, der sich bei einem Attentatsversuch eine Kugel fing, überleben wird und im Herbst noch am Start ist. Die Macher von „House of Cards“ haben sich das nicht getraut. Am Schluss der ersten Staffel ist Frank Underwood Vizepräsident, und die Serie könnte hier enden, ohne große offene Fragen zurückzulassen.
Frank Underwood ist am Ziel, die Rache ist sein. Er, der Fraktionsführer der Demokraten, wollte Außenminister werden und wurde übergangen. Also hat er ein perfide getimtes Spiel aus Indiskretionen, Intrigen-und-Hinterzimmer-Deals ins Werk gesetzt bis er in Folge 2.2. als Vizepräsident der Außenministerin im Oval Office gegenübersitzen und sie vor den Augen des Präsidenten schlecht aussehen lassen kann. Es sind noch 11 Folgen übrig und damit ist klar, welches Ziel Underwood als nächstes ins Visier nimmt. Ach ja, by the way, Underwood hat inzwischen zwei Menschen auf dem Gewissen, einen Abgeordneten und eine junge Journalistin. Beide hatten in seinem Spiel ihre Schuldigkeit getan, beide wurden zur Gefahr und von ihm höchstpersönlich ermordet.
 Bei „House of Cards – 1989“ war es noch schockierend, dass ein Politiker, dazu noch ein so hochrangiger, eine Frau vom Dach des britischen Parlaments schmeißt. Dekaden später sorgen solche Volten nur für inneres Achselzucken. Was „West Wing“ angeht: Auch hier gehörte der Mord mit zum Spiel, allerdings als rein politische Angelegenheit. Gute 5 bis 6 Folgen lang dauerte die Diskussion, ob man einen superterroristischen Terrorfinanzier so einfach beseitigen darf. Man durfte, und als Vergeltung wurde kurz darauf die Tochter des Präsidenten entführt. Kaum 7 Monate später erfuhr der Zuschauer dann, ob sie überlebt hatte.
Bei „House of Cards – 1989“ war es noch schockierend, dass ein Politiker, dazu noch ein so hochrangiger, eine Frau vom Dach des britischen Parlaments schmeißt. Dekaden später sorgen solche Volten nur für inneres Achselzucken. Was „West Wing“ angeht: Auch hier gehörte der Mord mit zum Spiel, allerdings als rein politische Angelegenheit. Gute 5 bis 6 Folgen lang dauerte die Diskussion, ob man einen superterroristischen Terrorfinanzier so einfach beseitigen darf. Man durfte, und als Vergeltung wurde kurz darauf die Tochter des Präsidenten entführt. Kaum 7 Monate später erfuhr der Zuschauer dann, ob sie überlebt hatte.
Underwood hält sich mit solchen Petitessen nicht auf und leider macht gerade das die Serie dann auch ein bisschen langweilig. Dem Bösen ist irgendwann nicht viel Böses mehr hinzuzufügen, und auch die Tatsache, dass „West Wing“ und „House of Cards“ sich am deutlichsten dort unterscheiden, wo erstere das Machtzentrum als ewig auf fiebrigen Hochtouren laufendes Getriebe immer kurz vorm Durchknallen und letztere es als kalte, leere, totenstille Konzernzentrale inszenieren, scheint abermals dem Kalkül des neuen Erzählens geschuldet. Hier die Lautstärke des „jetzt nicht umschalten, direkt nach der Werbepause wird es noch verrückter“, dort das kühle Glimmen eines Laptops und die Frage, ob man sich noch ein paar Minuten der nächsten Folge ansieht oder es für heute gut sein lässt.
Immerhin machte „West Wing“ aus der Not eine Tugend. Zwar wirkt auch die telenovelanische Zopfdramaturgie für den heutigen Zuschauer wie aus der Zeit gefallen, aber was die Figurenführung, die Szenendramaturgie und das Kunsthandwerk der legendären „Walk and Talk“ Dialoge angeht, ist bislang noch nichts nachgekommen. „House of Cards“ hat solche Aufregungen nicht mehr nötig. Wir sehen Frank Underwoods Frau Claire minutenlang dabei zu, wie sie im hallenartigen Bau ihres Washingtoner Townhouses einfach nur allein ist. Beiläufig wird ein Stäubchen von der ansonsten makellosen Tischplatte gewischt und währenddessen lassen wir mit Claire den Tag Revue passieren.
Da sind die Entlassungen langjähriger Mitarbeiter der Wohltätigkeitsorganisation, die Claire leitet, die neueste, karrieremordende Intrige, die sie sich gemeinsam mit ihrem Mann ausgedacht hat, und der Umstand, dass Frank gerade ‒ was sein muss, muss sein ‒ die 25-jährige Journalistin vögelt, die er zum Rufmorden braucht. Nichts davon wirft einen Schatten des Zweifels auf Claires Gesicht, und als sie irgendwann zu einem Künstlerfreund nach New York flüchtet, um ein paar Tage das Loft, das Bett und den Downtown Lifestyle mit ihm zu teilen, wirkt das wie eine Zeitreise zurück ins West-Wing- Fernsehen. Zurück in eine Zeit, in der Frauen sich noch ernsthafte Gedanken über Freiheit und Gleichberechtigung machten, anstatt das Spiel einfach mitzuspielen, um es zum guten Schluss exakt so kalt und leer zu haben wie ihre Männer.
 Die Räume, man muss wohl darauf zurückkommen, machen den deutlichsten Unterschied. Während West Wing in einem aus der Realität geborgtem Bienenkorb spielte, ist im House of Cards immer Platz. Die Büros sind riesig, die Häuser monumental, die Flure weitläufig, und zwischen den Figuren und der nächsten Wand herrscht eine Leere, die einen frösteln lässt. Aber vielleicht ist auch das dem evolutionären Unterschied zwischen dem vereinsamten Fernsehzuschauer, der möglichst viele Menschen in sein Wohnzimmer einladen möchte, und dem, im selbstgewählten Alleinsein seines Netflix-Abos, genießenden Romanseher geschuldet.
Die Räume, man muss wohl darauf zurückkommen, machen den deutlichsten Unterschied. Während West Wing in einem aus der Realität geborgtem Bienenkorb spielte, ist im House of Cards immer Platz. Die Büros sind riesig, die Häuser monumental, die Flure weitläufig, und zwischen den Figuren und der nächsten Wand herrscht eine Leere, die einen frösteln lässt. Aber vielleicht ist auch das dem evolutionären Unterschied zwischen dem vereinsamten Fernsehzuschauer, der möglichst viele Menschen in sein Wohnzimmer einladen möchte, und dem, im selbstgewählten Alleinsein seines Netflix-Abos, genießenden Romanseher geschuldet.
The Left Wing
Die These war immer steil. Das „West Wing“-Camelot mit einem kennedyesken Nobelpreisträger als Oberbefehlshaber (dazu eine, wie im Fall JFK geheim gehaltene, schwere Erkrankung das Ganze allerdings ohne die Frauengeschichten) hat Kritiker aus allen Lagern auf den Plan gerufen. Kritik ist nicht ganz unverdient, wenn sich idealtypische Gutmenschen immer im mehrfach ironisch gebrochenen Zweifel an den eigenen Fähigkeiten und im steten Bewusstsein ihrer Fehlbarkeit vor der Größe der historischen Aufgaben, unablässig Bonmots um die Ohren hauen, deren Schliff Oscar Wilde verstummen lassen würde. Aber left wing? Eher eine fast schon verzweifelte Mit-sich-selbst-Versöhnungsstrategie angesichts einer Nation, der gerade vier Boeings um die Ohren flogen und die ausgerechnet jetzt einen gottesfürchtigen Vollclown im realen West Wing sitzen hat. George W. Bush dürfte von einem kennedyesken Nobelpreisträger in etwa so weit entfernt gewesen sein wie Frank Underwood von der göttlichen Vergebung. Aber bleiben wir kurz dabei, vielleicht helfen die Kategorien des letzten Jahrhunderts uns ja doch noch in diesem. Ist „House of Cards“ in dieser Logik the right wing?
Dafür spräche die Tatsache, dass sich, zumindest in den USA, einige Kategorien verschoben haben. Die religiös/militante Rechte hat sich Haltungen und Gesten der Vietnam-Generation geliehen, und es sieht nicht so aus, als würde sie sie zeitnah zurückgeben. Fox News, die mächtigste Meinungsmaschine der Reaktion inszeniert sich seit Jahrzehnten als einsamer Kämpfer gegen „Mainstream Media“, und die Teaparty-Idioten sehen sich als Wiedergänger jener Rebellen und eminent individualistischen Talente, die einmal Amerikas guten Ruf ausmachten.
Die Enthüllung der Verbrechen eines Machtmenschen wie Frank Underwood hat in diesem Zusammenhang nicht mehr allein den antizynischen Gestus des investigativen Woodward/Bernstein Wir-reißen-der-Macht-die-Maske-herunter, sondern auch den schalen Beigeschmack der Totalverweigerung gegenüber und Vollblockade von allem, was mit Politik zu tun hat. Immerhin gibt es in „House of Cards“ einen leidlich zwielichtigen Milliardär, der den wachsweich-blassen Präsidenten nachgerade brechtianisch in der Tasche hat und ansonsten nur seine eigenen Interessen verfolgt. Das Spiel geht also erst mal unentschieden aus, aber es lohnt sich dranzubleiben. Denn „House of Cards“ ist, ganz gleich wie man die Karten dreht und wendet, Qualitätsfernsehen auf höchstem Nieveau.
Qualitativ unter aller Sau hingegen ist die naiv-pilchernde Beobachtung des SPIEGEL, dass Frank Underwood mit der einmal erreichten Macht nichts anzufangen wisse. Macht als Selbstzweck ist wahrlich kein neues Phänomen. Man möchte fast mit einem Zitat von Carl Icahn schließen.
Dirk Schmidt
House of Cards: Erstausstrahlung: 1. Februar 2013, Sender: Netflix. Mehr dazu hier.













