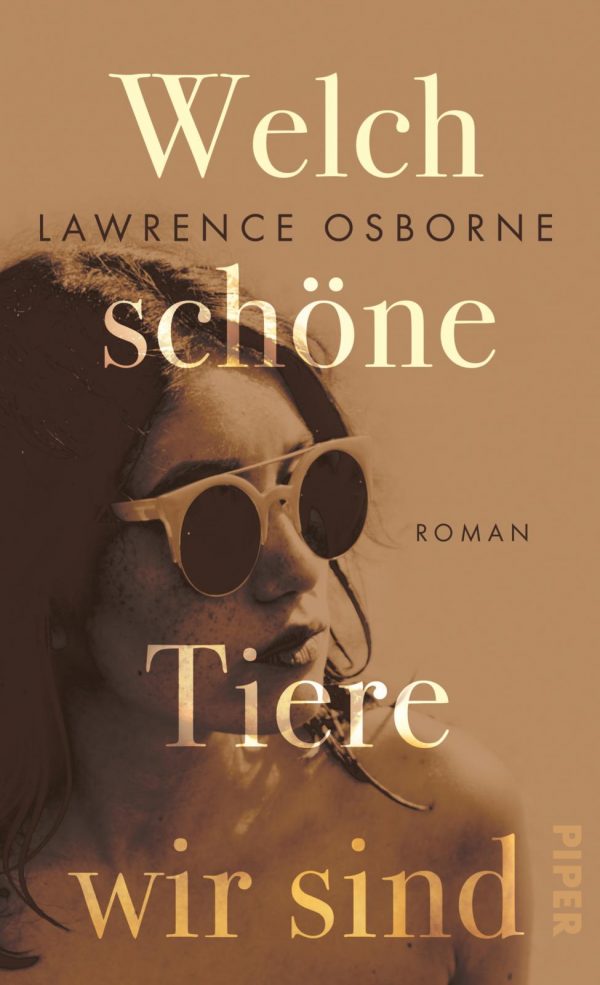
Ein Hauch von Freiheit
Rezension von Wolfgang Franßen
Wer eine solche Tochter hat, sollte sich schon mal ein Grab im Garten aussuchen. Naomi findet nicht ganz freiwillig Zuflucht im Haus ihres Vaters auf der griechischen Insel Hydra. Sie hat als Anwältin in London gearbeitet und wurde wegen unrechtmäßiger Parteinahme für einen Mandanten vor die Tür gesetzt. London hasst sie inzwischen und Hydra ist für sie nicht mehr als ein Rückzugsort für Vermögende, die sich gerne von der Sonne verbrennen lassen und darin ein Zeichen ewiger Jugend erkennen. Alles ist perfekt. Man ist unter sich, geht zu Partys und redet über die Nachbarn. Die Griechen kommen nur am Rande vor. Sie sind Bedienstete, verkaufen Fisch im Hafen und kellnern in den Restaurants. Ein bedauernswertes Land am Rand des wirtschaftlichen Chaos, gestützt von Europa und natürlich selbst schuld. Immerhin helfen Leute wie die Codringtons ihnen, indem sie da sind, ihr Geld ausgeben. Es lebe der Müßiggang!
Wäre da nicht die Stiefmutter Phaine, die das Haus ihrer Mutter übernommen, umgestaltet und deren Geist daraus vertreiben hat, ließe sich das alles ertragen. Auch wenn der Vater nicht vor Zuneigung strotzt und sie geflissentlich durcheinander hindurchsehen, wenn sie nicht gezwungen sind, Interesse zu heucheln.
Alles ist angerichtet für die Sommerhitze. Kühle Getränke im Schatten und flüchtige Bekanntschaften ohne Bedeutung.
Auch in seinem zweiten auf Deutsch erschienen Roman „Welch schöne Tiere wir sind“, übersetzt von Stephan Kleiner, führt Lawrence Osborne uns hinter die Spiegelfassade kultivierten Nichtstuns. Natürlich umgibt Jimmie als Hausherr sich mit Kunst und nicht umsonst ist er ein Sammler und vermag seinen Aufstieg, in teurer Ausstattung zu ertränken. Dass seine vierundzwanzigjährige Tochter seine Erwartungen nicht erfüllt, ist eher eine lästige Randnotiz, da sie sie keine Rebellin ist und trotz aller familiärer Geheimnisse, die wärmeren Gefilde zu genießen weiß.
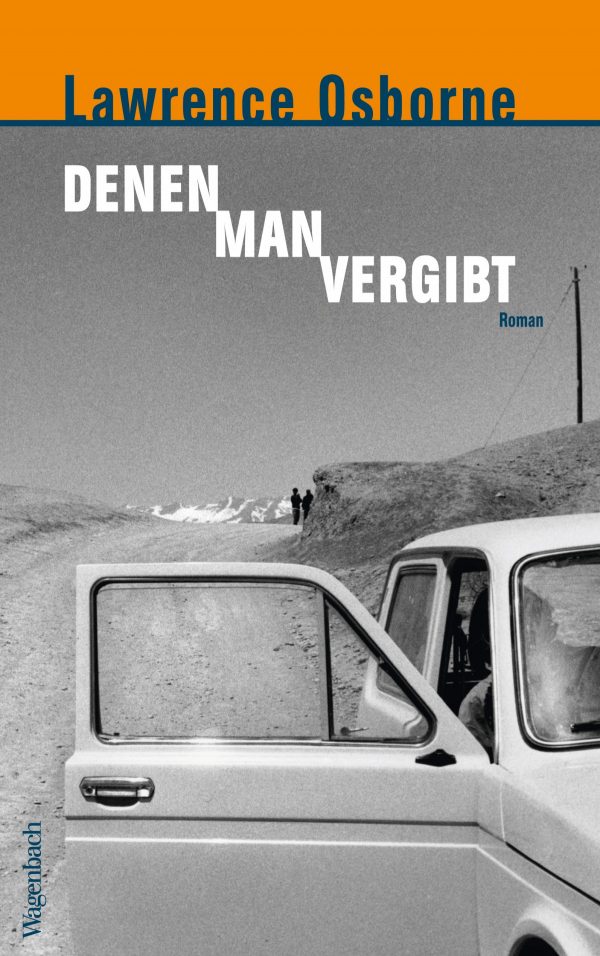
In seinem Roman „Denen man nicht vergibt“ setzte Osborne eine in sich autarke Gesellschaft in einem fremden Land aus: Marokko. Dessen Kultur eine Handvoll Briten ignoriert und sich in eine Enklave einsperrt, um sich an der eigenen Unzulänglichkeit zu berauschen. Was uns in „Denen man vergibt “ als fulminante Beschreibung innerer, hysterische Leere gepaart mit zu viel Koks, Champagner und unweigerlicher Liebschaft entgegentritt, wird in dem neuen Roman angesichts des wirtschaftlichen Showdowns Griechenlands zur Entblößung einer Familie.
Auch Naomis neue Freundin Sam, mit der sie durch die Gegend zieht und die Zeit totschlägt, ist über ihre eigene Familie nicht wirklich glücklich. So etwas schweißt zusammen. Die beiden sind auf einer inneren Flucht und hoffen, dass irgendetwas passiert, was ihrem Leben eine Bahn geben soll. Solange lassen sie sich treiben. Sie pflegen ihre Arroganz, obwohl sie die an ihren Eltern hassen, schwelgen in Gehässigkeiten und manchmal taucht verschämt die Sehnsucht nach dem auf, was ihnen ihrem Leben fehlt.
Osborne lebte in Paris, Marokko, Thailand, schrieb für die New York Times und das Harper`s Magazin Reisereportagen und Essays und hat mehrere Romane veröffentlicht. Er kennt sich in den Ländern aus, in die er seine Geschichten ansiedelt. Seine Landschaften, Orten, die er beschreibt, folgen keinem touristischen Blick. Er führt uns vor Augen, dass abseits der wirtschaftlichen Verflechtungen in der globalen Welt die Menschen sich weiterhin fremd gegenüberstehen. Europa hin oder her. Lasst uns Geld aneinander verdienen, aber verlangt nicht von uns, dass wir uns auf gleicher Augenhöhe empfinden.
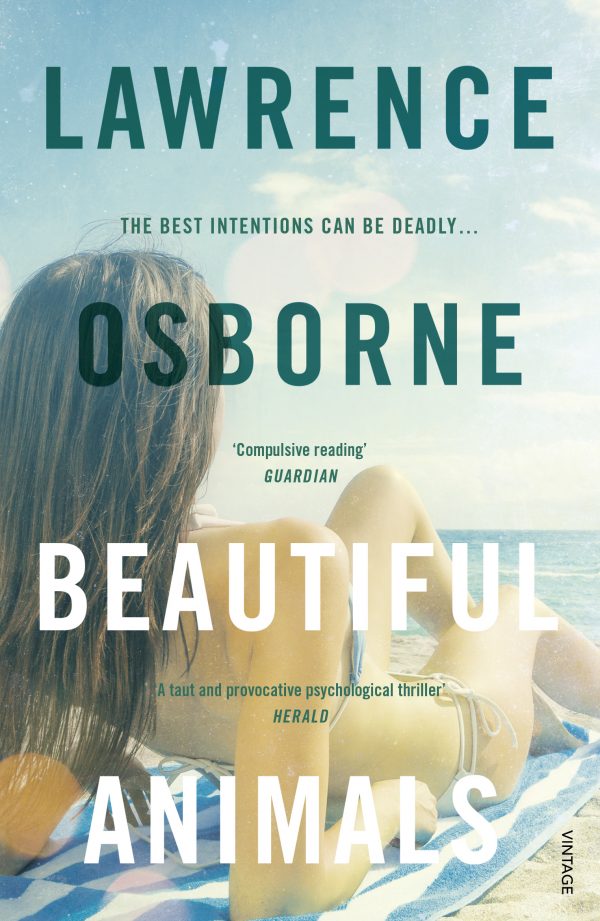
Dass in solche Umgebung leicht das Verbrechen einbricht, weiß Osborne. In „Denen man nicht vergibt“ wird ein Flüchtling von einem alten Ehepaar aus „reiner“ Güte aufgenommen, um ihr Gewissen zu beruhigen. Sie halten ihn wie einen besserer Haussklaven. Man tut ihm ja schließlich etwas Gutes. Dass sie dann von ihm ermordet werden, nun ja, das passt hervorragend in die Boulevardwelt von geschürter Angst vor Migranten.
So treffen auch Naomi und Sam auf einem ihrer Spaziergänge an der Küste auf Faoud, einen geflüchteten Syrer. Er ist in einem erbärmlichen Zustand. Naomi hilft ihm, versteckt ihn, geht mit ihm ins Bett, von Liebe kann nicht die Rede sein, eher von einem verschwommenen Wunsch nach Gerechtigkeit. Schon ihr Rauswurf aus der Kanzlei in London beruhte auf dem Gefühl der Ohnmacht angesichts von Diskriminierung.
Weil sie sich an ihrem Vater rächen will, der so blind und abweisend geworden ist, überredet sie Faoud mit der Hilfe der Haushälterin einen Einbruch in der Villa ihres Vaters vorzutäuschen und genug zu stehlen, damit er Geld für seine Flucht durch Europa besitzt. Sie überlässt ihm die Schlüssel zu einem Haus in Italien, das eine Art Geheimversteck ihres Vaters ist, und er soll auch gleich den Peugeot mitnehmen.
Wieder trifft in Osbornes Roman das westliche Gutmensch-Gebaren auf einen Flüchtling, dessen Träume von einem Leben als Lehrer in seiner Heimat zerstört wurden und nun als Illegaler herumirrlichtert. Dass sie alle dabei das Wagnis in einer überstürzten und unausgegorenen Idee eingehen, die Katastrophe förmlich anziehen, ist ihnen nicht bewusst.
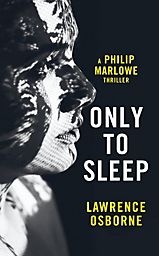
Was für ein Glück für uns Leser, dass er mittels eines Verbrechens die großen moralischen Fragen stellt, ohne sie mit einem moralischen Zeigefinger auszustatten. Was treibt diese Tochter an, einen solchen Verrat an ihrem Vater zu begehen? Wer sich über die katastrophalen Lebensumstände in den Auffanglagern der Migranten rings um das geschützte Europa informiert, wird davon erschüttert sein, wie sehr wir uns wegen unseres Wohlstands schuldigmachen. Osborne findet da grandiose Bilder des Wegschauens und scharfe Momente der Bloßstellung.
„Unsere zukünftigen Kinder sind für die Menschen um uns herum schon sichtbar wie schöne Geister.“
Und doch ist es nicht allein die Dekadenz der Vermögenden, die Osborne umtreibt, eher die Frage, reicht das Klammern an unserem Besitz dazu aus, uns glücklich zu machen?
Natürlich wird der Raub in der Villa ihres Vaters schiefgehen. Natürlich wird alles, was danach kommt, die Dinge aus dem Ruder laufen lassen. Doch Naomi bleibt stoisch, kühl, pragmatisch und wird so für uns als Leser zu einer Herausforderung.
„Die Ungeliebten“, heißt es im Roman, „werden leichter vergessen als die Liebeswürdigen.“
Gut, dass Osborne weiß, dass dem nicht so ist. Denn das Gefühl von Schuld verweht nicht durch neuen Wandstrich.
Wolfgang Franßen
- Lawrence Osborne: Welch schöne Tiere wir sind (Beautiful Animals, 2017). Aus dem Englischen von Stephan Kleiner. Piper Verlag, München 2019. 336 Seiten, Hardcover, 22 Euro.
Wolfgang Franßen bei CrimeMag.











