Böhmische Dörfer?
Großwerden hinter dem Eisernen Vorhang hatte nicht unbedingt nur seine Nachteile. Als Rotzlöffel kam man damals nicht umhin, sich mit der Unterhaltungsindustrie aus den sozialistischen Nachbarländern ein bisschen genauer zu befassen. Ungewollt selbstverständlich. Die Eltern glotzten die tschechoslowakische TV-Serie „Das Krankenhaus am Rande der Stadt“, ein östliches Pendant zur „Schwarzwaldklinik“, und die Blagen amüsierten sich bei dem kleinen Maulwurf – oh, wie süß! –, bei Pat und Mat – oh, wie komisch! – und beim braven Räuber Fürchtenix – oh, wie robinhoodig! Und es gab noch einen Fernsehkrimi, an den ich mich dunkel erinnern kann. Mit dem berühmt-berüchtigten tschechischen Film hatte er allerdings nicht viel zu tun.
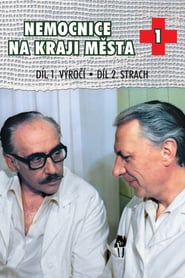
Sie werden sich jetzt bestimmt fragen: nanu, was hat der Gute am tschechischen Film auszusetzen? Was meint er damit? Ist es etwas Einmaliges, ja vielleicht sogar eine Art Geheimtipp für Kino-Freaks? Oscarreif? Echt? Kenn‘ ich nicht… Im Polnischen hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Redewendung „tschechischer Film“ fest eingebürgert. Der Ursprung des Begriffs bleibt heute noch unklar, vermutlich geht er auf den beim Publikum beliebten Streifen „Keiner was weiß“ (Nikdo nic neví) in der Regie von Josef Mach aus dem Jahre 1947 zurück. Auf der einen Seite genial ironisch und das Leben auf die leichte Schulter nehmend. Auf der anderen Seite missverstanden.

Cineastische Produktionen aus der ČSR passten irgendwie nicht in die europäische Filmlandschaft, auch in den Ostblockstatten hatten sie eine ganz besondere Position und Funktion inne. Verlor man den Überblick und den roten Faden, wusste man nicht, wieso, warum und wozu, so sprach man von Zuständen wie im tschechischen Film. Dabei kann man die dortige Kinobranche nur loben: dafür, dass sie gegen den Strich, häufig auch gegen die kommunistische Propaganda, wunderschön groteske, ein wenig vergraute, wie eben die sozialistische Wirklichkeit war, Movies auf den Weg brachte, die die Außenwelt kommentierten. Die Fernsehserie „Die Kriminalfälle des Majors Zeman“ gehörte jedoch nicht dazu.
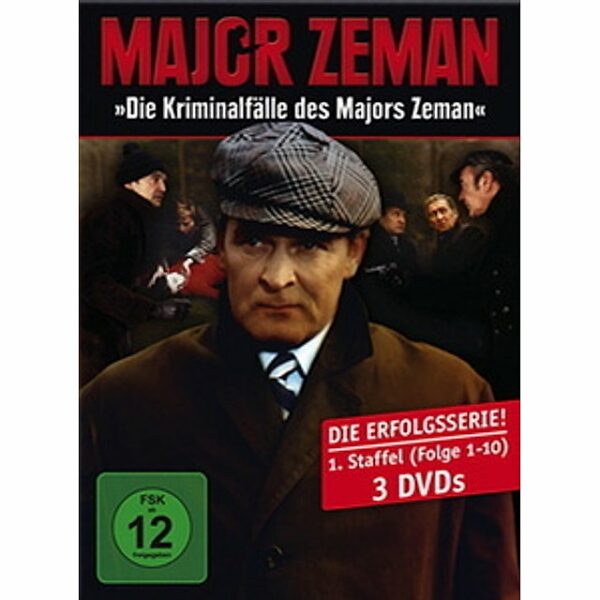
In den 1970ern kamen die Tschechoslowaken auf eine irre Idee: lasst uns einen Krimi drehen, mit dem wir das 30. Jubiläum des Bestehens der ČSR feiern würden. Nebenbei werden wir auch ein Ständchen zum runden „Geburtstag“ unserer Stasi anstimmen und das Image der Staatsgewalt, das nach dem Prager Frühling Risse bekam (als ob die Stasi jeweils Fans hätte…), aufpolieren. Dies ist aber wurscht. Auf diese Weise wurden 30 Folgen produziert, jede einzelne spielt in einem anderen Zeitraum und spiegelt nicht nur die Nachkriegsgeschichte der Tschechoslowakei, sondern auch den sozialistischen Musterlebenslauf von Jan Zeman wider, einem Ex-Arbeiter, der der Staatsicherheit beitritt, um dort mit der Zeit einen großen Sprung auf der Karriereleiter zu machen. Themen, die in den „Kriminalfällen des Majors Zeman“ behandelt werden, betreffen meistens Spionage, Sabotage oder Geheimdienstskandale und basieren auf wahren Begebenheiten. Man könnte in diesem Zusammenhang von verfilmten Pitavalen reden, von fiktionalisierten Dokumentarfilmen, denen jedoch politische Auf-Tuchfüllung, Linientreue und Agitation kaum fremd waren. Abgesehen von der aufgezwungenen politischen Ausrichtung der Serie weiß sie allerdings darüber hinaus in ästhetisch-narrativer Hinsicht zu überzeugen. Schaut man sich die Zeman-Kriminalfälle aus heutiger Perspektive erneut an, so lassen sie sich als interessante Gesellschaftsstudie(n) betrachten, in der/denen der sozialistische Alltag mit Stilmitteln des Fernsehrealismus dargestellt wird.
Der Realismus ist auch ein gutes Stichwort, wenn es darum geht, den tschechischen Kriminalroman der Gegenwart zu beschreiben und ihm zu Leibe zu rücken. Leider sind nur wenige Titel ins Deutsche übersetzt worden, die Leserschaft hatte deshalb selten die Möglichkeit, sich mit dem „ceski“ crime genauer auseinanderzusetzen. Dabei scheint für den tschechischen Krimi dasselbe Prinzip zu gelten wie für den tschechischen Film. Nö, bitte nicht falschverstehen: er ist keinesfalls crazy und tricky, sondern etwas ganz Besonderes. Würde man strukturalistenmäßig – pfui Deubel! – einen Katalog an typischen Eigenschaften fertigstellen wollen, so ließen sich einige Konventionsmerkmale des Ostkrimis herausdestillieren, die über der ganzen Gattung schweben und so zur erzähltechnischen Norm wurden.
Punkt 1: tschechischer Humor. Mit der US-Slapstick hat er keine Gemeinsamkeiten, wenn schon dann teilweise mit dem Monty Python-Zirkus, der auf Skurrilität fußt. Allerdings ist die tschechische Humor-Sonderform nicht von britischem Elitarismus geprägt, stattdessen eher von Durchschnittlichkeit und Gewöhnlichkeit. Zufälligkeit und Verkennungen werden großgeschrieben, die Welt wird nicht verschönert oder glorifiziert, sie wird in all ihrer eigentümlichen Gegensätzlichkeit als Kuriosum geschildert, der man als Ottonormalverbraucher die Stirn bieten muss. Einerseits überwältigt die Welt den Menschen, andererseits kämpft der Mensch dagegen an, indem er die Grauenhaftigkeit derselben als solche erkennt. Die richtige Wahrnehmung wird zum Patentrezept eines erfolgreichen Widerstandes gegen die zum Angriff ansetzende Außenwelt der Ungleichheit und sozialen Ungerechtigkeit. Der Tscheche an sich schert sich jedoch darum keinen Deut: mit seinem realistischen Sinn für Humor ist er gegen die Welt gewappnet und immun.
Punkt 2: Verskandinavierung. Es gab eine Zeit, in der man glaubte, dass die einzig gute Kriminalliteratur nur weit im Norden verfasst werden könne. Sjöwall/Wahlöö, Mankell, Adler-Olsen und andere haben mit ihren gruseligen, brutalen, aber dadurch auch realanmutenden gesellschaftsorientierten Kriminalromanen die Marschroute vorgegeben, in die die unzähligen Krimiautoren auf der ganzen Welt sich begeben haben. Der skandinavische Krimi war ein Garant für literarische Qualität und in die Höhe schießende Verkaufszahlen. Der moderne tschechische Krimi wollte sich an dieser Entwicklung beteiligen und von ihr profitieren. Als plotdominierendes Merkmal ist der Versuch anzusehen, die tschechische Gesellschaft in Szene zu setzen – sowohl ihre guten als auch Schattenseiten. Es entstehen Gesellschaftsromane, in denen das verübte Verbrechen und die in Gang gesetzten Ermittlungen häufig nur zum Vorwand werden, über die sozialen Missstände und das tschechische Volk zu räsonieren. Dabei wirkt der Gesellschaftsumriss nicht überzeichnet, sondern eher geerdet. Es wird keinesfalls die moralische Keule geschwungen, es werden keine Lösungskonzepte vorgeschlagen. Der tschechische Krimi verweist auf die gesellschaftliche Unordnung und analysiert sie, aber die Schlussfolgerungen überlässt er lieber den Lesern.
Punkt 3: Authentizität. Die Farblosigkeit und Blässe, die man beispielsweise in den ČSR-TV-Serien beobachten konnte, treten auch im tschechischen Krimi der letzten zwanzig Jahre in Erscheinung. Das öde Ambiente des realexistierenden Realismus wurde durch das öde Ambiente der Marktwirtschaft ersetzt. Die Menschen blieben dieselben – mit ihren Problemen, mit ihrer Lebensart, mit ihrem Staat. Tschechischsein bedeutet keinen Eintrag im Pass, es ist ein Gefühl, das von der Kriminalliteratur transportiert wird.
Punkt 4: Geschichtsfaible. Viele tschechische Krimiautoren sind geschichtsaffin und versetzen ihre Leser in die ferne oder nahe Vergangenheit des eigenen Landes. Am populärsten ist eine literarische Zeitreise in die 1920er und 30er, als nach dem Ersten Weltkrieg die Erste Tschechoslowakische Republik gegründet wurde. Auch das sozialistische Zeitalter der 1950er oder 60er wird gerne als Hintergrund der Kriminalhandlung gewählt ebenso wie die Wende 1990. Der Hang zur Historizität ist aktuell überall in der Krimibranche zu verzeichnen, den tschechischen Kriminalroman unterscheidet jedoch sein gekonntes Spiel mit der historisch belegbaren Realität. Wirklichkeit wird mit Illusion vermischt, Wahrheit lässt sich schwer von Lüge trennen. Die vom Krimi angebotene Geschichtsauffassung ist ein Zwischending zwischen Realitätsgewinn und -verlust.
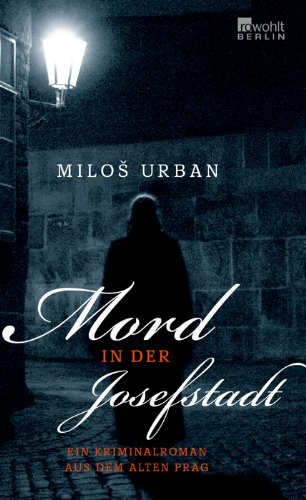
Soviel zur theoretischen Einordnung. Viel spannender als die Klassifizierungsmodelle, die wie immer das Ziel haben, problematische Sachverhalte auf wenige Nenner zu bringen, und dadurch im Grunde die Komplexität aus den Augen verlieren, erweist sich, einen Blick auf das zur Verfügung stehende Textmaterial zu werfen. 2010 ist bei Rowohlt Miloš Urbans „Mord in der Josefstadt“ erschienen, eine geheimnisvolle Verbrechensgeschichte aus dem geheimnisvollen Prag Ende des 19. Jahrhunderts. Blöderweise ist auch die crime-Story selbst geheimnisvoll, soll heißen: ein wenig zu gekünstelt. Der Ich-Erzähler nimmt die Leserschaft auf eine Reise in die historische Hauptstadt Böhmens, die noch unter österreichischer Verwaltung steht; er scheint sich weniger für die mystische Mordserie – das Gerücht, es sei der Golem höchstpersönlich, macht die Runde –, als vielmehr für die literarische Skyline der tschechischen Metropole zu interessieren. Und die Stadtdarstellung kann was: düster, giftig, verbrecherisch, nervenaufreibend, spannend. Vor diesem urbanen Hintergrund setzt sich Urban darüber hinaus mit der tschechischen Identitätsfrage auseinander, indem er Prag als einen kulturellen Schmelztiegel schildert, in dem Böhmer neben Juden oder Deutschen lebten und miteinander zurechtkommen mussten. Die Problematik des Antisemitismus und der Germanisierung der Bevölkerung wird ins Erzählen mit einbezogen. In Wirklichkeit lieferte Urban mit seinem historischen Roman keinen Krimi, stattdessen einen mysteriösen Sittenroman mit kriminalistischen Motiven und Elementen. Deshalb führt der Hinweis auf dem Buchcover – „Kriminalroman“ – in die Irre.
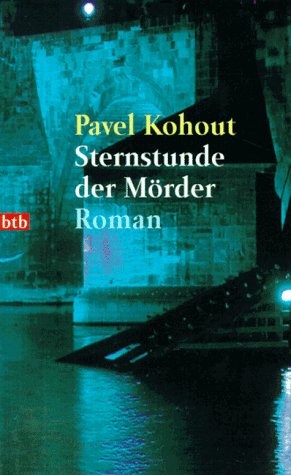
Im Gegensatz dazu hat sich Pavel Kohouts „Sternstunde der Mörder“ (schon 1997 bei btb) die Etikette „Krimi“ verdient, wobei es an vielen Stellen an der Gesamtkonstruktion hapert. Es gibt dort einen Detektiv, eine Ermittlung, einen Versuch der Rekonstruktion der Täterhandlung, ein großes Finale – alles verpackt in einer für die tschechische Geschichte relevante Zeitspanne. Wir befinden uns nämlich im Protektorat Böhmen 1945. Prag wird immer noch von den Deutschen besetzt, der Hauptkommissar Buback gehört der Gestapo an, in der Gesellschaft brodelt es. Es hängt etwas in der Luft und dieses Etwas ist der Aufstand gegen die Nationalsozialisten. Kohout erzählt weitgehend chronologisch und multiperspektivisch, indem er auch häufig auf die Tätersicht umschwingt, und eine Großstadt versunken im Kriegschaos, in dem die Vergangenheit zur Vergangenheit wird und die Zukunft zu einem großen Fragezeichen, präsentiert. Durch die Straßen tummeln sich Rebellen, Kommunisten, böhmische Normalos, Denunzianten, deutsche Soldaten und der Mörder, der sich bestialisch an Frauen vergeht. Allerdings bleibt im Großen und Ganzen der detektivistische Part auf der Strecke: die Polizei jagt zwar den Täter, aber erst dank einer Beichte kann sie ihn schnappen, dessen Motivation bleibt unterm Strich unklar. Erweckt wird der Eindruck, dass für die Vergewaltigungen und Verbrechen, und darunter sind nicht die Kriegssünden gemeint, generell die Deutschen die Schuld tragen. „Ein Deutscher bleibt ein Deutscher!“, heißt es im Roman Kohouts, was mehr oder weniger den Erzählinhalt bündig und gut zusammenfasst.
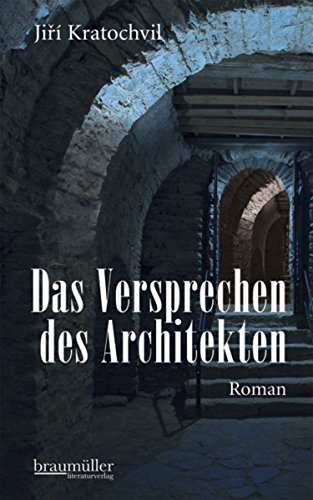
Das deutsche Lesepublikum konnte außerdem noch mit drei weiteren tschechischen Autoren Bekanntschaft schließen, die das Glück hatten, einen deutschen Verleger zu finden. Der Grund, warum die Kriminalliteratur aus dem östlichen Nachbarland auf dem Büchermarkt mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist derselbe wie im Falle des polnischen Krimis: beide gelten als Exoten. Schreiben die Tschechen Krimis? Kann nicht wahr sein… Ist aber wahr. Darunter lassen sich einige Kleinode herausfischen, die es ohne größere Probleme mit der sogenannten ‚Weltkriminalliteratur‘ aufnehmen können. Zu dieser Gruppe von literarischen Herausforderern zählt bestimmt Jiri Kratochvils „Das Versprechen des Architekten“ (2010 bei braumüller), in jeder Hinsicht ein Ausnahmekrimi. Kratochvil spielt auf der einen Seite mit unterschiedlichen Geschichtsebenen und transferiert seine Handlung von der Gegenwartachse in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und in die Stalinismus-Epoche. Auf der anderen Seite versteckt er in seiner histoire literarästhetische Signale: eine Schlüsselfunktion wird dabei Vladimir Nabokov zugesprochen und auch Friedrich Dürrenmatt lässt grüßen. Auf der anderen Seite wird bei Kratochvil die historische Wirklichkeit mit pseudohistorischer Fiktion verquirlt, vor dieser Folie rechnet er mit der ČSR ab. Gruselgeschichten und Mystery (eine Hakenkreuz-Villa – spooky), Kriminal- und Geschichtsroman, Politikfokus und Kapitalismuskritik… Langer Rede kurzer Sinn: ein mit großem Aufwand und literarischer Spitzfindigkeit verfasster Roman über Schuld und Büße. Über die tschechische Gesellschaft, wie sie war und wie sie ist.

Einen Namen als Golfkrimi-Autor in Tschechien hat sich Jaroslav Kutak gemacht, eine Kriminalgeschichte aus seiner Rasenreihe wurde auch in Deutschland veröffentlicht. „Tot unter Par“ (2008) sowie „Strafe muss sein“ (2011, beide bei Grafit) können als Reaktivierungs- und zugleich auch Modernisierungsversuche des britischen Krimis mit seiner locked room-Vorliebe verstanden werden. Dort ein geschlossenes Golfspielermilieu, in dem sexuelle Tätigkeiten auf der Tagesordnung stehen, hier eine Schülerclique irgendwo in der tschechischen Provinz, in der Morde verübt und Suizide begangen werden. Alles in allem ordentlich erzählt, obwohl Kutak vor narrativen Klischeebildern nicht Halt macht, jedoch nur ein Aufwärmen des alten Kohls im modernen Gewand. Ist jut, ist fein, weiter nichts.
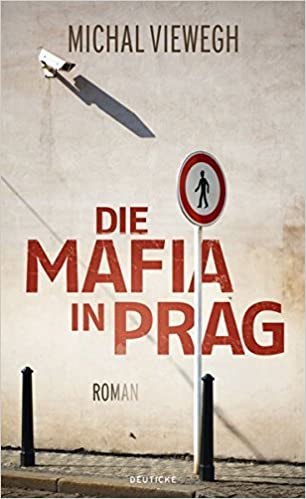
Mit „Die Mafia in Prag“ (2014 bei Deuticke) legte Michal Viewegh ein imposantes Stück journalistischer, investigativer Arbeit gepaart mit erzählerischem Talent vor. Denn dieser Kriminalroman lässt sich als Collage von Gangsterrealität und Fiktionalität begreifen, in der die Fiktion aufgrund des Sprachapparates Vieweghs und seiner direkten Art und Weise des Erzählens zur Wirklichkeit bzw. zur authentischen Fiktion wird. In den Mittelpunkt rücken kroatische Mafiosi, russische Mafiosi, tschechische Mafiosi, die im Zentrum Europas die Herrschaft über Geldwäscherei, Drogen- oder Menschenhandel übernehmen wollen. Mit anderen Worten: über die Welt. In dieses blutige Pokerspiel ist auch die Politik involviert, die gegenüber Korruption und Manipulation nicht abgeneigt ist, von links nach rechts fließen Schmiergelder. Viewegh liefert ein erschütterndes, furchterregendes Bild eines verbrecherischen Undergrounds, der nicht mehr im Dunkel agiert, sondern sich in der Mitte der Gesellschaft etablierte.
Die Anzahl von tschechischen Kriminalromanen, die ins Deutsche übersetzt wurden, ist leicht überschaubar. Solchen Schriftstellern wie Iva Procházkova, Jiří Březina, Michaela Klevisová oder Petr Stančik blieb es bis dato verwehrt, auch in Deutschland zu reüssieren, obwohl viele von denen in ihrer Heimat mit literarischen Preisen überschüttet wurden und immer noch werden. Procházkova erreichte in Tschechien Kultstatus. Ihr Erfolg beruht auf: einem erfrischenden unkonventionellen whodunit-Rätsel mit einer Prise Ironie, durchdachter Handlungskomposition mit vielen cliffhangerähnlichen Szenensprüngen und einem recht sympathischen Helden, mit dem man gerne in der Kneipe einen bechern würde. Beispiel: „Vraždy v kruhu“ („Morde im Kreis“, „Im Kreis der Morde“) – es wird gesoffen, gefressen und Gras geraucht, Inspektor Holina muss in diesem undurchsichtigen Rauchdickicht einen (oder viele?) Polizistenmörder überführen. Jeder ist verdächtig, jeder aus dem Figurenkreis hatte die Möglichkeit und das Motiv, den Gesetzeshüter aus dem Verkehr zu ziehen. Ein tschechischer „Mord im Orient Express“? Ja, aber nur zum Teil, weil Procházkova sich nicht auf eine plattitüdenmässige Charakterisierung ihrer Protagonisten konzentriert, sondern sich in ihre Psyche (lustig, lustig) vertieft und auch ihre nationale Herkunft anschneidet, um auf diesem Wege auf die Identitätsthematik hinzuweisen. Eine sehr gemütliche und spannende, aber auch zum Nachsinnen animierende Lektüre.
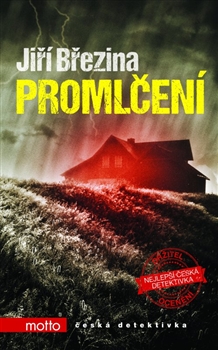
In eine ganze andere Richtung bewegen sich die Krimis von Březina, der statt auf Humor lieber auf erzählerische Lakonie und Punktgenauigkeit setzt. In „Promlčení“ („Verjährung“) baut Březina eine Doppelgeschichte, eine Geschichte in einer anderen Geschichte, auf. An der tschechisch-österreichischen Grenze soll ein Selbstmord aufgeklärt werden, der keiner war. Ein junger Polizist, Volf sein Name, wird im Laufe der Ermittlungen auf einen alten Fall aus dem Jahre 1991 aufmerksam, der mit dem unfreien Freitod in enger Verbindung steht. Březina porträtiert die tschechische Gesellschaft von Früher und von Heute, rast durch die Geschichte eines Staates, der sich immer über Multikulturalität und Multiethnizität definierte, und fragt sich, was den Menschen zum Menschen oder Unmenschen macht.
Ausschließlich gegenwartsbezogen bleiben dahingegen die Kriminalromane von Klevisová, die der tschechischen Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Nichts ist so, wie es scheinbar aussieht. Hinter der Friede-Freude-Eierkuchen-Fassade verbergen sich finstere Familiengeheimnisse, die das Leben determinieren, vor denen man nicht weglaufen kann. Es wird gelogen, was das Zeug hält, es wird ein blauer Dunst vorgemacht bis zum Gehtnichtmehr, um die Scheinheiligkeit einer intakten Welt aufrechtzuerhalten. Dass in diesem Kosmos voll von Glückseligkeit Verbrechen passieren, wird registriert, aber nicht weiter verfolgt. Inspektor Bergman, die Hauptfigur in Klevisovás Krimireihe, stemmt sich gegen solche trügerischen Lebensweisheiten und bemüht sich wie in „Kroky vraha“ („Die Schritte des Mörders“) nicht nur den Mörder zu stellen, sondern vor allem durch das Prisma desselben Mörders die Maske der tschechischen Gemeinschaften fallen zu lassen.
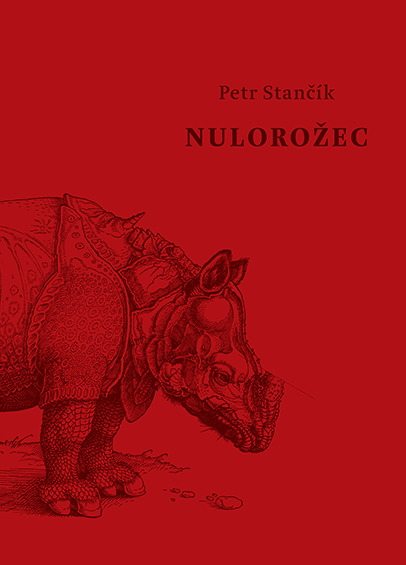
Last but not least: Stančik. Dass auf den Stančik noch kein deutscher Verlag gestoßen ist, ist eine Affenschande. Nicht nur deswegen, weil in „Nulorožec“ („Der Hornlose“) ein gewisser Johann Wolfgang v. Goethe mit von der Partie ist. In erster Linie deswegen, weil Stančik den Lesern eine gelungene Krimi-Parodie (Seltenheitsgrad: 10) zu kredenzen weiß, in der Erotik, Sensationsgier und Verbrechen Hand in Hand gehen. Die Lesergemeinde wird zum Narren gehalten, denn Stančiks erhebt einerseits den Anspruch auf Wirklichkeitstreue und dadurch auch auf die Ernsthaftigkeit seines Plots, andererseits macht er keinen Hehl aus seinen Mystifikationsränken. „Der Hornlose“ ist ein großes Lügengebäude, das in keinem Moment ins Wanken gerät, weil die ganze Realität aus Lügen besteht. Stančik gaukelt die Echtheit eines Goethe-Tagebuchs vor, führt bekannte Autoren an, aber legt ihnen falsche Zitate in den Mund, und verankert seine Haupthandlung im Jahre 2018, dem solche Begriffe bzw. Geräte Handy/Smartphone oder Internet völlig fremd erscheinen. Abgebildet wird eine erfundene Parallelwelt, die jedoch dermaßen die Leser in ihren Bann ziehen kann, dass sie für real gehalten werden könnte.
Ein kurzes Fazit, weil es sich schlicht und ergreifend so gehört: Die tschechische Kriminaldichtung hat einige nicht nur in literarischer, aber auch in gesellschaftlich-politischer Perspektive empfehlenswerte Krimis in petto, die jedoch für den deutschen Leser eine tabula rasa bilden, weil sie nicht verlegt werden. Verdammt noch mal, gebt Euch bitte liebe Verleger einen Ruck und guckt nach Prag, Ústí nad Labem oder ins Sudetenland. Es lohnt sich.
Wolfgang Brylla
– brüstet sich damit, mit 8 Jahren „Winnetou“ gelesen zu haben. Was für ein Teufelskerl. Zwinkersmiley. Von Thomas Mann hält er wenig, von Krimis aber viel. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer polnischen Universität verpfändet er derzeit Forschungsgelder für den Einkauf von Kriminalromanen. Sternzeichen: Skorpion.
Seine Texte bei uns:
Ein Hauch polnischer Exotik – über polnische Kriminalliteratur
#StayAtHome #ReadAmbler – über Eric Ambler
Besser als sein (Polizei)Ruf – zur DDR-Serie Polizeiruf











