 Schimmelreiter und Entwicklungspolitik
Schimmelreiter und Entwicklungspolitik
– Die „Acta Germanica“ aus dem südlichen Afrika wagt den Spagat zwischen Anspruchsgermanistik und deutschphilologischen Area Studies. Bruno Arich-Gerz stellt das Jahrbuch in unserer neuen Rubrik „journaille. der zeitschriftencheck“ vor.
Seit 1966 gibt es die „Acta Germanica“, das Jahrbuch des Germanistenverbandes im Südlichen Afrika (SAGV). Nach ein paar Doppeljahrgängen zwischendrin erschienen inzwischen vierzig Ausgaben der von Karl Tober begründeten und aktuell von Carlotta von Maltzan (Stellenbosch) in Zusammenarbeit mit südafrikanischen Kolleginnen und unterstützt von einem (inter)nationalen Beirat herausgegebenen Zeitschrift. Ein Journal mit vorzeigbarem Ranking und entsprechendem Impact- und Eigenfaktor ist die „Acta“ dabei zwar noch nicht wirklich. Allerdings ist soeben in Südafrika eine entsprechende Akkreditierung erfolgt, sodass Beiträge, die hier akzeptiert und abgedruckt werden, in puncto Reputation mit Aufsätzen demnächst noch besser mit etwa dem traditionsreichen „Jahrbuch für Internationale Germanistik“ (JIG) konkurrieren können.
Ein bisschen Klassikerpflege, viel regionale Auslandsgermanistik und hier und da was Spleeniges
Um es vorwegzunehmen, die Relegation in die nächsthöhere Spielklasse hat das Journal verdient. Dies vor allem wegen der besonderen Note der in ihr erscheinenden Aufsätze zwischen Klassikerpflege, die bisweilen ein wenig an der Entfernung zu den gepäppelten Germanistikmetropolen und Diskursen in Deutschland leidet, und selbstbewusst die eigene Region(alität) betonender Auslandsgermanistik. Auch ein paar Sonderlinge sind mit dabei: gerne selbstverliebter und selbstbespiegelnder Art. Und im Miszellen- und Rezensionsteil betreibt man ein wenig Nabelschau.
Der aktuelle Band 40/2012 ist für diesen Mix ein Paradebeispiel. Denn hier gibt es, erstens, die Entdeckungs- und Missionarsbeiträge etablierter deutscher Germanist/innen, die die Zeitschrift als Plattform nutzen, um auf weitgehend unentdeckte literarische Talente ihres Vertrauens und ihrer Gunst aufmerksam zu machen (Michaela Holdenried über Veza Canettis Prosaästhetik). Es hat aber auch die echten Käuze, die sich über ambitionierte deutschsprachige Primärtexte hermachen, indem sie dem (vorhandenen oder vielleicht auch nicht vorhandenen) Ehrgeiz der Schriftsteller mit aller Macht noch eins draufsetzen. Etwa Urs Widmer mit seiner charmanten Fünffingerübung Im Kongo (1996), den John K. Noyes als Interpretationsfolie für hegelsche Afrikabilder und -philosophierereien heranzieht. Ein typischer Fall von literaturexegetischem Narzissmus ist das letztendlich, der auf den in ziemlich ahistorischer Manier Literatur als Nagelprobe für die Gültigkeit philosophischer Theoreme heranziehenden Verfasser zurückfällt wie ein überschwänglich weggeschleuderter Bumerang. Oder sagen wir so: Wer diesem Beitrag in all seiner Idiosynkratie komplett von Anfang bis Ende folgen kann, der werfe den ersten Stein. Auf Urs Widmer, den eigentlich Tiefenphilosophieunverdächtigen. Oder meinetwegen auf CULTurMAG.de.
African lit crit
Zweitens gibt es die Beiträge afrikanischer Germanist/innen, die gut tun, nicht weil sie mit raffiniert neuer Philologie aufwarten. Sondern weil sie bereits Weichgeforschtes aus deutschsprachigen Landen und Bibliotheken hernehmen, um es komparatistisch anzureichern mit Beispielen aus Afrika. Das tut zum Beispiel der in Bielefeld promovierte Mensah Wekenon Tokponto aus Benin mit seiner Vergleichenden Analyse der Rechtsvorstellungen in diversen Grimmschen und westafrikanischer Märchen. Die Studie schließt mit eher unspektakulären Resultaten, etwa dass Kulturunterschiede in der Rechtsprechung sich auch in den Märchen hier wie dort niederschlagen und diese voneinander unterscheiden lassen. Es bleibt aber immer anregend. Und am Ende steht das Verlangen, Diederichs „Märchen der Weltliteratur“-Sammlung zu konsultieren und nachzuschauen, ob es nicht einen Band mit westafrikanischen Märchen gibt (gibt es: herausgegeben von Ulla Schild und erstmals aufgelegt im Jahr 1975). Oder man fühlt sich befleißigt, den ollen Propp hervorzukramen und seine mächtig sortiererische These von den gerade mal bloß 31 Märchenfunktionen oder Narratemen herauszufordern. In jedem Fall goutiert man den regionalwissenschaftlichen Zugewinn, der unter der großkanonischen germanistischen Firnis zu entdecken ist.
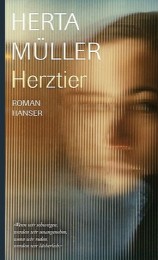 Gleiches gilt für Hebatallah Fathys forsches Aufeinanderbeziehen von Herta Müllers „Herztier“ und „Seini Barakat“ des Ägypters Gamal al-Ghitani. Literatur als Tabubruch ist zwar keine sonderlich frische Kategorie, mit der sich Prosatexte von bekannt totalitarismuskritischen Schriftsteller/innen ausmessen lassen. Und auch die gesellschaftlichen und rezeptiven Horizonte der jeweiligen Ersterscheinungsjahre (1994 und 1974) sind kühn zusammengetackert. Dennoch wird der Vergleich sauber durchgeführt und erreicht in der Conclusio sozusagen den Zielkorridor differenzierten lit crits. Hier die anthropologische Konstante des Reagierenmüssens, wenn einem Leid widerfährt, um nicht komplett stecken zu bleiben. Und dort die Relativierung dieser Generalisierung mit dem Nutzbegriff des Kultur(en)spezifischen:
Gleiches gilt für Hebatallah Fathys forsches Aufeinanderbeziehen von Herta Müllers „Herztier“ und „Seini Barakat“ des Ägypters Gamal al-Ghitani. Literatur als Tabubruch ist zwar keine sonderlich frische Kategorie, mit der sich Prosatexte von bekannt totalitarismuskritischen Schriftsteller/innen ausmessen lassen. Und auch die gesellschaftlichen und rezeptiven Horizonte der jeweiligen Ersterscheinungsjahre (1994 und 1974) sind kühn zusammengetackert. Dennoch wird der Vergleich sauber durchgeführt und erreicht in der Conclusio sozusagen den Zielkorridor differenzierten lit crits. Hier die anthropologische Konstante des Reagierenmüssens, wenn einem Leid widerfährt, um nicht komplett stecken zu bleiben. Und dort die Relativierung dieser Generalisierung mit dem Nutzbegriff des Kultur(en)spezifischen:
„Denn die Romane offenbaren kulturübergreifende menschliche Erfahrungen, die alle Völker miteinander verbinden, aber auch gleichzeitig kulturspezifische und individuelle Herangehensweisen an Schicksalsschläge, deren Mitteilung in jedem Fall eine Bereicherung darstellt.“
Gerne würde ich das Trio komplett machen und schreiben, dass man auch Akila Ahoulis „entwicklungspolitische Lektüre“ von Storms „Schimmelreiter“ zu den gewagten, aber letzten Endes gelingenden Arbeiten zu zählen und ad „Acta“ zu legen hat. Für meinen Geschmack überspannt der togoische Schriftgelehrte den Bogen allerdings, wenn er Auslegungen zur Deichgraf-Novelle apportiert, in denen die Nordseeküstenausgabe der Querelle des anciens et des mordernes interpretiert wurde als Konflikt zwischen Ingenieurskunst und Naturbeherrschung durch Beschwörung und Magie. Und dann zur ganz großen Übertragung ansetzt:
„Damit verhält sich Hauke wie ein Modernisierer bzw. wie ein Entwicklungshelfer, der seine Entwicklungsstrategien mit Überheblichkeit durchsetzt, indem er die örtlichen Traditionen mit den Füßen tritt“ –
und deswegen „in den Ländern der ‚Dritten Welt‘“ scheitert. Der Spagat ist dann doch (zu) groß, findet man, wenn auch anregend. Hauke Haien in einem Gedanken- und Atemzug mit Schweizer Tiefbrunnenbohrern, die mit ihrem Tun ungewollt ganze Landstriche austrocknen: naja.
Die Abteilung Hausgemachtes
Drittens hat es in der „Acta Germanica“die Abteilung Haussegen, also die Rubrik zur Beschäftigung mit sich selbst und Seinesgleichen. Mal erteilt man sich den Segen, mal hängt er schief.
Dem freundlich gesonnenen Nachbarjournal aus Westafrika, „Mont Cameroun“, wird im Miszellen- und Berichtsbereich Gelegenheit gegeben, sich und seine Publikationspolitik vorzustellen. Der Tagungsband zum Sondersymposium 2010 in Stellenbosch, ausgerichtet vom SAGV und der Schwestervereinigung GAS aus dem westlichen Afrika, bei dem es im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika um Spiel und Leidenschaft und Texte ging, wird wohlwollend besprochen. Und dann schließt ein wunderbar spröde geschriebener Verriss die 160-seitige und für 42 Euro im Einzelheft erhältliche Ausgabe ab, den ein Beiratsmitglied aus KwaZulu-Natal auf die ihrer Meinung nach etwas zu beliebig zusammengestoppelten „Aufsätze zur neueren deutschen Literatur“ der Kollegin aus Johannesburg (Witwatersrand) niederprasseln lässt. Ziemlich großes Kino ist das, auch wenn die Besprechung dem Binnenklima innerhalb des Germanistenverbandes im südlichen Afrika kaum zuträglich sein wird.
Fazit
Der Mix macht’s. Vor allem die Beiträge aus Afrika sind – solange sie nicht versuchen, allzu Disparates aufeinander zu beziehen – die Lektüre wert. Die Beiträger/innen zeigen sich zumeist gut erholt vom germanistikschulmeisterlichen Drill und gehen souverän mit den Konditionierungen auf Kanon und Klassikerpflege um, mit denen man an manchen philologischen Instituten leider immer noch zugeritten wird. Dazu gesellen sich ambitionierte Arbeiten deutschstämmiger Germanist/innen im südlichen Afrika zur zeitgenössischen Afrikaliteratur aus deutschen Landen (etwa Kira Schmidt über historiografische Metafiktion bei Stangl und Trojanow) und, nicht zu vergessen nur in diesem Band stark unterrepräsentiert, linguistische Beiträge.
Bruno Arich-Gerz
„Acta Germanica“: Jahrbuch des Germanistenverbandes im südlichen Afrika. ISSN: 0065-1273. Mehr hier.











