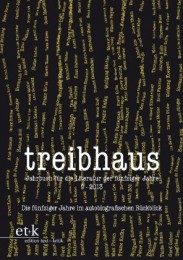 The boring fifties? The roaring fifties!
The boring fifties? The roaring fifties!
In „treibhaus“, dem Jahrbuch zur deutschsprachigen Literatur der fünfziger Jahre, knöpfen sich akribische Autorenphilologen eine Dekade vor. Bruno Arich-Gerz stellt die Publikation in unserer neuen Rubrik „journaille. der zeitschriftencheck“ vor.
Mit den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts assoziiert man vielerorts Mief und Muff, Langeweile und Stillstand, dazu Adenaueranästhesie und Restauration in der BRD und grimmige Selbstlegitimation durch fragwürdige Verfahren wie das Niederknüppeln von Volksaufständen in der DDR. Auch auf literarischem Gebiet, so die landläufige Ansicht, ging es eher verschnarcht zu. Dass dem nicht so ist, beweist der zweite Blick – insbesondere wenn man unter fifties die „langen fünfziger Jahre“ in Deutschland versteht: einschließlich der ersten Treffen der Gruppe 47 also, und ausgreifend bis mindestens zum Mauerbau, wenn nicht sogar bis an den Vorabend der studentischen Proteste im Mai 1968. Und auch in den zehn Jahren mit der 5 vornedran war in der Szene einiges los: Im Jahr 1956 etwa raffte eine ominöse Dichterpest die Großmeister Brecht und Benn dahin. Außerdem gilt 1959 gemeinhin als annus mirabilis deutscher Erzählkunst, als mit Uwe Johnsons Mutmaßungen über Jakob, Heinrich Bölls Billard um halbzehn und Günter Grass’ Blechtrommel gleich drei nachhaltig wirkmächtige Prosawerke das Licht der Leselampen über den Nierentischen der Literaturfreunde erblickten.
treibhaus 9: „Die fünfziger Jahre im autobiographischen Rückblick“
Es ist daher nur folgerichtig, dass sich seit 2005 ein germanistisches „Jahrbuch“ den fünfziger Jahren widmet. Das von Ulrike Leuschner, Günter Häntzschel und Sven Hanuschek herausgegebene „treibhaus“ ist inzwischen auf neun Hefte angewachsen. Der Name treibhaus ist Anspielung und Programm in einem: Anspielung, weil er sich bis hin zur wunderschönen Umschlaggestaltung an Wolfgang Koeppens gleichnamigem Roman um einen SPD-Bundestagsabgeordneten im verklüngelt-vergangenheitsvergessenen Bonner Bundesbetrieb ausrichtet. Und Programm, weil sich damit laut Auskunft der Herausgeber „Dunst, Abgeschlossenheit und Künstlichkeit ebenso assoziieren“ lassen „wie das Wuchern seltener Pflanzen“.
Die Pflege literarischer Orchideen steht auch im aktuellen Heft (das mit einer Reihe von bis dahin unveröffentlichten Erinnerungsvignetten an die fünfziger Jahre von Ingrid Bachér, Christoph Meckel und anderen aufmacht) neben der Hege heimischer Großgewächse. Promovierte und habilitierte Hortikulturbeauftragte harken sich mit viel Philologenadrenalin durch die Beete mit den Namensschildchen „Kempowski“, „Brecht“, „Johnson“, „Heym“, „Härtling“, „Bachmann“, „Fried“, „Grass“, „Celan“ sowie den weniger namhaften, dafür neuentdeckungswürdigen Zeitzeugen der fünfziger Jahre. Thematisch geht es, Stichwort Zeitzeugen, ums Erinnern beziehungsweise um autobiographische Annäherungen an eine Zeit, in der es Deutschland weltkriegsniederlagenbedingt plötzlich in doppelter Ausführung gab und man sich an die Systemkonkurrenz zwischen kapitalismusdemokratischer BRD und vom Kommunismus und der Planwirtschaft überzeugter DDR zuerst einmal gewöhnen musste.
Autobiographie-Theorie: Das wahrlich nötige Rüstzeug
Dazu wird allerhand Theoriegestänge angeschleppt und montiert: Lejeune, Holdenried oder Starobinski zum Komplex Autobiographie sowie aus der Abteilung Memorialkonzepte unter anderem die Assmanns. Die Montage gerät nicht immer glücklich, und bisweilen kommen die Autobiographie-Theorien spürbar nur als Namedropping zur Anwendung. Oder sie werden apodiktisch als wenig erkenntnisträchtig heruntergestuft, so in Giusi Zanasis ansonsten instruktiver Studie über Hans-Ulrich Treichel und seinen zu Romanen gewordenen Lebensweg als Ostflüchtling, der in Westfalen zwar keine, in den akademischen Zirkeln aber sehr wohl neue Wurzeln schlägt und sich irgendwann aufmacht, seine möglichen Blutsverwandten in Osteuropa aufzusuchen:
„Dabei verzichte ich von vornherein auf einleitende Bemerkungen zur Gattung, denn spätestens seit den 1970er Jahren und vor allem seit der Erinnerungsflut der 1990er Jahre häufen sich zusätzlich theoretisch-kritische Reflexionen über Biographie und Autobiographie, die von einer überdifferenzierten Typologie bis zur allgemeineren, nicht illegitimen Feststellung reichen, dass alles literarische Schreiben, teilweise selbst das literaturkritische, autobiographisch ist. “
Allen Vorbehalten von wegen überdifferenzierter Typologie zum Trotz tut terminologische und konzeptionelle Klarheit in diesem „treibhaus“ sehr wohl not, hat man es doch mit Schreibprozessen zu tun, die über zwei Dinge zugleich Auskunft geben: über das, was aus der Fünfziger-Jahre-Vergangenheit erinnert wird, und über die Art, wie man sich selbst im Moment des Niederschreibens rückblickend sieht und so in der Gegenwart konstituiert. Hinzu kommt, dass die untersuchten Texte von ausgefuchsten Gratwanderern stammen, die in der Beschreibung das faktische Erleben gekonnt mit fiktionalem Überschuss anzureichern wissen. Oder es handelt sich gleich um Texte der Kategorie AutoBioFiktion: um letztlich fiktionale Handlungen also, in die aber jede Menge Selbsterlebtes aus den fünfziger Jahren einfließt. Oder – nochmal komplexer – es liegen von ein und derselben Autorin oder demselben Autoren zwei autobiographisch gefärbte Primärtexte vor, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind und deswegen unterschiedliche Sichtweisen und „Selbstentwürfe“ enthalten. Marco Falcone nimmt sich dieser besonderen Konstellation in zwei „Lebensberichten“ von Ursula Hötsch-Harendt an, die Mitte und Ende der 1980er Jahre in der DDR erschienen sind und neben den Erinnerungen an Flucht, Vertreibung und Sesshaftwerden in Ostdeutschland auch einen Abstich der späten Breschnew-Ära beziehungsweise der anbrechende Perestroika unter Gorbatschow darstellen. Ähnlich erkenntnisreich gerät Cettina Rapisardas Studie über Erich Frieds Befreiung von der Flucht, einem Lyrikband von 1968, in dem er seine zehn Jahre zuvor, also in den fünfziger Jahren entstandenen Gedichte durch „Gegengedichte“ ergänzt und somit beide Sammlungen einander bespiegeln und kommentieren lässt. Auch Ursula Böhmel Ficheras Studie zu Elisabeth Plessens autobiographischen Romanen Mitteilung an den Adel (1976) und Das Kavalierhaus (2004) berücksichtigt die Unterschiede in der erinnernden Selbstkonstituierung, wobei der Fokus auf dem jüngeren der beiden Erzähltexte liegt.
Mittellagen, wild Vergleichendes und Bashings
Diese drei Untersuchungen zählen zur soliden Mittellage dessen, was im „treibhaus 9“ an Qualitätsbeiträgen versammelt wurde. Bahnbrechend sind sie allesamt nicht, gehören aber ebenso wenig zu den ermüdend umständlichen oder schlichtweg banal-erbsenzählerischen Beiträgen, die es bedauerlicherweise auch gibt. Zu einfach macht es sich zum Beispiel einer, der in Vergleich setzt, was sich nur schlecht vergleichen lässt: die autobiographischen Schriften von Georg Hensel, Carl Zuckmayer (Des Teufels General) und Günter Grass nämlich, bei deren Publikationsjahren zwischen Zuckmayer und Grass satte vierzig Jahre liegen (1966 und 2006). Hinzu kommt eine gedrechselte Sprache, die es einem vor lauter Entzifferungsarbeit geradezu verleidet, den Sinn des Gesagten zu erfassen.
„Die Gedächtnisarbeit, die „grundsätzlich rekonstruktiv [verfährt]“, ein Expressionsmittel des Gewesenen und eine Wanderung in der Zeit ist, hat bei Grass ihren deutlichen Zwangscharakter. Als ein Nebenprodukt des Krieges materialisiert sie sich vordergründig in den Noten der insbesondere frühen fünfziger Jahre, den Bildern der Unbehaustheit und vegetativen Existenz mit Orts- und Zeitangaben, unter ausdrücklich benannten Umständen. “
Einen etwas schalen, weil zu sehr lediglich Handlung nacherzählenden und Themen aufzählenden (und insofern wenig analytischen) Eindruck machen auch Beiträge wie derjenige über Hannelore Valencaks Vorhof der Wirklichkeit (1972). Immerhin wird damit eine österreichische Schriftstellerin rehabilitiert, die im Literaturbetrieb weitgehend (und zu Unrecht) in Vergessenheit geraten ist.
Auch Otto Flake zählt zu diesen Übergangenen: Zumindest assoziiert der elsässische Publizist und durchaus erfolgreiche Vorkriegs-Literat selbst die fünfziger Jahre im Rückblick mit dem Verblassen des eigenen Ruhms, wie Hermann Gätje darlegt. Gätje ist ausgewiesener Flake-Kenner und hat zusammen mit dem fabelhaften Sikander Singh vom Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass soeben einen Band mit ausgewählten Erzählungen Flakes herausgegeben. Sein Beitrag ist lesenswert, und das gilt – wenn man sich einmal an die archivwühlerische und nachlassbeschnüffelnde Art gewöhnt hat – auch für einige andere Aufsätze über die Damen und Herren Primärliteraten, von Härtling bis Heym, die es in den fünfziger Jahren oder danach zu literaturbetrieblichem Ruhm gebracht haben.
Ausgewiesenes Spezialistentum kommt der Qualität der Beiträge allerdings nicht immer zugute und steht ihr manchmal, so möchte man meinen, glatt im Weg. Das gilt etwa für die Abrechnung – als nichts weniger inszeniert sie sich – mit Günter Grass’ umstrittener Erinnerungsschrift Beim Häuten der Zwiebel (2006), der die (zu) genaue Kenntnis der biographischen Details des großartigen Paul Celan zum Verhängnis wird. Alles, aber wirklich alles wird in Grass’ Autobiographie und seinen Schriften aus den fünfziger Jahren auf das, so der Vorwurf, durch eigenes schuldhaftes Zutun kompliziert gewordene Verhältnis Grass-Celan zurückgebogen: bis hin zu Eddi Amsel aus Hundejahre, der dechiffriert wird als stand-in für Celan, né Antschel. Wenn es denn nötig ist, auch diese Strophe zu den Chorälen des nach seiner (viel zu späten) Selbstentlarvung als Mitglied der Waffen-SS losgetretenen Günter Grass-Bashings hinzuzufügen, dann sei’s drum. Mir hat die Studie zu viel Schaum vorm Mund.
„Stilistisch wäre noch der Neologismus ‚Hundston‘ anzuführen“ – oder: wo die Lektüre besonders lohnt
Gibt es auch Beiträge, die man ohne Einschränkungen über den grünen Klee loben mag? Am ehesten kommt dafür Stephan Braeses Zusammenschau dreier Autobiographien in Frage, die sowohl vom Publikationsdatum her eng beieinanderliegen als auch durch den Erlebnishorizont der sich Erinnernden einen gemeinsamen Nenner aufweisen. Der Theaterregisseur Peter Zadek, der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki und der Publizist Fritz J. Raddatz, allesamt zwischen 1920 und 1931 geboren, veröffentlichten um die Jahrtausendwende herum ihre Erinnerungen. Braese gelingt es sehr überzeugend, diesen Schriften – mal gemäß der entsprechenden Theorie von der Art der Beschreibung her eher „Memoiren“ mit Fokus auf Zeitläufte bei herabgedimmter eigener Person, mal ausgewachsene Autobiographien, in deren Mittelpunkt überdeutlich das erinnerte Ich sich Platz und Stimme verschafft – aufeinander zu beziehen. Und dabei eine Art Wärmebild der Fünfzigerjahre-Bundesrepublik als Rückkehrer- und Ankunftsland zu zeichnen: Zadek kam aus dem Londoner Exil, Reich-Ranicki als Holocaust-Überlebender aus dem heutigen Polen und Raddatz aus ostdeutschen Gefilden nach Adenauerland.
Alle treffen sie Establishments an: altetablierte und durch ihren Wohlstand bedingt weitgehend indifferente wie Raddatz im Segment Großpublizisten, oder durch Hochnäsigkeit und literarisches Jeunesse-Dorée-Gehabe besonders schwierige wie Reich-Ranicki mit den Gruppe-47-Schriftstellern um Hans Werner Richter und, ja, den ambivalenten Günter Grass. Am Ende resümiert Braese für die fifties, mit deutlichem Anklang an die Argumentationsmuster Siegfried Kracauers über die Weimarer Republik („Dispositionen“):
„Dass die 1950er Jahre der Bundesrepublik Deutschland eine Epoche der Restauration waren, ist ein Gemeinplatz, dessen geläufiger Gebrauch zu vergessen – wenn man so will: erneut zu verdrängen – geholfen hat, auf welche Weise diese Disposition den Alltag bis tief hinein in die sozialen Verhaltensweisen geprägt hat. Die Kaltschnäuzigkeit, der Reich-Ranicki in Redaktionen und unter Schriftstellern der „jungen“ Generation begegnete; der Bedarf nach ‚Führung‘ bei gleichzeitigem, entschiedenem Desinteresse an der jüngsten Vergangenheit, die Zadek unter dem deutschen Schauspielernachwuchs kennenlernte; die freudig eingegangene Betäubung jeglicher Ansprechbarkeit auf gesellschaftliche Konflikte durch Wohlstand und Luxus, die Raddatz in Verlagen und Redaktionen vorfand – in ihnen wird das Antlitz einer Epoche erkennbar, die Differenz, Dissens, jede Form von Abweichung zu stigmatisieren, ihre etwaige Wirksamkeit auszulöschen trachtete und die erst durch ein neues Jahrzehnt abgelöst werden musste, damit etwas „Frisches, Offenes“ in Sichtweite geriet. “
Stephan Braese ist also richtig gut, findet der journaillist. Auf ihre Weise sehr zu gefallen weiß auch die Studie zu Bert Brechts Gedicht An die Nachgeborenen, das der Theatertheoretiker und Stückeschreiber im Jahr 1953 selbst rezitiert und dabei auf Tonträger hat bannen lassen. An die fünfziger Jahre erinnert wird hier wenig bis gar nicht, muss dazu gesagt werden; vielmehr wird hier in den Fünfzigern ein Stück Lyrik aus den 1930er Jahren recycelt: am Thema des Jahrbuchbandes vorbei geschrieben, könnte man einwenden. Lässt man aber Nachsicht walten, dann vermag Ingvild Folkvord durchaus Begeisterung auszulösen, wenn sie die klanglichen Eigenheiten der Rezitation geduldig und präzise in Sprache übersetzt.
„So hört man auch ganz am Ende der Rezitation das Deklamatorische in Brechts retardierender Aussprache von „mit Nachsicht“ aus dem letzten Vers. Solche vokalen Gesten wirken zielgerichtet artikuliert, unterscheiden sich von dem sonst eher nüchtern berichtenden Ton und stehen in einem Spannungsverhältnis zu der weitaus sachlicheren Rezitation am Beginn.“
Schließlich ist da noch der Beitrag von Jürgen Egyptien zu Uwe Timms 2005 erschienener Ego-Fiktion Der Freund und der Fremde über seinen langjährigen Wegbegleiter Benno Ohnesorg. Der Aufsatz strotzt nur so von germanistischer Gelehrsamkeit und Auslegungen im Geiste einer profunden bildungsbürgerlichen Sozialisierung, die der Autor nicht verleugnen kann und die dem Aufsatz eine bizarre schillernde Note verleihen: etwa wenn die ästhetischen Ambitionen Timms und Ohnesorgs in aufgeregt-aufgewühlten Zeiten mit der goetheschen Elle von Werther und Lotte ausgemessen werden. Oder wenn die Rede auf das längst ins ikonische Kollektivgedächtnis eingesickerte Foto vom soeben tödlich getroffenen Ohnesorg kommt, „dessen Kopf Friederike Hausmann wie eine Pietà-Figur stützt“. Auch die gründliche Interpretation des einzigen erhaltenen Gedichts Ohnesorgs erfreut die philologisch instruierte Leserschaft – wird aber über diesen Zirkel hinaus eher Erinnerungen an merkwürdig verschrobene drill inspectors aus der Deutschstunde wecken:
„Auf der Ebene des Klangs hebt der Text mit einer massiven ‚sch‘-Alliteration in der ersten Zeile an, die ihr Echo in der Klangfolge ‚Schreie-Schmelze‘ am Ende des Gedichtes hat. Durchgehend finden sich Verse beziehungsweise Verspaare, die einen vokalischen Akzent tragen: Im zweiten Vers fällt der ‚a‘-Klang auf (Pfad-hinab-kalt), im vierten und achten Vers das wiederholte ‚ä‘ (hängen-Ästen; Gläserne-Flächen), der sechste, elfte und zwölfte Vers stehen im Zeichen des ‚u‘ (Spuren-Blumen; Tuch-Hundston-dunkle), der zehnte und elfte sind durch den Diphthong ‚au‘ verbunden (Mauern-graues). Nimmt man schließlich noch die Wortfolge im dritten und vierten Vers (Gesichter- Geronnene-Gedanken) hinzu, ergibt sich in Ohnesorgs Gebrauch der Alliterationen die Besonderheit, dass er sie gleichsam wie Enjambements einsetzt. Er spannt mit den Alliterationen häufig Klangbogen zwischen den Zeilen. Unter rhetorischer Perspektive sticht wiederum der erste Vers mit dem Kyklos (Schnee-Schnee) ins Auge. Am Ende der zweiten Zeile fungiert das ‚gefroren‘ als Apokoinu, das nicht nur prädikativ verwendet wird, sondern ebenso auf die Beschaffenheit des Pfads zurückbezogen werden kann. Stilistisch wäre noch der Neologismus ‚Hundston‘ anzuführen.“
Und dennoch hat die Studie Egyptiens etwas. Sie ist ein lebhafter Versuch, der von Timm thematisierten Beziehung zu Ohnesorg gerecht zu werden, die Mitte der sechziger Jahre in einer gepflegten Indifferenz des einen gegenüber dem anderen und im plötzlichen Tod dieses anderen mündet. Und sie ist ein engagiertes Plädoyer für eine Neuentdeckung Benno Ohnesorgs als Mensch mit ethischen und ästhetischen Positionen und Artikulationen.
Fazit
Man muss die fifties „wollen“, man muss etwas für sie und ihre deutschsprachige Literatur übrighaben: Dann lohnt es, im „treibhaus“ als lesender Untermieter einzuziehen. Doch Geduld sollte man mitbringen, denn es gibt Längen, und die regelmäßig über 300 Seiten starken Hefte sind bisweilen schon mal ein gefühltes Drittel zu umfangreich. Das, was gesagt werden muss, weil es wirklichen Erkenntnisgewinn enthält, kann man durchaus auch knapper zu Papier bringen. Und ein Zweites sollte man auch aufbringen: ein gewisses Verständnis für die manchmal ehrpusseligen, bisweilen psychologisierenden und immer peniblen Besonderheiten des autorenphilologischen Zugangs. Hier schreibt – mit anderen Worten – Ihr Max-Frisch-verzückter Deutschlehrer von damals, nur hat er jetzt noch den Turbo dazugeschaltet. Wenn Sie das abkönnen oder sogar selbst Erinnerungen an die roaring fifties in sich tragen, gibt es viel zu entdecken.
Bruno Arich-Gerz
treibhaus. Jahrbuch zur Literatur der fünfziger Jahre. Edition Text+Kritik 2013. 375 Seiten. 32,00 Euro. Mehr hier. ISBN: 978-3-86916-259-1











